Medizinische Mikrobiologie: Druckversion
Dieser Text ist sowohl unter der „Creative Commons Attribution/Share-Alike“-Lizenz 3.0 als auch GFDL lizenziert.
Eine deutschsprachige Beschreibung für Autoren und Weiternutzer findet man in den Nutzungsbedingungen der Wikimedia Foundation.
DRUCKVERSION des Wikibooks Medizinische Mikrobiologie
Online unter: http://de.wikibooks.org/wiki/Medizinische_Mikrobiologie
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Immunologie
- Mikrobiologische Diagnostik
- Prionen
- Allgemeine Virologie
- Spezielle Virologie: Poxviridae - Herpesviridae - Adenoviridae - Polyomaviridae - Papillomaviridae - Parvoviridae - Hepadnaviridae - Retroviridae - Reoviridae - Rhabdoviridae - Filoviridae - Paramyxoviridae - Orthomyxoviridae - Bunyaviridae - Arenaviridae - Deltavirus - Picornaviridae - Caliciviridae - Hepevirus - Astroviridae - Coronaviridae - Flaviviridae - Togaviridae
- Allgemeine Bakteriologie
- Spezielle Bakteriologie: Gram-positive Bakterien - Gram-negative Bakterien - Atypische Bakterien
- Mykologie
- Parasitologie: Protozoen - Würmer - Arthropoden
- Mikrobiologie nach Krankheitsbildern
- Medizinische Mikrobiologie: Literatur und Weblinks
Geschichte der Mikrobiologie
Mikroorganismen als Krankheitserreger
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hielt sich die Vorstellung, dass Infektionskrankheiten über schlechte Dünste, sogenannte Miasmen verbreitet werden, was sich bis heute in einigen Begriffen (Malaria: "schlechte Luft") und homöopathischen Konzepten erhalten hat. Bereits 1665 entdeckte der niederländischer Naturforscher und Mikroskopebauer Antoni van Leeuwenhoek mit Hilfe eines selbstgebauten Mikroskops in Gewässern und im menschlichen Speichel Bakterien und Protozoen. Aber erst in den 1850igern kam Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) der Verdacht, dass schmutzige Hände als Überträger z.B. des Kindbettfiebers eine entscheidende Rolle spielten. Es dauerte weitere Jahrzehnte bis sich das Konzept der mikrobiellen Krankheitserreger und entsprechenden Gegenmaßnahmen überall durchsetzen. Daraufhin führte der schottische Chirurg Joseph Lister (1827-1912) im Jahre 1867 das Besprühen des Operationsfeldes mit desinfizierendem Karbol ein und konnte dadurch einen steilen Abfall der Mortalität im Operationssaal erreichen. Eine Zusammenstellung bestimmter Kriterien bei einer Infektion gab Koch 1882 in einem Aufsatz über Tuberkulose an. Friedrich Loeffler, ein Schüler von Koch, gab 1883 ähnliche Kriterien für die Postulate an. Schon 1877 hatte der Bakteriologe Edwin Klebs ähnliche Bestimmungen formuliert. Die Arbeiten von Jakob Henle (1809-1885, Anatom und Pathologe) und Robert Koch (1843-1910, Arzt und Mikrobiologe) führten in der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts zur Formulierung der sogenannten Henle-Koch-Postulate. Auf dem 10. Internationalen Medizinischen Kongress von 1890 in Berlin sprach Koch "Über bakteriologische Forschung": "Wenn es sich nun aber nachweisen ließe:
- erstens, dass der Parasit in jedem einzelnen Falle der betreffenden Krankheit anzutreffen ist, und zwar unter Verhältnissen, welche den pathologischen Veränderungen und dem klinischen Verlauf der Krankheit entsprechen;
- zweitens, dass er bei keiner anderen Krankheit als zufälliger und nicht pathogener Schmarotzer vorkommt; und
- drittens, dass er von dem Körper vollkommen isoliert und in Reinkulturen hinreichend oft umgezüchtet, imstande ist, von neuem die Krankheit zu erzeugen;
dann könnte er nicht mehr zufälliges Akzidens der Krankheit sein, sondern es ließe sich in jedem Falle kein anderes Verhältnis mehr zwischen Parasit und Krankheit denken, als dass der Parasit Ursache der Krankheit ist." Die Henle-Koch-Postulate können in dieser Strenge allerdings nicht in jedem Fall erfüllt werden.
Impfungen
Schon vor dem Aufkommen dieser Erkenntnisse wurde Mikrobiologie praktisch angewandt: Es war lange bekannt, dass das einmalige Durchstehen der Pockenkrankheit ebenso wie das Durchstehen der Kuhpocken (eine beim Menschen leicht verlaufende Rinderkrankheit) gegen weitere Ansteckungen durch die Pocken immun machte. Der englische Arzt Edward Jenner (1749 - 1823) experimentierte mit diesem Wissen und infizierte im Jahr 1796 einen Jungen mit den Kuhpocken. Im Anschluss war dieser Junge gegen die gefährlicheren Pocken immun. Jenner beschrieb diese Technik mit dem Wort „Vaccination“. Es stammt von dem lateinischen Wort „vaccinia“ für Kuhpocken, welches wiederum vom lateinischen Wort für Kuh „vacca“ abgeleitet ist. Diese erste Impfung wurde rasch in Europa aufgegriffen, die Ursache der Infektionskrankheiten war jedoch nach wie vor unbekannt.
Dies änderte sich gegen Ende des 19. Jahrhundert. Louis Pasteur formulierte 1864 die Keimtheorie, Robert Koch erbrachte 1876 den Nachweis der Krankheitserreger von Milzbrand und 1881 den Nachweis des Tuberkulose-Bakteriums. Diese Entdeckung gilt als der endgültige Beweis der Existenz bakterieller Krankheitserreger. Schüler von Koch und Pasteur bauten das Konzept weiter aus. Pasteur entwickelte gemeinsam mit Emile Roux Impfstoffe gegen Milzbrand (1881) und Tollwut (1885). Paul Ehrlich, Emil von Behring und Shibasaburo Kitasato nutzten das Wissen zur passiven Impfung gegen Diphtherie und Wundstarrkrampf (1890). Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurden zahlreiche weitere Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt, beispielsweise von Jonas Salk und Albert Sabin gegen die Kinderlähmung oder ein Impfstoff gegen Gelbfieber durch Max Theiler. Seit 1967 werden unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweite Impfprogramme aufgelegt. Das Programm ist äußerst erfolgreich; beispielsweise gelten die Pocken offiziell seit 1980 als ausgerottet.
Antibiotika
Mit Salvarsan wurde um das Jahr 1909 von Paul Ehrlich und Sahachiro Hata das erste Antibiotikum entwickelt, welches 1910 in den Handel kam. Der Name Salvarsan (zusammengesetzt aus dem lat. salvare: retten/heilen und Arsen) bedeutet "heilendes Arsen". Tatsächlich stellte Salvarsan einen Meilenstein in der Arzneimittelforschung dar. Zum ersten Mal stand der Medizin ein gezielt antimikrobiell wirkendes Medikament gegen eine gefährliche Infektionskrankheit zur Verfügung. Darüber hinaus war Salvarsan nicht nur gegen die Syphilis, sondern auch gegen Framboesie, Rückfallfieber und andere Spirochaeteninfektionen wirksam. So gesehen kann man Salvarsan aus heutiger Sicht als eines der ersten antimikrobiellen Arzneimittel bezeichnen.
Alexander Fleming entdeckte im September 1928 die antibakterielle Wirkung von Schimmelpilzen. Damit war der Grundstein für die Entdeckung des Penicillins gelegt.
Heutige Situation
Während die klassischen Infektionskrankheiten durch Hygiene, Impfungen und Antiinfektiva (in entwickelten Ländern) stark an Bedeutung verloren haben, sind durch die Zunahme invasiver und aggressiver Verfahren in der Medizin (Transplantationen, Intensivtherapie, Chemotherapie) opportunistische Infektionen durch normalerweise harmlose Erreger stark in den Vordergrund gerückt. Durch unkritischen Antibiotikaeinsatz sind viele Erreger heute gegen zahlreiche Antibiotika resistent.
Übersicht über die Erreger von Infektionskrankheiten
Unbelebte Erreger:
- Prionen - Prionen sind infektiöse Eiweißpartikel, die in ihrer physiologischen Form (PrPc) vor allem im Nervensystem vorkommen und bei Fehlfaltung (PrPsc) zu unlöslichen Plaques polymerisieren. PrPsc kann durch eine gewisse Chaperon-Aktivität die Fehlfaltung von PrPc induzieren (Kettenreaktion).
- Viroide - Viroide sind nackte, infektiöse Nukleinsäuren. Man findet sie vor allem im Pflanzenreich. Beim Menschen kommt das Hepatitis-D-Viroid (HDV) vor, das sich nur in HBV-infizierten Zellen vermehren kann, in dem es sich vom HBV das HBs-Antigen, d.h. die Hüllproteine (surface) ausleiht.
- Viren - Viren sind infektiöse Partikel, die aus einer ein- oder doppelsträngigen Nukleinsäure (die für virale Proteine und Enzyme kodiert) bestehen, die von einer Proteinhülle (Kapsid) umgeben ist. Einige Viren tragen zusätzlich noch eine Phospholipiddoppelmembran-Hülle (envelope), die meist von der Wirtszellmembran abstammt.
Lebewesen:
- Archaea - Die Archaeen (Archaea) bilden eine der drei Domänen, in die alle zellulären Lebewesen eingeteilt werden. Es sind einzellige Organismen mit einem meist zirkulären DNA-Molekül, dem Chromosom, das als Kernäquivalent (Nukleosid) frei im Zytoplasma liegt. Sie besitzen weder ein Zytoskelett noch Zellorganellen. Von den Bakterien (Bacteria) unterscheiden sie sich aber durch das Fehlen von Peptidoglycan (Murein) und eine andere Struktur ihrer Ribosomen. Die Zellwand besteht aus Pseudopeptidoglycanen und die Zellmembran aus Einfachschichten, die von Etherlipiden mit kovalent gebundenen Ketten gebildet werden. Mit etwas über 200 Arten sind sie meist in extremen Lebensräumen anzutreffen. So gibt es Arten, die bevorzugt bei Temperaturen von über 80 Grad Celsius wachsen (thermophil), andere leben in Salzlösungen (halophil) oder in stark saurem Milieu (pH-Wert bis 0). Archaeen sind in der Forschung von Interesse, da sie vielleicht Merkmale des frühen Lebens auf der Erde erhalten haben. Aber auch ihr außergewöhnlicher Stoffwechsel ist von Interesse, beispielsweise um sie bei der Boden- und Gewässersanierung einzusetzen, wie es einigen Arten gelingt, bei 110 °C zu wachsen (Archaeoglobus spec). Bisher ist keine für den Menschen pathogene Art bekannt. Sie werden daher in diesem Buch nicht weiter behandelt.
- Bacteria - Die Domäne der Bakterien (Bacteria) umfasst einzellige Organismen mit frei im Zytoplasma liegender zirkulärer DNA (Nukleosid, Kernäquivalent) ohne basische Kernproteine (Histone) und zusätzlicher DNA in Form kleiner ringförmiger Plasmide. Weiterhin besitzen Bakterien 70s-Ribosomen und eine Zellwand aus Murein (Peptidoglykan). Bakterien vermehren sich ungeschlechtlich durch Querteilung. Die Größe der meisten Bakterien variiert zwischen 1 und 5 μm, Chlamydien und Rickettsien sind mit 0,2-1 μm etwas kleiner.
- Eucarya - Zur Domäne Eukarya gehören alle ein- und mehrzelligen Organismen mit einem echten, d.h. von einer eigenen Doppelmembran umschlossenen, Zellkern. Die DNA liegt meist in mehreren Chromosomen vor und wird durch basische Histon-Proteine organisiert. Eukaryoten besitzen im Gegensatz zu Bakterien Zellorganellen (d.h. von einer Einfach- oder Doppelmembran abgegrenzte Zellkompartimente) wie Mitochondrien, Chloroplasten (Pflanzen) und ein endoplasmatisches Retikulum. Die Translation erfolgt durch 80s-Ribomosomen. Die Vermehrung erfolgt in den meisten Fällen geschlechtlich.
- Protozoen (Urtierchen) - Protozoen sind einzellige Eukaryonten, von denen einige als Parasiten des Menschen bekannt sind. Zu ihnen gehören bspw. die Plasmodien (Malaria), Amöben (Amöbenruhr) und Trypanosomen (Chagas-Krankheit, Schlafkrankheit).
- Fungi (Pilze) - Pilze sind Eukaryonten mit einer festen Zellwand, bestehend aus Glucanen, Mannanen, Cellulose und Chitin. Sie betreiben keine Photosysnthese (keine Chloroplasten) und leben C-heterotroph von organischen Substanzen, meist als Destruenten (Verwerter toter organischer Substanz). Fungi können einzellig (Hefen) und in Verbänden (Hyphen, Myzel) vorkommen, viele auch in beiden Formen (dimorph). Etwa 300 humanpathogene Pilze sind bekannt. Typische Pilzerkrankungen sind Haut-, Haar-, Nagelpilz und opportunistische Infektionen bei Immungeschwächten.
- Metazoen (Mehrzeller) - Zu den Mehrzellern gehören Pflanzen (Plantae) und Tiere (Animalia).
- Helminthen (Würmer) - Würmer sind Tiere mit langgestrecktem, schlauchförmigem Körperbau. Einige Vertreter parasitieren im Menschen im Magen-Darm-Trakt (Bandwürmer, Madenwürmer), in den Gallenwegen (Leberegel) und anderen Körperregionen (Spulwürmer, Billharziose, Filarien) oder lösen im Menschen als Fehlwirt Erkrankungen aus (Echinococcus).
- Arthropoden (Gliederfüßer) - Arthropoden besitzen einen mehr oder weniger segmentierten Körperbau mit einem Außenskelett aus Chitin. Zu dieser Gruppe gehören Krebse, Hundert- und Tausendfüßer, Spinnentiere (Spinnen, Skorpione, Milben) und Insekten. Neben toxinbedingten (Wespenstich, Skorpionstich, Skolopenderbiss) und allergischen (Hausstaubmilbe) Erkrankungen kommen einige Arten als Parasiten und Überträger (Vektor) von Krankheiten vor, so z.B. Stechmücken, Flöhe, Läuse und Zecken.
Gast-Wirt-Beziehungen
Mikrorganismen lassen sich nach ihrem Verhältnis zum Makroorganismus einteilen in:
- Saprophyten - Saprophyten leben von organischem Abfall (Destruenten) und sind (meist) nicht pathogen.
- Symbionten - Symbionten leben mit einer anderen Tierart in einer Beziehung, aus der jeder einen Nutzen zieht.
- Kommensalen - Kommensalen ("Mitesser") sind die physiologischen Bewohner der inneren (Magen-Darm-Trakt, obere Atemwege, Vagina) und äußeren Oberflächen (Haut), sie bilden die Normalflora, die sich vorwiegend aus Bakterien zusammensetzt.
- Kolonisation (Besiedelung) - Kolonisation ist die Besiedelung des Makroorganismus ohne Infektion, d.h. ohne aktives Eindringen ins Gewebe. Der Mensch wird v.a. durch die Normalflora besiedelt. Die Hautflora besteht aus dauerhaft (residente Flora) und aus vorübergehend (transitorische Flora) anwesenden Keimen.
- Parasiten - Parasiten leben in einer Beziehung auf Kosten des anderen.
- Opportunisten - Opportunisten sind gering bzw. fakultativ pathogene Erreger, die Krankheiten auslösen, wenn die Situation für sie opportun ist, z.B. bei Immunschwäche (AIDS, Immunsuppression) des Wirts oder bei Eindringen in sterile Körperhöhlen (Harnwegsinfektion durch E. coli, Wundinfektionen). Viele opportunistische Erreger gehören zur Normalflora, Infektionen durch diese Keime nennt man endogene Infektionen.
- pathogene Krankheitserreger - Typische Krankheitserreger, die bei Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Krankheit auslösen.
Die Normalflora
Die Normalflora der Haut
Die gesunde Haut ist dicht besiedelt mit Bakterien und Pilzen, die für den Gesunden meist ungefährlich, in vielerlei Hinsicht sogar nützlich sind. So bieten sie z.B. Schutz gegenüber pathogeneren Organismen, deren Ansiedelung sie durch die Besetzung der vorhandenen ökologischen Nischen verhindern können, was man als Kolonisationsresistenz bezeichnet.
Feuchtigkeit, pH-Wert und Sauerstoffversorgung sind je nach Hautbereich sehr unterschiedlich, dementsprechend ist auch die Verteilung der einzelnen Bakterienarten ungleichmäßig. Je nach Hautregion, Alter, Geschlecht, genetischer Veranlagung und Umgebungsbedingungen können sowohl das Keimspektrum als auch die Keimzahlen der normalen Hautflora sehr unterschiedlich sein. Das Verhältnis von anaeroben zu aeroben Spezies ist mit 10:1 vergleichsweise ausgeglichen. Die Keimdichten liegen, je nach Region, zwischen 102 und 106 pro cm². Ungefähre Keimzahlen unterschiedlicher Hautregionen (Keimzahl pro cm²): Fingerkuppen 20 – 100, Rücken 3 x 102, Füße 102 – 103, Vorderarm 102 – 5 x 103, Hand 103, Stirn 2 x 105, Kopfhaut 106, Achselhöhle 2 x 106. Insgesamt leben rund 1010 Bakterien auf unserer Hautoberfläche.
Einflussfaktoren auf die Keimbesiedelung der Haut
Hornschicht: Abgesehen von denjenigen Mikroorganismen, die sich auf den Abbau des Keratins spezialisiert haben (Dermatophyten, Trichophyten), ist das Nährstoffangebot der Hautoberfläche eingeschränkt und somit bei weitem nicht für alle Bakterien ideal. Einer Invasion steht zudem das stetige Wachstum der Epidermis entgegen, die am stärksten besiedelten oberen Zellschichten werden kontinuierlich abgestoßen.
pH-Wert: Intertriginöse Hautbereiche und die Achselhöhlen haben höhere pH-Werte, die im alkalischen Bereich liegen. Der durchschnittliche pH-Wert der Haut liegt zwischen 5,4 und 5,9 (Säureschutzmantel). Ein pH-Anstieg an der Stirn führt zu einer deutlichen Zunahme der Propionibakterien (Faktor 100 – 1000).
Trockenheit: Trotz der Schweißdrüsen und transdermaler Flüssigkeitsabsonderung (Perspiratio insensibilis) bietet die Epidermis ein sehr trockenes Milieu, das einen schlechten Nährboden darstellt. Dem entsprechen die deutlich höheren Keimdichten in feuchten Hautbereichen (Intertrigines) wie Achselhöhlen, Finger- und Zehenzwischenräume, Leistenbeuge, Analfalte.
Lipide, Fettsäuren: Freie Fettsäuren, die teilweise erst durch bakteriellen Metabolismus gebildet werden (lipophile Keime, siehe unten), wirken auf viele Bakterienarten bakterizid. Eine Veränderung dieser Milieubedingungen zieht auch Verschiebungen in den Keimdichten der einzelnen Arten und Spezies nach sich. So nimmt beispielsweise der Anteil lipophiler Arten im Zustand der Seborrhoeae zu und die allgemeine Keimzahl steigt bei vermehrter Schweißbildung (Befeuchtung ansonsten trockener Haut) an.
Hautregionen mit besonderen Milieueigenschaften
Seborrhoische Zonen: Talgreiche Hautregionen sind besonders dicht mit lipophilen Keimen besiedelt, hierzu gehören: Corynebakterien, Propionibakterien und Malassezia furfur. Der lipolytische Stoffwechsel der Propionibakterien (u.a. durch Lecithinasen) führt zur Bildung freier Fettsäuren, die wiederum Einfluss nehmen auf die übrige Besiedelung der Haut. Neben diesen lipophilen Keimen (überwiegend Propionibakterien) sind auch reichlich koagulasenegative Staphylokokken und apathogene Mykobakterien vorhanden. Zu den seborrhoischen Zonen gehören: Stirn, Nasolabialfalte, Nase, Nacken und Schultern.
Feuchte Hautbereiche: Erhöhte Feuchtigkeit führt zu einer Zunahme der Keimdichte. In den intertriginösen Bereichen (Finger- und Zehenzwischenräume, Leistenbeuge, Achselhöhle, Pofalte) sind die Keimzahlen deutlich größer, als z. B. an den recht trockenen Unterschenkeln. Die Achselhöhlen sind sehr unterschiedlich besiedelt, entweder überwiegen koagulasenegative Staphylokokken neben wenigen Corynebakterien oder das Gegenteil ist der Fall. In den Schweißdrüsengängen siedeln sich Peptostreptokokken an, die nicht selten zur Ursache eines Schweißdrüsenabszesses werden. Zehenzwischenräume: Pigmentbildende Bacteroides-Spezies (B. melaninogenicus, B. asaccharolyticus) und Clostridium perfringens sind regelmäßig nachweisbar. Intertriginöse Bereiche sind relativ häufig mit (Hefe-)Pilzen besiedelt.
Trockene Hautbereiche: Z.B. Beugeseite der Unterarme: Insgesamt geringe Keimzahl. Koagulasenegative Staphylokokken überwiegen (102 – 103 KBE/cm²). Nur wenige Corynebakterien und Propionibakterien.
Besiedelung der Haarfollikel: Besonders hohe Keimzahlen überwiegend lipophiler Bakterienarten. Nahe der Oberfläche Staphylokokken und Malassezia, darunter aerobe Corynebakterien und in der Tiefe anaerobe, lipophile Bakterien (Propionibakterium). Ein großer Teil der Hautflora befindet sich im Bereich der Haarfollikel, 20% der gesamten Hautflora ist in den tiefen Abschnitten der Haarfollikel angesiedelt. Diese Keime sind auch durch eine Hautdesinfektion nicht zu eliminieren, sie bilden das Reservoir, aus dem sich die Hautflora nach der Desinfektion innerhalb von 24–72 Stunden erneuert.
Keimspektrum der residenten Flora
Staphylococcus: S. aureus (physiologisches Habitat: vordere Nasenhöhle), S.epidermidis, S. saprophyticus, S. hominis, S. xylosus, S. warneri, S. haemolyticus, S. saccharolyticus, S. cohnii, S. auricularis. Staphylokokken besiedeln bevorzugt feuchte und talgarme Hautregionen, wie intertriginöse Bereiche, Hände und Füße.
Corynebacterium: C. minutissimum, C. jeikeium, C. xerosis, C. pseudotuberculosis, C. pseudodiphteriticum, C. bovis.
Propionibacterium: P. acnes, P. granulosum, P. avidum.
Brevibacterium und Dermabacter verursachen u. a. den individuellen Körpergeruch.
Malassezia furfur (früher Pityrosporum ovale, P. orbiculare) ein dimorpher Sprosspilz. Vorkommen vor allem an Gesicht, Brust und Rücken (102 KBE/cm²).
"Mikrokokken": Micrococcus luteus, Micrococcus lylae, Kocuria kristinae [Micrococcus kristinae], Kocuria rosea [Micrococcus roseus], Kocuria varians [Micrococcus varians], Kytococcus sedentarius [Micrococcus sedentarius], Kytococcus schroeteri. Besonders bei Kindern nachweisbar.
Weiterhin Acinetobacter, apathogene Mykobakterien, Sarcina spp. u.a.m.
Transiente Keimbesiedelung
Enterobacteriaceen: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas und Enterobacteriaceen kommen an feuchten und warmen Hautregionen (intertriginöse Bereiche) häufiger vor.
Weitere Keime: Aerobe grampositive Sporenbildner u.a.m.
Bestimmung der Keimzahl auf der Haut (Detergenswaschmethode)
Bestimmung der Keimzahl auf der Haut (Detergenswaschmethode) Ein Hautbereich definierter Größe wird mit einem bestimmten Volumen Detergens-Lösung überschichtet. Die Keime der Hautoberfläche werden durch starkes Reiben im Detergens gelöst und nach einer Verdünnung angezüchtet.
Die Normalflora der Nasenhöhle
Die Normalflora der Nasenhöhle beinhaltet bei jungen Erwachsenen:[1]
Staphylococcus epidermidis (79%), Corynebakterien (41%), Staphylococcus aureus (34%), Haemophilus influenzae (5%), Streptococcus pneumoniae (0,5%). Anaerobier: Propionibacterium acnes (74,5%) und Finegoldia magna [früher: Peptococcus magnus, Peptostreptococcus magnus] (3,5%).
Die Normalflora des oberen Respirationstrakts und der Mundhöhle
Im Rachen findet man u.a. Staphylokokken, Streptokokken (alpha-, evtl. auch betahämolysierende und nichthämolysierende), Neisserien, Corynebakterien, Spirillen und Mikrokokken.
Die Normalflora des Darms
Der Darm des Menschen wird von 100 bis 400 verschiedenen Bakterienarten besiedelt. Von diesen leben etwa 1% streng anaerob (z.B. Clostridium difficile und C. perfringens), der Rest ist meist fakultativ anaerob, d.h. er kann Energie sowohl durch oxidative Phosphorylierung als auch durch anaerobe Gärung gewinnen (Enterobacteriaceae, Enterobakterien). Das bekannteste und in der Hygiene als Fäkalindikator genutzte Bakterium der Darmflora ist wohl Escherichia coli.
Die Vaginalflora

Die Vaginalflora der Frau ist überwiegend aus Laktobazillen (Milchsäurebakterien, Döderleinsche Bakterien) aufgebaut. Die häufigsten Spezies sind Lactobacillus iners, L. crispatus, L. delbruekii, L. jensenii, L. buchneri, L. gasseri und Bifidobacterium spp.. Die Bakterien ernähren sich vom Glykogen, das in den abgeschilferten Epithelzellen enthalten ist (Milchsäuregärung). Die gebildete Milchsäure ist für das vor bakteriellen Infektionen schützende saure Milieu in der Vagina verantwortlich (pH: 3,8 bis 4,5).
Die Scheidenflora kann mit dem Nugent-Score qualitativ und quantitativ bewertet werden.
Erregereigenschaften
- Pathogenität - Pathogenität ist die Fähigkeit eines Erregers, eine Krankheit bei einem bestimmten Wirt auszulösen. Man unterscheidet fakultativ pathogene Organismen, die nur unter bestimmten Umständen krankheitserregend sind, von obligat pathogenen Erregern, die meist eine Krankheit auslösen (z.B. Tollwut, Tetanus). Nach Art des erkrankenden Wirts spricht man von humanpathogenen und tierpathogenen Erregern.
- Virulenz - Der Begriff Virulenz subsummiert das Ausmaß der krankheitserregenden Eigenschaften, d.h. die Schwere des Schädigungsmusters bei Erkrankung.
Mechanismen der Pathogenität und Virulenz
Die krankheitserzeugenden Faktoren lassen sich in 5 Gruppen einteilen. Adhäsine sorgen für die Anheftung, Invasine für das Eindringen, Impedine schalten die lokale Immunabwehr aus, Aggressine erzeugen die Gewebeschäden und Moduline modulieren die Entzündungskaskade.
Adhäsine - Mechanismen der Anheftung
- Adhäsine - Adhäsine ermöglichen dem Mikroorganismus die spezifische Anheftung an das Zielgewebe. Adhäsive Faktoren sind z.B. Haftpili, Haftfimbrien und Haftproteine der äußeren Zellmembran (Gram-negative Bakterien) bzw. der Zellwand (Gram-positive Bakterien), die sich an bestimmte molekulare Oberflächenstrukturen binden (Schlüssel-Schloss-Prinzip).
Invasine - Mechanismen der Infektion
- Bakterien können generell über Verletzungen in das Gewebe eindringen (Bsp.: Clostridium tetani). Zahlreiche Erreger sind jedoch auch in der Lage, aktiv die Schleimhaut zu durchdringen. Folgende Mechanismen sind möglich:
- Aufnahme durch Makrophagen ohne Abtötung und Abtransport in die regionären Lymphknoten. Bsp.: Aufnahme von Tuberkelbakterien in der Lunge durch Makrophagen und enteropathogene Bakterien durch M-Zellen im Darm.
- Induzierte Endozytose. Einige Bakterien können die Zelle dazu veranlassen, Pseudopodien auszubilden und das Bakterium zu umschließen und in die Zelle aufzunehmen. Viren binden an bestimmte Rezeptoren und veranlassen die Aufnahme per Pinozytose.
- Die Produktion gewebsschädigender Exotoxine erleichtert das Eindringen.
Impedine - Verteidigungsmechanismen gegen die Wirtsabwehr
Um nicht sofort vom Immunsystem beseitigt zu werden, haben pathogene (und siedelnde) Mikroorganismen einige Strategien entwickelt.
Schutzmechanismen gegenüber der unspezifischen Immunabwehr:
- Phagozytoseschutz:
- Anti-Phagozyten-Toxine: Erreger können sich mit Toxinen gegen Fresszellen zur Wehr setzen. Bsp.: Leucocidin (Staphylococcus aureus), Streptolysin (Streptokokken), Perfringolysin O (Clostridium perfringens), Exotoxin A (ToxA, Pseudomonas aeruginosa).
- Kapsel: Die Wirkung kommt evtl. über eine Blockierung der alternativen Komplementaktivierung (C3b) zustande. Bsp.: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae.
- Phagosom-Lysosom-Fusionshemmung: Bsp.: Mycobacterium tuberculosis.
- Hemmung des oxidative burst : Bsp.: Legionella pneumophila.
- Komplement-Resistenz (Serumresistenz): Ein modifiziertes Lipopolysaccharid (LPS) Gram-negativer Bakterien aktiviert nicht mehr das Komplementsystem.
Schutzmechanismen gegenüber der spezifischen Immunabwehr:
- IgA-Proteasen: Typische Schleimhautparasiten wie Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae und N. meningitidis bilden Proteasen, die Mucosa-IgA zerstören.
- Antigenvariation: Einige Erreger können die Zusammensetzung ihrer Zellwand- oder Kapselantigene rasch variieren, so dass die Erreger auf neugebildetete und gegen sie gerichtete Antikörper rasch reagieren können (die spezifische Immunantwort bzw. die Induktion neuer Antikörper und Expansion der entsprechenden B-Zell-Klone dauert einige Tage). Bsp.: Neisseria gonorrhoeae kann die Primärstruktur seines Pilins (Haftpili-Antigen) auf genetischer Ebene durch Austausch einzelner Genkasetten rasch verändern.
- Immuntoleranz:
- Molekulare Mimikry: Erregerbestandteile weisen Ähnlichkeiten auf mit körpereigenen Oberflächenmolekülen, so dass der Körper diese als "eigen" wahrnimmt (Kreuztoleranz). Bsp.: Das M-Protein von Streptococcus pyogenes.
- Sehr früh im Leben stattfindende Infektionen können dazu führen, dass das Immunsystem die Antigene nicht mehr als fremd erkennt.
Aggressine und Moduline - Mechanismen der Erregerausbreitung und Krankheitserzeugung
Die Ausbreitung im Körper kann erfolgen durch die
- Produktion gewebsauflösender hydrolytischer Exotoxine (Exoenzyme) wie Kollagenasen, Elastasen, Hyaluronidasen und anderen Proteasen.
- Infektion von Zelle zu Zelle. Die Erreger induzieren die Aktinpolymerisation und lassen sich in die benachbarte Zelle schießen. Bsp.: Listerien und Shigellen.
- Generalisierte Ausbreitung: Erreger können in das Blut- oder Lymphystem eindringen und sich an ihre(n) bevorzugte(n) Absiedelungsort(e) transportieren lassen. Organotrope Erreger wie Mumps-Viren z.B. in die Drüsen, weniger wählerische wie Tuberkulose-Bakterien überall hin.
Die Schädigung des Makroorganismus kann bedingt sein durch die bereits genannten
- Exotoxine. Nach dem Schädigungsmuster unterscheidet man hydrolytische Exoenzyme, Zytotoxine (generelle Zellgifte), Enterotoxine (Bsp.: Durchfallerreger), Neurotoxine (Bsp.: Tetanustoxin), Membrantoxine wie z.B. porenbildende Proteine (Bsp.: Pseudomonas aeruginosa) oder Toxine mit Phospholipaseaktivität. Superantigene führen zur überschießenden Zytokinfreisetzung aus Makrophagen und T-Lymphzyten (Bsp.: Enterotoxine von Staphylococcus aureus). Toxine, die sich aus zwei Untereinheiten zusammensetzen, von denen die eine (B-Teil) für die Bindung an die spezifischen Rezeptoren der Zielzelle verantwortlich ist und die andere (A-Teil) für die Wirkung, nennt man AB-Toxine. Zu den AB-Toxinen gehört beispielsweise das Cholera-Toxin, das Pertussis-Toxin, das Diphtherie-Toxin und das E. coli-Enterotoxin.
- Direkte Zellschädigung - Intrazelluläre Bakterien wie Chlamydien und Rickettsien, Parasiten wie Plasmodien sowie lysogene Viren zerstören die Zelle, in der sie sich vermehren.
- Endotoxine wie z.B. die Lipopolysaccharide (LPS), die beim Zerfall Gram-negativer Bakterien frei werden, führen als Moduline zur Überstimulation des Immunsystems mit massiver Freisetzung von Zytokinen, was im distributiven/septischen Schock, DIC (disseminierter intravasaler Gerinnung) und MOV (Multi-Organ-Versagen) gipfeln kann.
- Die Entzündung (immunologische Reaktion) selbst führt zu Gewebsschäden.
Infektionstypen
Pathogene Krankheitserreger verfolgen verschiedene Infektionsstrategien, um die bestehenden ökologischen Nischen auszufüllen. Während anspruchslose Erreger wie Pseudomonas, Clostridium tetani und Aspergillus auch außerhalb ihrer Wirte gut überleben und sich vermehren können und den Menschen dann infizieren, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, müssen sich andere Erreger, die für ihre Vermehrung und ihr Überleben auf bestimmte Wirte angewiesen sind, etwas mehr einfallen lassen. Grob vereinfachend kann man dabei die „hit-and-run“ Strategie von der „infect-and-persist“ Strategie unterscheiden.[2] In vielen Fällen gibt es Zwischenstufen, oder ein Erreger hat mehrere Wirtsspezies und wendet bei diesen unterschiedliche Strategien an.
Hit & Run (Transiente Infektion)
Pathogene Mikroorganismen, die sich in ihrem Wirt nicht gut halten, aber auf diesen angewiesen sind, nutzen augenblickliche Schwächen in der immunologischen Abwehr der Population, um sich rasch zu vermehren und dann auf den nächsten Wirt überzuspringen. Der Erreger tötet dabei den Wirt und entzieht sich damit selbst seine Lebensgrundlage (Pocken, Pest, Tollwut, Ebola) und/oder wird nach kurzer Zeit von dessen Immunsystem eliminiert (Masern, Mumps, Röteln, Erkältungsviren, Hepatitis A). In beiden Fällen muß er sich rasch um eine neue Bleibe bemühen. Damit sich dieser Prozess nicht totläuft, verfügen viele Erreger über die Fähigkeit, ständig ihre antigenen Eigenschaften zu ändern und damit der Lernfähigkeit des Immunsystems höherentwickelter Tiere etwas entgegenzusetzen. Zudem werden in eine Population ständig neue Mitglieder hineingeboren, die noch nicht immunisiert sind. Erkrankungen durch transiente Infektionen verlaufen meist akut und selbstlimitierend.
Infect & Persist (Persistente Infektion)
Erreger, die es gelernt haben, sich in ihrem Wirt zu halten, haben einen geringeren Selektionsdruck und müssen daher in der Phase der Neuinfektion meist weniger aggressiv auftreten, das rasche Töten des Wirts wäre kontraproduktiv (bei Immunkomprommittierten können die Verläufe trotzdem sehr akut sein). Beispiele sind Lentiviren (HIV, HTLV), Herpes-Viren (HSV, EBV, CMV), Papovaviren (HPV, Polyomaviren) und Mykobakterien. Die Verläufe sind meist chronisch.
Die Persister-Strategie gilt in abgeschwächter Form natürlich auch für alle Bewohner der physiologischen Kolonisationsflora, die zwar meist nur siedeln und beim Gesunden keine Infektion hervorrufen, die sich allerdings trotzdem gegenüber der Wirtsabwehr behaupten müssen.
Epidemiologie
Die Epidemiologie (von griech. epi: auf/über, demos: Volk, logos: Lehre) ist die Wissenschaft von der Verbreitung und den Ursachen gesundheitsbezogener Zustände und Ereignisse in Populationen.
Grundbegriffe
- Prävalenz: Zahl der Erkrankten/Infizierten an einem bestimmten Stichtag (X pro 100.000 Gesunde zum Zeitpunkt Y).
- Inzidenz: Zahl der Neuerkrankungen/-infektionen (X pro 100.000 Gesunde und pro Jahr).
- Mortalität: Zahl der in einem bestimmten Zeitraum an einer Krankheit/Infektion Verstorbenen (X pro 100.000 Erkrankte pro Jahr). Dieser Begriff wird oft mit der Letalität verwechselt.
- Morbidität: Zahl der in einem bestimmten Zeitraum an einer bestimmten Krankheit leidenden Personen (X pro 100.000 Menschen pro Jahr).
- Letalität: Anteil der Erkrankten/Infizierten, die an diesem Leiden versterben in Prozent (X%).
Ein gehäuftes Auftreten einer Infektionskrankheit (=Infektion + Symptome) kann mit folgenden Begriffen näher beschrieben werden:
- Epidemie: Zeitlich und örtlich begrenztes Vorkommen. (Bsp.: Die Masernepidemie in NRW 2006.)
- Endemie: Zeitlich unbegrenztes, örtlich begrenztes Vorkommen. (Bsp.: FSME ist in Süddeutschland endemisch.)
- Pandemie: Zeitlich begrenztes, örtlich unbegrenztes Vorkommen. (Bsp.: Grippepandemien)
Infektionsquellen
Mögliche Infektionsquellen sind:
- Menschen (Anthroponosen)
- Tiere (Zoonosen) - Bsp.: FSME (Zecken), Toxoplasma gondii (Katzen), Salmonellen (Nutztiere)
- Umwelt:
- Erde - Bsp.: Clostridium tetani
- Wasser - Bsp.: Vibrio cholerae
Übertragungswege
Horizontale Übertragungswege sind:
- über direkten Kontakt:
- aerogen - Bsp.: Erkältungsviren, Influenza
- oral - Bsp.: Shigellen, Salmonellen
- mucokutan - Bsp.: Herpes simplex (Herpes labialis)
- sexuell - Bsp.: Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, HIV
- kutan - Bsp: Sarcoptes scabies, Infektionen über stechende Insekten
- über indirekten Kontakt:
- fäkal-oral - Bsp.: Pathogene Escherichia coli, Lebensmittelvergiftungen
- Schmier-Infektion - Bsp.: Wundinfektionen
Die vertikale Übertragung erfolgt
- diaplazentar - Bsp.: Röteln-Virus
Im Krankenhaus sind die Hände des Personals der wichtigste Übertragungsweg exogener, nosokomialer (d.h. im Krankenhaus erworbener) Infektionen.
Bekämpfung von Infektionen
Prophylaxe
Hygiene und Gesetze
Das Wort Hygiene stammt aus dem Griechischen (υγιεινή [τέχνη], hygieiné [téchne]) und bedeutet "der Gesundheit zuträgliche Kunst". Es leitet sich von der griechischen Göttin der Gesundheit, Hygéia, ab. Im engeren Sinn werden unter Hygiene die Maßnahmen zur Vorbeugung vor Infektionskrankheiten bezeichnet, insbesondere die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation.
Verhaltensregeln
Generell gilt: Die Vermeidung einer Kontamination ist besser als jede Keimreduktion.
Verhaltensregeln in der Patientenversorgung:
- Seifen- und Desinfektionsmittelspender sollten mit dem Ellenbogen bedient werden.
- Der Wasserhahn wird mit einem Einmalhandtuch zugedreht.
- Die Hände werden mit Einmalhandtüchern abgetrocknet.
- Nach Naseputzen, Toilettengang u.ä. sollten die Hände zumindest gewaschen werden.
- Spritzen, Kanülen etc. sofort in den Abwurf werfen, nicht zwischendeponieren.
Schutzkleidung
Bei Arbeiten mit potentiell infektiösem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen) sollten Handschuhe getragen werden. Bei sterilen Arbeiten (z.B. Wundversorgung, TUBK-Anlage) müssen sterile Handschuhe getragen werden, vorher sind die Hände zu desinfizieren. Bei isolierten Patienten und im OP-Bereich kommen Mundschutz, Häubchen, Schutzkittel und ggf. separate Schuhe dazu.
Reinigung
Reinigung ist die Beseitigung makroskopisch sichtbarer Verschmutzungen.
Desinfektion
Desinfektion ist die Keimreduktion auf ein nicht mehr infektionsfähiges Maß. Die Desinfektion kommt dort zur Anwendung, wo eine Sterilisation nicht möglich oder nicht notwendig ist.
- Die hygienische Händedesinfektion reduziert besonders die transiente Hautflora und ist die wichtigste Maßnahme zur Unterbrechung von Infektionsketten und Verhütung exogener nosokomialer Infektionen im Krankenhaus. Sporen werden allerdings meist nicht erfasst. Durchführung: In der Regel werden die Hände 30 s lang mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel (z.B. Desderman® N) desinfiziert. Wichtig ist die richtige Technik, um keine Stellen (z.B. häufig die Daumen) unbemerkt auszulassen.
- Chirurgische Händedesinfektion - Vor operativen Eingriffen ist eine besonders gründliche Desinfektion der Hände und Unterarme notwendig, um sowohl die transiente als auch die residente Flora ausreichend zu reduzieren. Die Hände werden einschließlich der Ellenbogen gründlich gewaschen, die Nagelfalze und Fingernägel mit einer sterilen, weichen Nagelbürste gereinigt. Der Seifenspender wird mit den Ellenbogen bedient. Danach werden die Hände, die Unterarme und die Ellenbogen in dieser Reihenfolge mit einem sterilen Handtuch abgetrocknet. Die Desinfektion erfolgt mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel für 3-5 Minuten je nach Herstellerangaben (Uhr stellen!). Beim Entnehmen der Desinfektionslösung aus dem Spender wird der Spenderbügel mit dem Ellenbogen bedient. Die Hände sollten sich immer über den Ellenbogen befinden, um ein Herunterlaufen von Flüssigkeit von den Ellenbogen zu den Händen zu verhindern. Nach der 3er-Regel sieht das folgendermaßen aus:
- 1. Minute: Die Lösung wird über die volle Länge von den Fingerspitzen bis zum Ellenbogen in die Haut eingerieben.
- 2. Minute: Es wird 1 Minute lang über die Handschuhlänge desinfiziert.
- 3. Minute: Es werden ausschließlich die Hände selbst eingerieben.
- Während der Desinfektion sollte der Arzt keine nicht-desinfizierten Hautbereiche oberhalb des Ellenbogengelenks oder Gegenstände berühren.
- Haut- und Schleimhautdesinfektion - Vor Injektionen, Operationen usw. müssen die entsprechenden Hautareale desinfiziert werden. Für Injektionen sind z.B. alkoholische Desinfektionsmittel üblich (z.B. Neo Kodan®, 15s), im OP-Bereich werden farbige Desinfektionsmittel verwendet, für die Desinfektion von Schleimhäuten, z.B. vor TUBK-Anlage oder Wunden werden spezielle Desinfektionsmittel verwendet, da normale Mittel hier sehr schmerzhaft sind (geeignet ist z.B. Octenisept®, 1 min).
- Die Flächendesinfektion (Arbeitsflächen, Patientenliegen, Nachttische usw.) erfolgt mit speziellen Flächendesinfektionsmitteln. Die Herstellerangaben zu Konzentrationen und Anwendungsdauer sind einzuhalten. Präparate sind z.B. Terralin® (0,5%, 60min)
- Instrumentendesinfektion - Instrumente werden nach Benutzung in eine spezielle Desinfektionslösung abgeworfen. Auch hier sind die Herstellerangaben zu Konzentrationen und Anwendungsdauer zu berücksichtigen. Präparate sind z.B. Lysetol® AF und Secusept®.
Desinfektionsmittel:
Desinfektionsmittel unterscheiden sich hinsichtlich ihrer chemischen Eigenschaften, Wirkspektrum, Einwirkzeiten, Hautverträglichkeit, Materialverträglichkeit, Gesundheitsgefahren usw. erheblich. Für die einzelnen Anwendungsgebiete werden daher unterschiedliche Substanzen bevorzugt.
| Desinfektionsmittel | Bakterien | Sporen | Pilze |
|---|---|---|---|
| Oxidationsmittel | bakterizid | sporozid | fungizid |
| Halogene ( Chlor, Iod) |
bakterizid | langsam sporozid | fungizid |
| Alkohole | bakterizid | wirkungslos | fungizid |
| Aldehyde | bakterizid | langsam sporozid | fungizid |
| Phenole | bakterizid / bakteriostatisch | wirkungslos | fungizid |
| Ethylenoxid | bakterizid | wirkungslos | fungizid |
| Detergenzien | bakterizid (variabel) | wirkungslos | fungistatisch |
| Chlorhexidin | bakteriostatisch | wirkungslos | fungistatisch |
| Desinfektionsmittel | Viren | Anwendung |
|---|---|---|
| Oxidationsmittel | viruzid | Haut, Schleimhaut, Oberflächen, Instrumente |
| Halogene ( Chlor, Iod) |
viruzid | Chlor: Oberflächen, Wasser Iod: Haut, Schleimhaut |
| Alkohole | viruzid | Haut, Schleimhaut, Oberflächen, Instrumente |
| Aldehyde | viruzid | Oberflächen, Instrumente |
| Phenole | viruzid (variabel) | Haut, Schleimhaut, Oberflächen, Instrumente |
| Ethylenoxid | viruzid | Oberflächen, Instrumente, thermostabile Arzneimittel, Lebensmittel |
| Detergenzien | wirkungslos | Haut, Schleimhaut |
| Chlorhexidin | virustatisch | Haut, Schleimhaut |
Sterilisation
Bei der Sterilisation (auch: Sterilisierung) eines Produktes, einer Produktverpackung (z.B. Lebensmittel, Pharmazeutika), eines Gerätes (z.B. Endoskop) oder einer Lösung werden (im Idealfall) alle enthaltenen Mikroorganismen und deren Sporen abgetötet sowie Viren, Plasmide und andere DNA-Fragmente zerstört. In der technischen Abgrenzung zur Desinfektion wird bei der Sterilisation um eine Größenordnung höher abgetötet/ inaktiviert. Es muss also auf höchstens 10-6 Kolonien bildende Einheiten reduziert werden, das heißt: Von einer Million Keimen überlebt maximal einer. Sterilisationsverfahren:
Fraktionierte Sterilisation
Die fraktionierte Sterilisation wird auch Tyndallisierung genannt: die zu sterilisierenden Geräte werden an mehreren aufeinander folgenden Tagen mehrfach erhitzt, dazwischen werden sie zur Sporenauskeimung bebrütet.
Heißdampf-Sterilisation
Dampfsterilisation wird auch Autoklavieren genannt. Sie ist das Standardverfahren in den meisten Labors bzw. Krankenhäusern und bedeutet eine Erhitzung auf 121 bis 134 °C bei 2 bar für 15-20 Minuten, beispielsweise in einem Autoklav. Siehe auch Sterilisator. [Bearbeiten]
Heißluftsterilisation (Trockene Hitze)
- Das Ausglühen von metallischen Gegenständen durch Rotglut, etwa 500 °C, ist gebräuchlich bei mikrobiologischen Arbeiten.
- Das Abflammen (Flambieren) ist ein kurzes Ziehen des Gegenstandes durch eine Flamme.
- Heißluftsterilisation für Glas, Metalle, Porzellan ("backen"), bei
- 180 °C mindestens 30 Min.
- 170 °C mindestens 60 Min.
- 160 °C mindestens 120 Min.
Geräte, die hierfür benutzt werden, heißen
- Heißluft-Sterilisationsschrank
- Heißluft-Sterilisationstunnel
- konventionelle Heizung, 240-320 °C
- eingedüste Heißluft, 300-400 °C
- Laminar-Flow-Heißluft
Nassaseptik
Die Abtötung der Mikroorganismen erfolgt durch Chemikalien, welche in flüssiger Form auf die zu sterilisierenden Gegenstände aufgebracht werden. In der Getränketechnologie sind zum Beispiel Verfahren im Einsatz, welche mit Wasserstoffperoxid bzw. Peressigsäure funktionieren. Ein kritischer Parameter bei allen nassaseptischen Verfahren ist die Temperatur der sterilisierenden Lösung. In der Regel kann über höhere Temperatur die zur Sterilisation nötige Einwirkzeit drastisch verkürzt werden. Um die Chemikalien vom sterilisierten Objekt zu entfernen, wird typischerweise anschließend ein Waschvorgang mit sterilem Wasser vorgenommen.
Trockenaseptik
Nicht sehr scharf definierter Begriff für eine Gruppe von Sterilisationsverfahren in der kaltaseptischen Abfüllung von Lebensmitteln, insbesondere Getränken: Im Gegensatz zur Nassaseptik, bei der die zu sterilisierenden Objekte, meist Kunststoffflaschen aus PET oder HDPE, vor ihrer Befüllung mit keimabtötenden Chemikalien, wie insbesondere Peressigsäureprodukten, ausgewaschen werden, erfolgt die Keimabtötung bei der Trockenaseptik vorzugsweise mittels gasförmig zugeführtem Wasserstoffperoxid. Die zu sterilisierenden Oberflächen sind, im Gegensatz zur Nassaseptik, nach der Sterilisation trocken, was einen erheblichen Vorteil darstellt. Apparativer Aufwand und Betriebskosten sind bei Trockenaseptik in der Regel geringer als bei Nassaseptik. Jedoch sind die Verfahren technologisch schwieriger zu beherrschen und erfordern deutlich mehr Know-How.
Siehe hierzu beispielsweise bei Dry Sterilisation Process ein trockenaseptisches Sterilisationsverfahren, das selbst an extrem resistenten Endosporen Keimreduktionen von weit über 106 in Sekundenbruchteilen realisiert, jedoch unter Vakuumbedingungen abläuft.
Strahlensterilisation
Sterilisation mit ionisierender Strahlung: entweder mit UV-Licht, Elektronenbeschuss, Röntgen- oder Gammastrahlung.
Plasmasterilisation
Die sterilisierende Wirkung von Plasmen ist wissenschaftlich in einer Vielzahl von Untersuchungen prinzipiell nachgewiesen. Dies gilt für Niederdruckentladungen angeregt durch Hochfrequenz oder Mikrowelle bis hin zu Normaldruckentladungen. Die sterilisierende Wirkung ist dabei einerseits auf die im Plasma generierte UV-Strahlung, andererseits auf die Bildung chemisch aggressiver Substanzen (freie Radikale) sowie den Beschuss der Mikrooganismen mit Ionen zurückzuführen. Trotz der prinzipiellen Eignung sind in der industriellen Realität Plasmaverfahren kaum verbreitet.
Entsprechende kommerzielle Systeme, die zur Sterilisation von medizinischen Gerätschaften eingesetzt werden und Plasmageneratoren enthalten, verwenden als Reagenz dampfförmiges Wasserstoffperoxid, so dass die Sterilisationswirkung in nennenswertem Umfang auf eine Gasphasensterilisation zurückgeht.
Gassterilisation
Gassterilisation erfolgt beispielsweise mit Formaldehyd, Ethylenoxid, Ozon oder Wasserstoffperoxid.
Sterilfiltration
Sterilfiltration ist Sterilisierung mittels einer Membran (Porenweite 0,22 µm). Nur kleine Moleküle können die Membran passieren, größere Partikel wie zum Beispiel Bakterienzellen werden zurückgehalten. Bakterien der Gattung Mycoplasma passieren allerdings die Membran aufgrund fehlender Zellwand. Sterilfiltration wird oftmals zur Sterilisierung hitzeempfindlicher Lösungen, beispielsweise serumhaltiger Gewebekulturlösungen, eingesetzt. Hauptanwendungen sind die Sterilfiltration von wässrigen Lösungen, hitzeempfindlichen Nährlösungen, Vitaminlösungen, Seren, Virusimpfstoffen, Plasmafraktionen und Proteinen. Nach erfolgter Sterilfiltraion ist nach europäischem Arzneibuch die Qualität des Filters mit Hilfe des Bubble-Point-Testes durchzuführen.
Zur Entfernung von Endotoxinen werden Aktivkohlefilter vor der Sterilfiltration verwendet. Um zu verhindern, das Pyrogene in das Produkt gelangen, wird eine vorherige Tiefenfiltration (z.B. mit einem Schichtenfilter) empfohlen.
Krankenhaushygiene
Nosokomiale Infektionen (von griech. nosokomeion 'Krankenhaus') sind Infektionen, die im Rahmen eines Aufenthaltes im Krankenhaus oder einer anderen medizinischen Einrichtung erworben werden, auftreten oder sich in Inkubation befinden (engl.: hospital-acquired infections). Sie spielen sowohl für die Gesundheit des Einzelnen als auch gesundheitsökonomisch eine große Rolle.
Die häufigsten Infektionen sind Pneumonien, Harnwegsinfektionen, Sepsis und Wundinfektionen.
Die Erreger stammen häufig aus der Standortflora des Patienten und führen auch bei optimaler Hygiene zu endogenen Infektionen. Das Risiko endogener Infektionen durch iatrogene Keimverschleppung z.B. beim Absaugen, beim Katheterisieren der Harnblase, bei der Wundversorgung etc. lässt sich durch steriles Arbeiten verringern. Das Risiko exogener Infektionen lässt sich durch eine konsequente Hygiene reduzieren, hier hat insbesondere die Händehygiene des Personals eine herausragende Bedeutung.
Häufige Erreger nosokomialer Infektionen[3]:
- Nosokomiale Pneumonie auf Intensivstationen: Staphylococcus aureus 18%, Pseudomonas aeruginosa 12%, Klebsiellen 9%
- Katheterassoziierte Sepsis: Koagulase negative Staphylokokken (CONS) 29%, Staphylococcus aureus 18%, Enterokokken 11%
- Nosokomiale Harnwegsinfektionen: Escherichia coli 24%, Enterokokken 22%, Pseudomoas aeruginosa 11%
- Wundinfektionen: Staphylococcus aureus 31%, Escherichia coli 14%, Enterokokken 12%
Problematisch ist insbesondere das verstärkte Auftreten von Multiresistenzen. In Deutschland sind bereits 15% der isolierten S. aureus-Stämme multiresistent.
Weblinks:
Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Das deutsche Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt seit dem 1. Januar 2001 die Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen.
Weblinks:
Meldepflichtige Krankheiten
Nach § 6 Meldepflichtige Krankheiten des IfSG sind
(1) Namentlich zu melden:
1. der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an a) Botulismus, b) Cholera, c) Diphtherie, d) humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer Formen, e) akuter Virushepatitis, f) enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS), g) virusbedingtem hämorrhagischen Fieber, h) Masern, i) Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis, j) Milzbrand, k) Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer wenn traumatisch bedingt), l) Pest, m) Tollwut, n) Typhus abdominalis/Paratyphus sowie die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch wenn ein bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt,
2. der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung oder an einer akuten infektiösen Gastroenteritis, wenn a) eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 ausübt, b) zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird,
3. der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung,
4. die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder -ansteckungsverdächtiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers,
5. soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, das Auftreten
a) einer bedrohlichen Krankheit oder
b) von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, wenn dies auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist und Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen, die nicht in § 7 genannt sind.
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 8, § 9 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder 3 oder Abs. 4 zu erfolgen.
(2) Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 hinaus mitzuteilen, wenn Personen, die an einer behandlungsbedürftigen Lungentuberkulose leiden, eine Behandlung verweigern oder abbrechen. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.
(3) Dem Gesundheitsamt ist unverzüglich das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, als Ausbruch nichtnamentlich zu melden. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5, § 10 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 und 4 Satz 3 zu erfolgen.
Weblinks:
Trinkwasserverordnung
Siehe: Trinkwasserverordnung
Lebensmittelsicherheit
Siehe: Lebensmittelhygiene
Innenraumhygiene
Zur Innenraumhygiene gehören z.B. alle Maßnahmen, die die Belastung der Atemluft vermindern. Dazu zählt z.B. die Prophylaxe von Schimmelbildung durch richtiges Lüften, bauliche Maßnahmen usw.
Dispositionsprophylaxe
Zur Dispositionsprophylaxe zählen die aktive Immunisierung, die passive Immunisierung und die Chemoprophylaxe.
Aktive Immunisierung

Die aktive Impfung mit Lebend- oder Totimpfstoffen ist die häufigere, sicherste und kostengünstigste Form der Impfung.
Lebendimpfstoffe enthalten abgeschwächte Erreger, die sich im Wirt vermehren müssen, um eine adaequate Immunstimulation hervorzurufen. Sie können daher frühestens 9 Monate nach Geburt verabfolgt werden, da sie vorher von persistierenden mütterlichen Antikörpern (Nestschutz) oft vorzeitig eliminiert werden. Nicht geimpfte Kinder stellen in dieser Phase eine Infektionsquelle für die nur partiell geschützten Säuglinge dar (z.B. im Wartezimmer beim Kinderarzt).
Totimpfstoffe enthalten abgetötete Erreger oder Bruchstücke davon. Es gibt auch Toxoidimpfstoffe, die nur das biologisch inaktive Toxin (Toxoid) eines Erregers enthalten (z.B. das Tetanus-Toxoid), sie werden ebenfalls zu den Totimpfstoffen gezählt.
Bei der aktiven Impfung hat das Immunsystem die Chance, die Antigene des Erregers kennenzulernen und eine entsprechende Immunität aufzubauen, ohne dabei die Erkrankung selbst zu durchlaufen. Die antigen wirksamen Proteine bzw. Glykopeptide werden als körperfremd erkannt und führen zur klonalen Expansion reaktiver T- und B-Lymphozyten. Letztere differenzieren sich zu antikörperbildenden Plasmazellen. Die Induktion der primären spezifischen Immunantwort nimmt etwa 14 Tage in Anspruch. Einige T- und B-Lymphozyten differenzieren sich nach der primären Immunantwort zu langlebigen B- und T-Gedächtniszellen, die einen langfristigen Impfschutz gewährleisten.
Kommt der Körper erneut mit dem Erreger in Kontakt, so kann durch die Gedächtniszellen eine sehr viel schnellere und effizientere Immunantwort in die Wege geleitet werden, so dass der Erreger rasch eliminiert wird und die Erkrankung sich nur in abgeschwächter Form oder gar nicht mehr manifestiert.
Weblinks:
Passive Immunisierung
Eingeführt wurde die passive Impfung 1890 von Emil von Behring, als er ein Heilverfahren gegen Diphtherie entwickelte. Bei der passiven Impfung wird der Antikörper direkt appliziert. Das hat den Vorteil, dass der Organismus nicht erst selbst die Immunglobuline bilden muss und ein sofortiger Impfschutz zur Verfügung steht, der jedoch nur nur wenige Wochen bis Monate anhält.
Die passive Impfung ist daher nur eine Notfallmaßnahme bei fehlender oder ungewisser Immunität, falls schon ein Kontakt mit dem Erreger stattgefunden hat (Postexpositionsprophylaxe). Beispielsweise wird man Patienten mit unklarem Impfstatus und einer verunreinigten Wunde sowohl eine aktive als auch eine passive Impfung gegen Tetanus empfehlen, um eine Infektion sicher auszuschließen. Gleiches gilt für die Tollwut bei Hundebissen.
Die Antikörper werden in der Regel aus bis zu 20.000 gepoolten Blutkonserven extrahiert. Das birgt eine gewisse Gefahr für die Übertragung von Krankheiten, insbesondere solcher, dessen Übertragungsmodus nicht bekannt ist (z.B. BSE). Auch bekannte Krankheiten (HIV) könnten bei unsachgemäßer Bearbeitung übertragen werden. Neuerdings gibt es auch passive Impfstoffe, bei denen die Antikörper auf gentechnologischem Weg speziell auf einen bestimmten Erreger zugeschnitten in Reinform hergestellt werden (monoklonale Antikörper). Ein Beispiel ist die passive Impfung gegen das Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) bei gefährdeten Frühgeborenen mit Lungenerkrankungen.
Auch das Gegengift bei Schlangenbissen beruht in der Regel auf dem Prinzip einer passiven Impfung. Dieses sogenannte Antivenin wird hergestellt, indem kleine Mengen des Toxins Pferden, Schafen, Ziegen oder Kaninchen injiziert werden. Die Tiere bilden daraufhin spezifische Antikörper, welche aus dem Blut extrahiert werden können.
Die passive Impfung ist aufgrund der Herstellungskosten verglichen mit der aktiven Imfung um ein Vielfaches teuerer.
In ähnlicher Weise wie bei einer passiven Impfung sind Neugeborene befristet gegen einige Infektionskrankheiten geschützt. Unmittelbar nach der Geburt wirken noch IgG-Antikörper, die das Kind über die Plazenta erhalten hat. Diese Leihimmunität der Neugeborenen lässt im Laufe der ersten Monate nach der Geburt allmählich nach. Säuglinge bekommen zusätzlich IgA über die Muttermilch, das vor allem gegen Magen-Darm-Erkrankungen schützt. Die allgemein und in Deutschland insbesondere durch die Ständige Impfkommission (STIKO) empfohlenen Kinder-Impfungen sollten daher so erfolgen, dass möglichst keine Lücke in der Erreger-Abwehr entsteht.
Expositionsprophylaxe
Eine Isolierung kann in der Medizin eine Maßnahme sein, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern.
Quarantäne
Die Quarantäne (ital. quaranta giorni „vierzig Tage“) ist eine vorübergehende Isolierung zur Verhinderung der Ausbreitung von infektiösen Krankheiten, zum Beispiel zwischen Menschen oder Tieren. Die Quarantäne ist eine sehr aufwendige, aber auch sehr wirksame seuchenhygienische Maßnahme, die insbesondere bei hochansteckenden Krankheiten mit hoher Sterblichkeit angewendet werden muss. In Anlehnung an diese Analogie wird der Begriff auch in der IT-Branche verwendet, um Schadsoftware (wie etwa Trojaner-, Viren- und Wurmprogramme) in einem extra geschützten Bereich aufzubewahren.
Geschichte: Um ihre Stadt vor Pestepidemien zu schützen, beschloss im Juli 1377 die Regierung der Republik Dubrovnik, dass sich vor dem Betreten der Stadt alle ankommenden Reisenden und Kaufleute vierzig Tage lang isoliert in eigens dafür errichteten Lazaretten aufhalten müssen.
1383 wurde zum ersten Mal in Marseille die Quarantäne über ankommende Schiffe verhängt, um sich auch vor der Pest zu schützen, die damals in Europa wütete. Eine andere Quelle spricht davon, dass Beamte aus Venedig 1374 die Quarantäne einführten. Besatzung und Waren wurden zunächst auf einer Hafeninsel isoliert und durften erst nach dreißig, später nach vierzig Tagen an Land.
Quarantänemaßnahmen haben 1918 Australien vor dem Übertritt der Spanischen Grippe geschützt.
Bei Pockenausbrüchen wurden in der BRD noch in den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts drastische Isolierungsmaßnahmen ergriffen. Die betroffenen Personen wurden teilweise ohne ärztliche Versorgung in Schullandheimen isoliert und mussten sich selbst versorgen.
Laut Duden wurde der Begriff Quarantäne im 17. Jahrhundert aus dem Französischen entlehnt – „(une) quarantaine“ ist das franz. Zahlwort für eine Menge von vierzig Dingen. Dementsprechend heißt „vierzig Tage“ im Französischen „une quarantaine de jours“.
Schutz von Immungeschwächten
Zum anderen ist eine Isolierung bei Patienten erforderlich, die aus unterschiedlichen Gründen ein schwaches Immunsystem haben. Dabei geht es um den Schutz dieser Patienten.
Eine solche Immunsuppression tritt auf, wenn wegen einer Krebserkrankung eine Chemotherapie durchgeführt wurde. Das gilt besonders bei Leukämie, wenn eine Knochenmarktransplantation durchgeführt werden muss. Die Notwendigkeit einer Isolation wird im Zweifelsfall von der Zahl der Leukozyten im Blut abhängig gemacht.
Bei Aids werden die Betroffenen auch mehr und mehr infektanfällig. Hier kann man die Gefährdung an der Zahl der CD4-Lymphozyten ablesen.
Vorgehen: Bei mäßig gefährdeten Patienten betritt das Krankenhauspersonal das Zimmer nur mit Mundschutz und einem eigens übergestreiften frischen Kittel, der dann wieder gewaschen wird. Manche Tumorpatienten dürfen auch zu Hause zeitweise keinen Besuch empfangen.
Auf Leukämiestationen leben Patienten oft wochenlang in luftdichten Kammern, sie werden über zwei Löcher in der Wand gepflegt, an denen Handschuhe befestigt sind.
Antimikrobielle Therapie
Siehe dazu die Kapitel Virostatika, Antibiotika und Antimykotika im Buch Pharmakologie und Toxikologie.
- ↑ Savolainen S et al. “The bacterial flora of the nasal cavity in healthy young men”. Rhinology, 24(4):249-55, Dec 1986. PMID:3547601
- ↑ http://www.bvd-info.ch/tierarzte/infektionstypen.html
- ↑ http://www.rki.de/cln_006/DE/Content/GBE/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/.../nosokomiale_infektionen.pdf
Einleitung
Das Immunsystem (von lat.: immunis = frei, verschont, unberührt) ist ein komplexes System des Körpers zur Abwehr von Mikroorganismen und Vernichtung fehlerhafter Zellen, um so Gefahren für den Körper abzuwenden. Neben einem angeborenen Immunsystem, welches eine unspezifische Abwehr gegen Schadfaktoren darstellt, gibt es ein erworbenes Immunsystem (auch adaptives Immunsystem genannt), welches spezifische Mechanismen der Abwehr zur Verfügung stellt. In vivo arbeiten beide Systeme Hand in Hand und ergänzen sich gegenseitig.
Lebewesen müssen sich ständig mit Einflüssen aus der belebten Umwelt auseinandersetzen, einige davon stellen eine Bedrohung für die körperliche Unversehrtheit dar. In den Körper eindringende Mikroorganismen können zu Funktionsstörungen, Krankheiten und Tod führen. Typische Krankheitserreger sind Bakterien, Viren und pathogene Pilze, sowie ein- und mehrzellige Parasiten (z.B. Protozoen wie Plasmodien oder Bandwürmer).
Auch Veränderungen im Inneren des Körpers können die Existenz bedrohen: Wenn mutierte, dysplastische Körperzellen der Apoptose entgehen, können sie der Ausgangspunkt von Krebserkrankungen werden.
Ob nach einer Infektion eine Erkrankung auftritt, hängt vom komplexen Wechselspiel des Immunsystems mit dem (ungebetenen) Gast ab. Eine Rolle spielen etwa die Menge der eingebrachten Erreger und deren krankmachenden Eigenschaften (Virulenz), sowie der Zustand des Immunsystems der betroffenen Person - So kann durch vorherigen Kontakt mit dem Erreger bereits eine Immunität bestehen, die Erregerdosis oder -virulenz für einen Krankheitsausbruch zu gering sein oder der Kampf zwischen Immunsystem und Infektionserreger schlägt keine großen Wellen [inapparente/subklinische Infektion oder stille Feiung (Immunisierung ohne Impfung oder Erkrankung)]. Bei intaktem Immunsystem und geringer Erregerdosis kann also eine Erkrankung wie beispielsweise eine Erkältung entweder überhaupt nicht ausbrechen oder einen weniger schweren Verlauf nehmen. In der Tat versuchen tagtäglich tausende von Organismen in der Körper einzudringen, die vom Immunsystem daran gehindert werden.
Die wichtigste Fähigkeit des Immunsystems besteht darin "Eigen" und "Fremd" (inklusive Krankheitserreger und Krebszellen) zu unterscheiden und Fremdes zu bekämpfen. Dafür steht dem Körper ein höchst effektives System zur Verfügung, an dem viele Arten von Zellen und biochemischen Molekülen beteiligt sind.
Lymphatische Organe
Das Knochenmark

Die Blutbildung in der ersten Embryonalperiode findet im Dottersack statt und wird dann zunehmend in die Leber und Milz verlagert (Fetalperiode). Das rote Knochenmark ist nach dem 3. Lebensmonat der alleinige Ort der Blutbildung (Hämatopoese). Aus den Knochenmarksstammzellen gehen alle Blutzellen (Leukozyten, Erythrozyten, Thrombozyten) hervor.
Das Lymphsystem
Zum Lymphsystem gehören vor allem die Lymphknoten und Lymphbahnen. Die meisten Abwehrzellen zirkulieren regelmäßig zwischen dem Blutkreislauf und dem Lymphsystem, welches am linken und rechten Angulus venosus mit der Vena jugularis interna in die Vena subclavia einmündet. In den Lymphknoten findet der wichtige Prozess der Antigenpräsentation und der klonalen Expansion statt. Die Antigene werden aus dem Gewebe über die blind beginnenden Lymphgefäße in die Lymphknoten transportiert. Weitere Aufgaben des Lymphsystem sind der Abtransport von interstitieller Flüssigkeit, die nicht in den venösen Kapillarschenkel zurück diffundiert (ca. 2l pro Tag) sowie der Abtransport von Nahrungslipiden und fettlöslichen Vitaminen (Chylomikronen) aus dem Darmtrakt.
Die Milz
Die Milz gehört beim Erwachsenen zu den sekundären Immunorganen. Das retikuloendotheliale System aus Phagozyten filtert in den den Milzsinus defekte Erythrozyten (Blutmauserung) und (besonders bekapselte) Krankheitserreger heraus und baut diese ab.
Wird die Milz entfernt, so sind Impfungen gegen Pneumokokken und Haemophilus influenzae B dringend anzuraten.
Gaumen- und Rachenmandeln
Die Gaumenmandeln (Tonsillae phyrengeae), Rachenmandel (Tonsilla palatina) und Zungenmandel (Tonsilla lingualis) gehören ebenfalls zu den lymphatischen Geweben und bilden zusammen mit den zahlreichen Lymphfollikeln der Rachenhinterwand den Waldeyer Rachenring. Dieser ist vor allem für die Abwehr von Krankheitserregern zuständig, die über Mund und Nase aufgenommen werden.
Der Thymus
Der Thymus sitzt retrosternal dem Herzbeutel auf. Er ist bei Säuglingen und Kleinkindern im Verhältnis viel größer als bei Erwachsenen und dient der Entwicklung und Reifung von T-Lymphozyten. Gemeinsam mit dem Knochenmark zählt der Thymus zu den primären lymphatischen Organen.
Disseminiertes lymphatisches System
In praktisch jedem Organ finden sich mehr oder weniger lokalisiert Abwehrzellen, die sich meist von Makrophagen (Monozyten-Makrophagen-System, MMS) ableiten. Hierzu gehören z.B. die "Kupffer'schen Sternzellen" der Leber.
Haut- und Schleimhaut-assoziierte Lymphgewebe
Besonders ausgeprägt ist eine Ansammlung von Lymphgeweben im Bereich der inneren (mucosa-associated-lymphatic-tissue, MALT) und äußeren Körperoberflächen, wo sich Innen- und Außenwelt treffen (Magendarmtrakt, Atemwege usw. zählen dabei zur Außenwelt). Dazu gehört das gut-associated-lymphatic-tissue (GALT) des Dünndarms, das sich weiter distal im Ileum zu den "Peyer'schen Plaques" gruppiert. Auch der Appendix gehört dazu. Weitere Beispiele sind das bronchus- (BALT) und das skin- (SALT) associated lymphoid tissue.
Das Blut
Auch das Blut mit den zirkulierenden Immunozyten, Antikörpern und dem Komplementsystem kann dem Immunsystem zugeordnet werden.
Leukozyten - Die zellulären Bestandteile des Immunsystem

Leukozyten bilden das Gros der zellulären spezifischen (T-Lymphozyten), der unspezifischen (Granulozyten, Makrophagen), sowie der humoralen spezifischen Abwehr (Immunglobulin-bildende B-Zellen). Daneben sollen auch Thrombozyten eine geringe immunologische Aktivität entfalten.
Eigenschaften: Leukozyten verfügen je nach ihrer Art über unterschiedliche Gestalt und verschiedenen Aufbau. Die Größe der Leukozyten schwankt zwischen 7µm bei Lymphozyten und 20µm bei Monozyten. Im Ggs. zu Erythrozyten und Thrombozyten enthalten sie einen Zellkern. Die Lebensdauer reicht von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten. Leukozyten sind amöboid beweglich und können aktiv aus dem Blut in die verschiedenen Gewebe einwandern.
Bildung: Die Leukopoese findet beim Erwachsenen vorwiegend im roten Knochenmark der platten Knochen (Brustbein und dem Becken), bei Kindern auch in den Epiphysen langer Röhrenknochen statt. Ursprung aller Blutzellen sind die pluripotenten Knochenmarksstammzellen. Bei ihrer Teilung entstehen keine identischen Tochterzellen, sondern jeweils eine neue pluripotente Stammzelle und eine determinierte Stammzelle (Vorläuferzelle einer Blutzellreihe), welche anschließend weiter heranreift. Leukozyten differenzieren sich über zahlreiche Zwischenstufen zu den mehr oder weniger fertigen Zellen. Die endgültige Prägung der Lymphozyten erfolgt im lymphatischen System. Gesteuert wird die Leukopoese durch zahlreiche Zytokine, z.B. verschiedene colony stimulating factors (CSF), die z.T. auch therapeutisch verabreicht werden können.
Funktionen: Die einzelnen Untergruppen der Leukozyten übernehmen verschiedene Aufgaben innerhalb des Immunsystems von der Phagozytose, über die Markierung von Antigenen bis zur Bekämpfung von körpereigenen und körperfremden Zellen und Krebszellen. Neutrophile Granulozyten und Makrophagen zum Beispiel sind als Bestandteil der unspezifischen Abwehr zur Phagozytose fähig. Dabei nehmen sie Fremdmaterial auf und machen es mit Hilfe lysosomaler Enzyme unschädlich. B-Lymphozyten produzieren nach geeigneter Stimulation speziell gegen bestimmte Erreger oder schädigende Stoffe gerichtete Antikörper. Sie gehören somit zur spezifischen Abwehr. T-Lymphozyten dienen unter anderem der Koordination zwischen spezifischer und unspezifischer Abwehr. Auch an Entzündungen sind Leukozyten immer beteiligt, die sie durch Mediatoren wie Zytokine und Leukotriene aufrecht halten, modulieren oder beenden. Leukozyten spielen ausserdem eine wesentliche Rolle bei allen Autoimmunkrankheiten.
Morphologie der Leukozyten: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die unterschiedlichen Leukozytenarten zu kategorisieren. Beispielsweise nach Bau und Zugehörigkeit. Hier einige Beispiele:
- Die oberflächlichste Einteilung wäre die Unterteilung in Granulozyten und Agranulozyten:
| Granulozyten | Agranulozyten |
|---|---|
| haben unregelmäßig gelappte Zellkerne und kleine Partikel im Cytoplasma |
besitzen rundliche oder bohnenförmige Zellkerne und keine Partikel im Zytoplasma |
| - Granulozyten | - Monozyten - Dendritische Zellen - Mastzellen - Lymphozyten |
- Aufgrund ihrer Abstammung und Farbe in der Pappenheim-Färbung können sie wie folgt unterschieden werden. Alle Zellen der lymphatischen Reihe gehen auf lymphatische Vorläuferzellen zurück, die der myeloiden Reihe entwickeln sich aus myeloiden Vorläuferzellen.
| lymphatische Reihe | myeloide Reihe |
|---|---|
| Lymphozyten | Monozyten Dendritische Zellen Mastzellen Granulozyten |
- Lymphozyten und Granulozyten werden in weitere Zelltypen unterteilt:
| Lymphozyten | Granulozyten |
|---|---|
| B-Lymphozyten T-Lymphozyten NK-Zellen |
- Neutrophile Granulozyten - Eosinophile Granulozyten - Basophile Granulozyten |
Durch die Bestimmung der charakteristischen Expressionsmuster an CD-Oberflächenmolekülen (cluster of differentiation) und der Enzymaustattung können alle Leukozyten (und entsprechend differenzierte Tumorzellen) in die hämatopoetische Reihe eingeordnet werden. Bsp.:
- Stammzelle: CD 34
- Myeloische Zellinie:
- Myeloische Vorstufen: CD 13, CD 33, CD 34, CD 41
- Granulozyten und Vorstufen (Blasten):
- MPO (Myeloperoxidase)
- CAE (Chlorazetatesterase) - Granulozyten vom frühen Promyelocyten bis zum reifen Neutrophilen:
- Monozyten und Megakaryozyten in allen Stadien: ANAE (alpha-Naphtylacetatesterase)
- Makrophagen: CD68
- Lymphozytenlinie:
- T-Zelle: CD 3, CD 5
- CD 4 - T-Helferzellen
- CD 8 - Zytotoxische T-Zellen
- B-Zelle:
- CD 10 - mittleres Reifestadien der B-Lymphozyten
- CD 19 - alle B-Zellen
- CD 20 - frühe B-Zellen
- CD 23 - B-Lymphozyten, dendritische Zellen
- CD 79a
- T-Zelle: CD 3, CD 5
- Myeloische Zellinie:
Funktionen der einzelnen Leukozyten im Überblick
| Immunzellen | Aufgabe und Funktion |
|---|---|
| Monozyten | Vorläufer der Makrophagen |
| Makrophagen | Phagozytose |
| Mastzellen | Freisetzung von Histamin |
| Antigenpräsentierende Zellen (z. B. Makrophagen, B-Zellen und Langerhanszellen) |
APZ phagozytieren Fremdantigen, zerlegen es in Oligopeptide und präsentieren es über MHC-II-Moleküle z.B. an T-Lymphozyten und leiten damit die Immunantwort ein. |
| Granulozyten | |
| Neutrophile Granulozyten | Phagozytose (Eiterbildung) |
| Eosinophile Granulozyten | Abwehr von Parasiten, allergische Reaktionen |
| Basophile Granulozyten | Abwehr von Parasiten, Auslösen allergischer Reaktionen, Entzündungsreaktionen |
| B-Zell-Gruppe | |
| B-Lymphozyten | Vorläufer der Plasmazellen im Blut |
| Plasmazellen | Antikörperproduktion |
| B-Gedächtniszellen | Langlebige B-Zellen mit einem Gedächtnis für spezielle Antigene |
| T-Zell-Gruppe | |
| T-Helferzellen | Aktivieren Plasmazellen und Killerzellen Erkennen Antigene auf den APZ |
| T-Supressorzellen | Bremsen die Immunantwort, hemmen die Funktion der B-Zellen und anderer T- Zellen |
| T-Gedächtniszellen | Langlebige T-Zellen mit einem Gedächtnis für spezielle Antigene |
| T-Killerzellen (zytotoxische T-Zellen) | Erkennen und zerstören von Viren befallene Körperzellen und Tumorzellen indem sie auf bestimmte Antigene der befallenen Zellen reagieren |
| Killerzellen | |
| Natürliche Killerzellen (NK) | Greifen unspezifisch virenbefallene und Tumorzellen an |
Bindung der Leukozyten an die Blutgefäße: Kommt es in einem Gewebe zum erregereintritt und zur Entzündung so produzieren ortsständige Immunzellen Zytokine, die die Endothelzellen der Blutgefäße dazu anregen, spezielle Adhäsionsmoleküle zu exprimieren. Die Leukozyten rollen normalerweise an den Endothlien entlang. Kommen sie mit solchen Signalstrukturen in Kontakt, werden sie aktiviert, heften sich an und beginnen zwischen den Endothelzellen hindurch in das Gewebe einzudringen (Leukodiapedese) um an den Ort der Entzündung zu gelangen. Im Rahmen der Entzündung zerstörte mikrobielle Bestandteile werden mit der Lymphe in die regionäen Lymphknoten abtransportiert und dort über MHC-II-Moleküle an Lymphozyten präsentiert. B-Lymphozyten erkennen dabei Antigene über membranständige Antikörper, T-Lymphozyten "tasten" mit speziellen T-Zell-Rezeptoren. Dabei kommt es zur Interaktion zwischen APZ, B-Zellen und T-Zellen wie den CD4-positiven T-Helferzellen. Die "scharf gemachten" Zellen der spezifischen Abwehr gelangen danach über das Lymphystem ins Blut und von dort wieder an den Ort der Entzündung.
Zahlen und Werte:
Normalwerte
| Normalwerte | alte Einheit | SI-Einheit |
|---|---|---|
| Erwachsene | 4.000 - 10.000/µl | 4 - 10 x 109/l |
| Schulkinder | 5.000 - 15.000/µl | 5 - 15 x 109/l |
| Kleinkinder | 6.000 - 17.500/µl | 6 - 17,5 x 109/l |
| Neugeborene | 9.000 - 30.000/µl | 9 - 30 x 109/l |
Zum Vergleich: Erythrozyten: ca. 4-5.000.000/µl (Auf siebenhundert rote Blutkörperchen kommt unter normalen Bedingungen etwa ein weißes Blutkörperchen), Thrombozyten: ca. 150.000-300.000/µl.
Prozentualer Anteil der Untergruppen an der Gesamtzahl der Leukozyten im Organismus (Differentialblutbild)
| Immunzellen | Anteil in % |
|---|---|
| Monozyten | 2 – 8 |
| Lymphozyten | 20 - 45 |
| Neutrophile Granulozyten segmentkernig | 50 - 70 |
| Neutrophile Granulozyten stabkernig | 3 - 5 |
| Eosinophile Granulozyten | 2 - 4 |
| Basophile Granulozyten | 0 - 1 |
Granulozyten
Granulozyten machen ca. 60% aller Leukozyten aus. Ihre Lebensdauer beträgt 2-3 Tage. Der Abbau der Granulozyten erfolgt im mononukleären Phagozytosesystem (MPS=MMP). Sie können die Blutbahn verlassen und ins Gewebe einwandern. Ihre Funktion liegt vor allem in der unspezifischen Abwehr (angeborenen Immunantwort) von Bakterien, Parasiten und Pilzen.
Es gibt neutrophile, basophile und eosinophile Granulozyten, die je nach Färbeverhalten des Protoplasma beschrieben und unterteilt werden. Sie haben jeweils unterschiedliche Funktionen (s.u.).
Das Monozyten-Makrophagen-System (MMS)
Monozyten sind mit einem Durchmesser von 12 - 25 μm die größten Zellen im Blut. Sie sind Bestandteil des Immunsystems und Vorläufer u. a. der Makrophagen.
Nach ihrer Entstehung im blutbildenden roten Knochenmark gelangen sie über das Blut in verschiedene Organe und wandeln sich dort je nach Gewebe in die entsprechenden Zellen des mononukleären Phagozytosesystems (MPS, = MMS (Monozyten-Makrophagen-System) = RES (Retikulo-Endotheliales System) = früherer Ausdruck RHS (Retikulo-Histiozytäres System) um. Dies sind:
- Makrophagen der meisten Gewebe
- Alveolarmakrophagen der Lunge
- Kupffer-Stern-Zellen der Leber
- Langerhans-Zellen der Haut
- Mikroglia des ZNS
- Osteo- und Chondroklasten von Knochen und Knorpel
- A-Synovialozyt der Gelenkkapsel
Die Aufgaben der Zellen des mononukleären Phagozytosesystems ist die Aufnahme (Phagozytose) von Fremdmaterial und Krankheitserregern sowie die Antigenpräsentation des prozessierten aufgenommenen Materials gegenüber T-Lymphozyten. Osteo- und Chondroklasten als Makrophagenabkömmlinge phagozytieren intaktes körpereigenes Material im Rahmen des normalen Knochenstoffwechsels bzw. der chondrogenen Ossifikation (Knochenbildung über eine Knorpelmatritze).
Etwa 8% der zirkulierenden Blutmonozyten entsprechen einem Phänotyp, der Makrophagen ähnelt. Er besitzt neben den Oberflächenantigenen CD14 und CD86 neu das CD16 Antigen, ein niedrig-affiner Fc-Gamma-III Rezeptor, der eng mit der Phagozytose in Verbindung steht.
Das CD14 Molekül ist das entscheidende Ziel-und Effektormolekül in der Erkennung von Bakterien und fungiert als sogenannter Endotoxinrezeptor. Endotoxine sind pathogener Bestandteil Gram-negativer Bakterien (z.B. E. coli, Klebsiellen, Pseudomonas aeruginosa). Über das monozytäre CD14 werden aber auch Gram-positive Bakterien (über Lipoteichonsäure, Proteoglykane) gebunden. Die Bindung aktiviert das CD14 Molekül auf der Monozytenoberfläche und verursacht im Zellinneren die vermehrte Synthese und schließlich die Freisetzung proinflammatorischer Mediatoren wie Interleukin 1ß, Interleukin 6, Tumor-Nekrose-Faktor.
CD14+ und CD16+ Monoyzten sind als Vorstufen von Makrophagen auf dem Weg in ein "Zielgewebe", z.B. um dort Cholesterin (in den Gefäßen) abzubauen, oder Erreger (Bakterien, Pilze) abzutöten. Zusätzlich exprimieren diese „zirkulierenden Makrophagen“ in höheren Konzentrationen HLA-DR Moleküle sowie "toll-like" Rezeptoren TLR2 und TLR4. TLR gehören zu den erst vor wenigen Jahren entdeckten, angeborenen Erkennungsstrukturen des Immunsystems (als sog. genuine Überlebensstrukturen; "Todesrezeptoren"). Sie sind für die Immunerkennung und -antwort und damit für das Überleben des Organismus unabdingbar. Das HLA-DR Molekül und seine Untergruppen gehört ebenfalls zu den Immunantwort- und Erkennungssystemen und spielt in der Transplantationsmedizin eine große Rolle (hier bei der Gewebsverträglichkeit von Spender und Empfänger). Monozyten sind Ziel und Effektorzellen für Fremd-und körpereigene Antigene, die kurz vor dem Abbau stehen. Der CD14+ CD16+ HLA-DR+ Phänotyp von Blutmonozyten (=„aktivierte Monozyten“) ist assoziiert mit einer akzelerierten Atheromatose, einer Mikroentzündung, chronischen Leber- und Nierenentzündungen, der Infektabwehr und der Propagation von Tumorzellen. An der Arteriosklerose sind Monozyten/Makrophagen mitbeteiligt.
Makrophagen (Riesenfresszellen)
Entwicklung: Makrophagen entwickeln sich im Knochenmark aus einer pluripotenten Stammzelle über die myeloide Reihe. Die Differenzierung aus der Vorläuferzelle geschieht durch Einwirken verschiedener Wachstumsfaktoren. Hierzu zählen zunächst GM-CSF (Granulozyten-Monozyten colony stimulating factor) und später vor allem M-CSF (Monozyten colony stimulating factor). Die gereifte Monozyte wird ins Blut abgegeben. Sie kann sich unter Einfluß von Zytokinen im Falle von Entzündungen in Makrophagen umwandeln und gleichzeitig in alle Körpergewebe einwandern. Unter normalen Umständen sind das Auge und der Hoden frei von Makrophagen, auch die Plazentaschranke können sie nicht überwinden. Im Falle von Entzündungen oder tumorösen Veränderungen können diese Schranken jedoch aufgehoben sein. Folgen sind oft Erblindung oder Sterilität. Makrophagen können sich aus im Blut zirkulierenden Monozyten entwickeln. Diese wandern dann in das Zielgewebe ein, zB in Arterien (Atherosklerose), Leber (Hepatitis), Niere (interstitielle Nephritis) etc. Im Blut zirkulieren bei Gesunden etwa 8% aller Monozyten in Form eines "Vortyps" (Phaenotyps) der an Makrophagen erinnert (CD14, CD16, HLA-DR positiv). Bei Infektionen, aber auch bei Systemerkrankungen sowie erhöhten Blutfettwerten steigt dieser Phaenotyp im Blut teilweise stark an. Der Immunphaenotyp CD14+CD16+ (siehe : www.monozyten.de) ist speziell sensitiv auf die Gabe von Glucocorticoiden.
Vorkommen: In den Geweben haben die Makrophagen verschiedene Namen:
- Histiozyt übergeordnete Bezeichnung für Gewebsmakrophagen (insbesondere des Bindegewebees)
- Alveolarmakrophagen in den Lungenalveolen. Als Herzfehlerzellen kommen sie im gefärbten Sputum (Berliner-Blau-Reaktion) von Patienten mit Linksherz-Insuffizienz vor. So können Makrophagen auch als diagnostische Hilfsmittel dienen.
- Kupffer-Stern-Zellen in der Leber
- Osteoklasten sind Knochen-abbauende Zellen im Knochengewebe
- Hofbauerzellen in der Plazenta
- Mikroglia im Gehirn
- Langerhans-Zellen sind dendritische Zellen in der Haut, die spezialisiert sind, Antigene aufzunehmen und vor Ort oder im Lymphknoten zu präsentieren.
- Schaumzellen sind mit Lipiden überladene Makrophagen. Sie kommen bei Fett-Stoffwechselstörungen, Fettsucht und Krankheiten wie dem Niemann-Pick-Syndrom oder dem Alport-Syndrom vor oder z.B. im Gehirn nach Schlaganfall (Abräumung der Kolliquationsnekrose) oder atherosklerotisch veränderten Gefäßwänden.
- Epitheloidzellen sind Makrophagenabkömmlinge, die bei der Tuberkulose eine Rolle spielen. Das innerhalb der Makrophage lebende Mycobacterium tuberculosis kann aufgrund der wachsartigen Zellwand-Beschaffenheit nicht verdaut werden. Um der Ausbreitung des Bakteriums im Organismus trotzdem Einhalt zu gebieten, werden aus dem Blut Monozyten rekrutiert, die sich nicht in phagozytierende, sondern in sekretorische Epiteloidzellen umwandeln. Diese, durch ihren katzenzungenartigen Zellkern auffallende Makrophagen-Abkömmlinge bilden einen Schutzwall, in dessen Zentrum es zur käsigen Nekrose kommt. Das gesamte, ca. 1mm durchmessende Gebilde wird als Granulom bezeichnet. Die Epitheloidzellen können zu mehrkernigen Langhans-Riesenzellen konfluieren, die nicht mit den Langerhans-Zellen der Epidermis zu verwechseln sind.
- Ungeordnete Riesenzellen sind ebenfalls mehrere Makrophagen, die sich zu einer Zelle zusammengeschlossen haben und um Fremdkörper entstehen (Fremdkörperriesenzelle). Eine Sonderform sind die Anitschow-Zellen, die beim rheumatischen Granulom vorkommen (Aschoff-Knötchen).
Die Funktion der Makrophagen ist vielfältig:
- Antigenpräsentation
- Phagozytose
- Entzündungs- und Granulomazellen
- Gewebereorganisation und Narbenbildung
- Lipidstoffwechsel
Körperfremde Proteine zum Beispiel auf der Oberfläche von Viren und Bakterien werden von den Makrophagen ständig phagozytiert, intrazellulär zerkleinert (zu Oligopeptiden prozessiert) und als Antigene auf der eigenen Zelloberfläche mit Hilfe des "Präsentiertellers" MHC-II-Komplex den T-Helferzellen präsentiert (Antigenpräsentation). Die Makrophagen selber sind Teil der unspezifischen Immunantwort (angeborenen Immunantwort), da sie ständig unspezifisch jede Art von potentiellen Körperfeinden phagozytieren. Werden diese jedoch in aufgearbeiteter Form den Lymphozyten präsentiert, kann hierdurch die für das jeweilige Antigen spezifische Immunantwort eingeleitet werden. Zusätzlich sind aktivierte Makrophagen in der Lage Zytokine freizusetzen, die die Durchblutung oder die Körpertemperatur erhöhen (Fieber) oder andere Leukozyten (unspezifisch) herbeilocken können (Chemotaxis durch Interleukin-1, TNF, Interleukin-12 uvm.).
Makrophagen phagozytieren auch körpereigene Zellen. So werden gealterte Zellen wie Erythrozyten in der Milz beseitigt. Zellen, die den programmierten Zelltod (Apoptose) sterben, werden ohne Entzündungsreaktion gefressen, während Zellen, die durch eine Nekrose zugrunde gehen, im Zuge einer Entzündungsreaktion von Makrophagen beseitigt werden. Nach dem Fressen der Zelltrümmer sorgen die Makrophagen für eine Narbenbildung (Granulationsgewebe, Einwanderung von Fibroblasten) und das Wiedereinspriessen von Blutgefäßen (Angiogenese). Im Falle einer Tuberkulose versuchen sie, die Eindringlinge (Mycobacterium tuberculosis, africanum, bovis oder microti) einzukapseln und an der Ausbreitung zu hindern. Die Zellen sind im Stande, durch die Produktion von Sauerstoff- und Stickstoffradikalen, Zytokinen und Enzymen Gewebe einzuschmelzen und zu zerstören und sie vermögen geschädigtes Gewebe durch Induktion der Narbenbildung wieder zu reorganisieren.
Neben der Aufgabe als Fresszellen sind sie stark in den Lipid-Stoffwechsel des Körpers eingebunden. Sie sind verantwortlich für die Oxidation der low-density Lipoproteine (LDL) und damit an der Entstehung der Arteriosklerose beteiligt (siehe Schaumzellen).
Lymphozyten

Lymphozyten sind immunologisch aktive zelluläre Bestandteile des Blutes und bilden bei Erwachsenen etwa 25-40% der Leukozyten im peripheren Blut.
Aufgabe: Die Hauptaufgabe der Lymphozyten sind die Erkennung von Fremdstoffen -- wie zum Beispiel Bakterien und Viren -- und deren Entfernung mit immunologischen Methoden. Dazu werden die Zellen in Milz, Knochenmark, Thymus und Lymphknoten (vermutlich auch in der Appendix vermiformis) geprägt, was bedeutet, dass sie "lernen" müssen, welche Stoffe zum Körper dieses Menschen gehören (negative Selektion autoggressiver Zellen) und welche als fremd (positive Selektion) anzusehen sind. Damit gehören die Lymphozyten zur spezifischen Abwehr. Die Lebensdauer von Lymphozyten kann ein paar Stunden bis zu mehreren Jahren (Gedächtniszellen) betragen. Ihre Aufgabe erfüllen die Lymphozyten auf verschiedene Weise. Sie produzieren Botenstoffe (Zytokine), die andere Immunzellen und auch normale Zellen dazu bringen, potentielle Gefahren, wie Bakterien und Viren, zu bekämpfen. Sie produzieren Antikörper (B-Zellen bzw. Plasmazellen), die diese "Angreifer" als "fremd" markieren und inaktivieren (z.B. durch agglutinieren), opsonieren (für Phagozyten "schmackhaft" machen) oder zerstören (durch Komplementaktivierung) und sie zerstören infizierte Zellen auch direkt (zytotoxische T-Zellen).
Bildungsort und Morphologie: Die Lymphozyten entstehen als Vorläuferzellen aus Stammzellen im Knochenmark der Ossa plana (Becken, Brustbein, z.T. Schädelknochen), bei Kindern zusätzlich in den Epiphysen der langen Röhrenknochen. Die Vorläuferzellen reifen im Bursa-Äquivalent (beim Menschen das Knochenmark selbst) bzw. im Thymus zu differenzierten B- bzw. T-Lymphozyten.
Die Zellen sind kernhaltig und haben in der Gram-Färbung ein granuliertes Zellplasma. Mit zunehmendem Alter der Zellen wird der Zellkern kleiner (Zellgröße: 10-15µm).
Funktion: Es gibt verschiedene funktional unterscheidbare Typen von Lymphozyten:
- T-Lymphozyten sind Bestandteil der zellulären Immunantwort
- Zytotoxische T-Zellen (CD8-Zellen, T-Killerzellen)
- T-Suppressorzellen
- T-Helferzellen (CD4-Zellen)
- T-Gedächtniszellen
- B-Lymphozyten sind Bestandteil der humoralen Immunantwort
- B-Plasmazellen sezernieren Antikörper (B-Zellen tragen diese als Rezeptor auf der Zellmembran)
- B-Gedächtniszellen
- NK-Zellen (engl.: natural killer cells) sind eine weitere Gruppe von großen granulären Lymphozyten, die weder über einen T- noch über einen B-Zell-Rezeptor verfügen und durch Freisetzung lytischer Granula infizierte Zellen zerstören und bei der angeborenen Immunität wichtige Funktionen erfüllen.
Erkrankungen: Zu den Erkrankungen des lymphatischen Systems gehören die angeborenen primären und die erworbenen sekundären Immundefekte, sowie die von lymphatischen Zellen ausgehenden malignen Erkrankungen wie die Non-Hodgkin-Lymphome einschließlich der chronischen lympatischen Leukämie, der Morbus Hodgkin, das von den Plasmazellen ausgehende Plasmozytom und die akute lymphatische Leukämie. Auch Autoimmunerkrankungen können zu den Erkrankungen des lymphatischen Systems gezählt werden.
Im Rahmen einer HIV-Infektion kommt es zu einer Verminderung der Lymphozytenzahl.
T-Lymphozyten
T-Lymphozyten oder kurz T-Zellen sind eine Subpopulation der Leukozyten (lymphoide Reihe) und neben den B-Lymphozyten an der adaptiven Immunantwort beteiligt.
Auch wenn die Vorläufer aus dem Knochenmark stammen, entwickeln sich T-Lymphozyten fast vollständig im Thymus (daher das T, für Thymus-abhängig). Sie tragen alle einen T-Zell-Rezeptor (TCR) an ihrer Oberfläche, der für die Erkennung von Antigenen verantwortlich ist. Die beiden antigenerkennenden Einheiten des TCRs liegen immer im Komplex mit mehreren CD3-Molekülen vor. Im Gegensatz zu den Immunglobulinen auf B-Lymphozyten erkennen T-Lymphozyten keine freien, sondern nur zellgebundene Antigene, die ihnen von anderen Zellen mittels MHC-Molekülen präsentiert werden. MHC-II wird von APZ exprimiert, MHC-I von allen kernhaltigen Körperzellen (Präsentation körpereigener Oligopeptide als "Personalausweis der Zelle" zur Eigen-Erkennung) .
Es werden mehrere Subtypen unterschieden, die unterschiedliche Funktionen im Immunsystem einnehmen.
T-Zell-Entwicklung: T-Zellen entwickeln sich vermutlich aus dem Lymphoblast (common lymphoid progenitor), einer Vorläuferzelle, die (wie alle Blutzellenvorläufer) im Knochenmark aus einer pluripotenten hämatopoetischen Stammzelle (auch Hämocytoblast) entsteht. Einige dieser Vorläuferzelle migrieren zum Thymus und differenzieren dort zur T-Zelllinie.
T-Helferzellen
T-Helferzellen tragen den CD4-Corezeptor an ihrer Oberfläche und erkennen Antigene, die ihnen von speziellen antigenpräsentierenden Zellen (dendritische Zellen, Makrophagen, B-Lymphozyten) auf MHC-II-Molekülen dargeboten werden. T-Helferzellen können die Immunantwort zum einen in eine zelluläre Richtung steuern, diese Aufgabe übernehmen die TH1-Zellen, und zum anderen in eine humorale, dafür sorgen TH2-Zellen:
- TH1-Zellen aktivieren durch die Ausschüttung von Zytokinen wie IFN-γ und IL-12 die sog. zelluläre Immunantwort. Dadurch werden Makrophagen aktiviert sowie die MHC-Produktion und Peptidprozessierung (also insgesamt die Peptidpräsentation). Zudem werden auch Zytotoxische-T-Zellen zur Proliferation angeregt. B-Zellen werden auch (aber nicht so stark wie durch TH2) angeregt und zwar zum Ig-Klassenwechsel (isotype switch) hin zur Produktion von opsonisierenden Antikörpern (v.a. IgG). Gleichzeitig wird eine TH2-Antwort durch die ausgeschütteten Zytokine inhibiert. Ausgelöst wird eine solche Antwort durch IFN-γ und IL-12, welche von Natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) und dendritischen Zellen gebildet werden. Dieser Weg dient v.a. der Bekämpfung einiger intrazellulärer Bakterien sowie von Virusinfektionen. Die Produktion von IFN-γ blockiert gleichzeitig die Differenzierung zu TH2-Zellen.
- TH2-Zellen steuern die Immunantwort in eine humoral betonte Richtung: TH2-Zellen schütten Zytokine wie TNF-β (auch Lymphotoxin), IL-4 und IL-10 aus, die wie die von TH1-Zellen ausgeschütteten Cytokine die andere Helferzellentwicklung hemmen. Durch diese Kreuzhemmung wird eine einmal eingeschlagene Richtung für die Immunantwort beibehalten. Besonders IL-10 hemmt zusätzlich die Makrophagenaktivierung, die bei einer humoralen Antwort nicht nötig ist. IL-4 sorgt bei der Aktivierung von B-Zellen vor allem für die Bildung von neutralisierenden Antikörperklassen, d.h. einen Klassenwechsel (isotype switch) zu IgA, IgG, IgE. TH2-Zellen können B-Zellen dabei sehr stark anregen. Die humorale Immunantwort wird vor allem durch das Zytokin IL-4 ausgelöst, IL-6 verstärkt diese Tendenz. Woher das IL-4 bei der Initiierung einer TH2-Antwort kommt, ist ungeklärt.
Man nimmt an, dass eine Disposition zur TH2-Antwort an der Pathogenese von Allergien beteiligt ist.
T-Killerzellen
T-Killerzellen (auch Zytotoxische T-Zellen bzw. CD8+-Zellen) tragen typischerweise ein CD8-Heterodimer an ihrer Oberfläche und erkennen Antigene, die ihnen von allen kernhaltigen Zellen auf MHC-I-Molekülen dargeboten werden. Daher spielen sie vor allem in der Erkennung und Beseitigung von viral infizierten Zellen ein Rolle.
Sie sind in der Lage, diese Zellen über verschiedene Wege (Fas/FasL; Perforin/Granzyme) in den programmierten Zelltod zu treiben. Sie sollten nicht mit NK (natürliche Killer)-Zellen verwechselt werden, die zwar auch zu den Lymphozyten zählen, jedoch keinen T-Zell-Rezeptor an ihrer Oberfläche tragen. NK-Zellen sind demnach Teil des angeborenen Immunsystems.
T-Suppressorzellen
Die Existenz dieser Zellenpopulation wurde in den 1970er gefordert. Sie sollten ebenfalls den CD8 Corezeptor tragen und Toleranz gegenüber verschieden Antigenen vermitteln können. Nachdem sich herausstellte, daß einige der experimentellen Befunde, auf die sich das Model stützte, Artefakte waren, wurde das Konzept Mitte der 1980er verlassen. Trotzdem findet sich diese Zellpopulation weiterhin in einigen Lehrbücheren neueren Datums. Eindeutig nachgewiesen wurde allerdings die immunsuppressive Wirkung bestimmter T-Zellen. Ob es sich dabei um eine neue T-Zellpopulation handelt, bleibt bisher offen.
T-Regulatorzellen
Diese Population trägt neben dem CD4 Corezeptor noch einen Teil des IL2-Rezeptors (CD25) an ihrer Oberfläche. Sie wurde Mitte der 1990er erstmals beschrieben und soll ebenfalls Toleranz vermitteln. Im Gegensatz zu den T-Suppressorzellen ist die experimentelle Beweislage für diesen Zelltyp jedoch ausgezeichnet. Die Mechanismen der Toleranzvermittlung sind jedoch noch nicht vollständig aufgeklärt.
NK-T-Lymphozyten
Ursprünglich in der Maus identifiziert, rührt die Bezeichnung aus der Beobachtung, daß sie Oberflächenmarker tragen, die sonst auf NK-Zellen gefunden werden. Da diese Zellen jedoch auch einen T-Zell-Rezeptor tragen, werden sie den T-Lymphozyten zugerechnet. Sie sind meist doppelt negativ (kein CD4 und CD8), einige wenige aber CD4+. NK-T-Zellen erkennen das Molekül CD1b, ein MHC-ähnliches Molekül, welches vor allem ungewöhnliche Antigene bindet (vor allem lipidhaltige Antigene oder Moleküle wie Glycophosphatidylinositol). Der TCR dieser Zellen besitzt eine invariante α-Kette in Kombination mit drei verschiedenen β-Ketten. Obwohl NK-T-Zellen lytische Aktivität zeigen (wie T-Killerzellen, sie oben), gibt es Hinweise darauf, dass sie eine Bedeutung bei der Regulation der Immunantwort haben (also TH1 oder TH2). Für diesen Punkt spricht, dass sie sehr früh im Lauf einer Infektion reagieren, und alle entscheidenden Cytokine wie IFN-γ, IL-4 und IL-10 sezernieren können. Sie könnten den Übergang der Immunantwort vom angeborenen zum adaptiven Immunsystem darstellen. An diesen Zellen wird noch viel geforscht.
γδ T-Lymphozyten
Im Gegensatz zu den oben beschrieben Populationen tragen γδ-T-Zellen einen anderen Isotyp des T-Zell-Rezeptors an ihrer Oberfläche. Der Großteil dieser Zellpopulation hat keine CD4/CD8 Corezeptoren an ihrer Oberfläche. Die Funktion der γδ T-Lymphozyten ist noch nicht vollständig geklärt, einige von ihnen scheinen jedoch Stoffwechselprodukte von Mykobakterien zu erkennen. Sie scheinen vor allem im Darmlymphgewebe eine Rolle zu spielen (in Peyerschen Platten bzw. GALTs, engl: gut associated lymphoid tissues). Eine Untergruppe dieser Zellen trägt einen NK-Rezeptor, welcher MHC-ähnliche Moleküle (MIC-A und MIC-B) auf Darmepithelzellen erkennt. Diese werden nur bei Stress oder Verletzung der Epithelzellen exprimiert. Dieser Zelltyp ist dann in der Lage, solche Zellen zu erkennen und zu töten.
Hinweise: Es muss erwähnt werden, dass viele der Erkenntnisse vor allem über die genauere Regulation des Immunsystems (TH1- / TH2-Antwort, regulatorische T-Zellen etc.) im Mausmodell untersucht wurden. Obwohl die Maus als Testsystem durchaus eine Berechtigung hat, sollte daran gedacht werden, dass es gerade in einem hochkomplexen und evolutionär stark unter Druck stehendem System wie dem Immunsystem durchaus Unterschiede gibt. Es können also nicht alle Erkenntnisse als auch für den Menschen zutreffend angesehen werden.
B-Lymphozyten
B-Lymphozyten oder kurz B-Zellen sind zusammen mit den T-Lymphozyten entscheidender Bestandteil des lymphatischen Systems und die Träger der humoralen Immunantwort (Bildung von Antikörpern). Wenn sie aktiviert werden, können sie sich zu Antikörper-sezernierenden Plasmazellen oder zu B-Gedächtniszellen differenzieren.
Die Bezeichnung "B-Zellen" stammt ursprünglich von ihrem Bildungsort in der Bursa Fabricii bei Vögeln. Bei Säugetieren entstehen die B-Zellen im Knochenmark, daher erhielt der Buchstabe B hier nachträglich die Bedeutung bone marrow (Knochenmark).
B-Lymphozyten zirkulieren im Blut und den lymphatischen Organen (Thymus, Milz, Lymphknoten, Knochenmark) von Wirbeltieren. Bindet eine B-Zelle an ein Antigen, das zu ihrem Rezeptor passt (variabler Teil des antigen binding fragment (Fab) der membrangebundenen Antikörper, jede B-Zelle exprimiert Antikörper mit nur einem spezifischen Fab-Teil), und bekommt sie gleichzeitig ein costimulatorisches Signal von T-Helferzellen (die ebenfalls dasselbe Antigen erkannt haben müssen) dann beginnen sie stark zu proliferieren (klonale Expansion).
Die Gene für die variablen Teile der Immunglobuline sind genetisch hochvariabel. Es werden in der B-Zell-Vorläuferzelle ständig Mutationen eingeführt, die zur Verbesserung der Antikörper-Affinität für das erkannte Antigen führen (somatische Hypermutation). Außerdem kann hier ein Klassenwechsel (IgG, IgM, IgA usw.) des konstanten Teils der Antikörper stattfinden, was wichtig ist für die Art, wie die Antikörper auf den Erreger weiterhin wirken beziehungsweise wohin die Antikörper im Körper gelangen.
B-Lymphozyten tragen auf ihrer Oberfläche eine Reihe von Oberflächenmarkern, die funktionell wichtig sind und zu ihrer Identifizierung z. B. im menschlichen Blut oder in Gewebeproben verwendet werden können. Neben den membranständigen Immunglobulinen (Antikörpern) zählen dazu z. B. CD19, CD20 und CD21.
Angeborenes und adaptives Immunsystem
In der frühen Stammesgeschichte der Lebewesen (auf der Stufe der Eukaryoten) entwickelte sich zunächst ein relativ unspezifisch agierendes Verteidigungssystem: das angeborene Immunsystem. Erst später, mit dem Auftreten der Wirbeltiere, kam es zur Entwicklung des adaptiven Immunsystems, das gezielt gegen Erreger vorgeht und eine Art individuelles Gedächtnis in die Verteidigungsstrategie des Organismus einführte.
Das angeborene Immunsystem kann Infektionserreger bekämpfen, ohne dass der Organismus vorher mit dem Erreger Kontakt hatte. Dabei werden Mustererkennungs- und Verteidigungsstrategien verwendet, die sich schon zur Zeit der ersten Eukaryoten als effizient erwiesen haben. Es wird angenommen, dass etwa 90% aller Infektionen durch das angeborene Immunsystem erkannt und endgültig bekämpft werden. Die Aufgaben des angeborenen Immunsystems werden von verschiedenen Zellen wahrgenommen. Dazu gehören Granulozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, Epithelzellen und natürliche Killerzellen (NK-Zellen). Diese Zellen sind zum Teil in der Lage, den Angreifer (Erreger) selbst zu vernichten. Außerdem versetzen sie bei Infektionen den Organismus durch Produktion von Mediatoren in eine Art Alarmzustand, was wiederum die zelluläre Abwehr stimuliert und zum Ort des Geschehens lockt (Chemotaxis). Die Wirkung einiger dieser Signalstoffe äußert sich erkennbar beispielsweise in Entzündungen und Fieber.
Das adaptive Immunsystem zeichnet sich durch die Anpassungsfähigkeit seiner Waffen gegenüber dem Angreifer aus. Im Rahmen dieser Anpassung sind die Zellen des adaptiven Immunsystems (T- und B-Lymphozyten) in der Lage, spezifische Strukturen der Angreifer zu erkennen und gezielt zelluläre Abwehrmechanismen und molekulare Antikörper zu bilden. Nach der Infektion bleiben diese spezifischen Antikörper und die sog. Gedächtniszellen erhalten, um zukünftig den gleichen Angreifer mit kürzerer Reaktionszeit unschädlich zu machen. Damit das adaptive Immunsystem vom Angreifer überhaupt Kenntnis erlangt, bedient es sich der Antigenpräsentierenden Zellen (APZ), hierzu gehören z.B. Makrophagen oder dendritische Zellen. Diese Zellen gehören zum angeborenen Immunsystem und sind in der Lage, auf ihrer Oberfläche Erregerantigene zu präsentieren. Hier besteht eine wichtige Schnittstelle zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem.
Das angeborene Immunsystem
Die Elemente des angeborenen Immunsystems (z.T. auch als unspezifische Abwehr bezeichnet) sind
- mechanische Barrieren, die ein Eindringen der Schädlinge verhindern sollen,
- antibiotische Peptide und lytische Enzyme.
- Abwehrzellen (Granulozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, Epithelzellen, natürliche Killerzellen (NK-Zellen)) und
- ihre Mediatoren zur Koordination der Abwehr.
Physikalisch-chemische Barrieren
Diese sorgen dafür, dass die Pathogene erst gar nicht in den Körper eindringen können oder ihn möglichst schnell wieder verlassen:
- Haut - äußere Schicht als Barriere, Hauttalg, Schweiß, "Säureschutzmantel" und Normalflora (Kolonisationsresistenz) als Wachstumsbremsen für körperfremde Mikroorganismen
- Schleimhaut - Bindefunktion des Schleims, IgA,
- Nase - Abfangfunktion des Nasenschleims, Zilienschlag des Flimmerepithels
- Augen - Tränenfluss, Lysozym (antimikrobiell bes. auf Gram-positive Erreger)
- Atemwege - Bindefunktion des Schleims, Zilienschlag des Flimmerepithels
- Mundhöhle - Lysozym
- Magen - Magensäure und Proteasen
- Darm - Lymphatisches Gewebe, Kolonisationsresistenz, Abtransportfunktion durch ständige Entleerung
- Harntrakt - Abtransportfunktion durch ständige Harnausspülung sowie osmotische Effekte der hohen Harnstoffkonzentration, Schließmuskeln
- Weiblicher Genitaltrakt - Saurer pH (Milchsäurebakterien) in der Vagina, Zervixschleim, Zilienschlag und Flüssigkeitsstrom in den Tuben Richtung Uterus
Erkennung des infektiösen Agens
Die Zellen des angeborenen Immunsystems sind mit Hilfe von Rezeptoren in der Lage, bestimmte Strukturmerkmale von Angreifern zu erkennen. Das angeborene Immunsystem ist dabei schon vor dem Erstkontakt mit einem Krankheitserreger "scharf geschaltet", es bedarf keiner Anpassung.
Entwicklungsgeschichtlich hat sich dabei eine Mustererkennung durchgesetzt, bei der für den Angreifer lebenswichtige molekulare Strukturmerkmale erkannt werden. Die Veränderung dieser Strukturen führen offensichtlich zur Verkrüppelung oder dem Absterben des Trägers. Die Selektion wirkt also im Sinne der Erhaltung dieser Merkmale. Zu diesen unverzichtbaren Proteinen gehören beispielsweise das Flagellin der Salmonellen und das Lipopolysaccharid gramnegativer Bakterien. Diese Merkmale haben sich entwicklungsgeschichtlich gehalten, so dass schon bei primitiven Eukaryoten Abwehrmechanismen entwickelt und im Verlauf der Phylogenese ohne Änderung beibehalten werden konnten.
Die Strukturmerkmale werden pathogen associated molecular pattern (PAMP) genannt und werden von verschiedenen Rezeptoren erkannt, darunter die Toll-artigen Rezeptoren (TLR).
Die Rezeptorproteine können in frei gelöster Form im Plasma zirkulieren oder an verschiedene Zellpopulationen gebunden sein. Dazu gehören
- Neutrophile Granulozyten,
- Monozyten/Makrophagen und
- Dendritische Zellen.
Das zelluläre angeborene Immunsystem
Neutrophile Granulozyten, Monozyten/Makrophagen und dendritische Zellen können durch Aufnahme und Verdauung (Phagozytose) den Erreger selbst vernichten oder durch die Produktion von Immunmodulatoren und Zytokinen die Immunreaktion des Organismus steuern.
Neutrophile Granulozyten
 |
 |
Die neutrophilen Granulozyten machen etwa 50%-65% der Zellen im Differentialblutbild aus. Je nach Form des Zellkerns unterscheidet man jugendliche stabkernige und ausgereifte segmentkernige neutrophile Granulozyten. Ihre mittlere Verweildauer im Blut beträgt 6-8 Stunden. Die neutrophilen Granulozyten enthalten zahlreiche Granula (Lysosomen).
Neutrophile sind Bestandteil des angeborenen, unspezifischen Abwehrsystems. Ihre Aufgabe besteht u.a. in der Bekämpfung von meist bakteriellen Infektionen durch Phagozytose und Exozytose von azurophilen Granula. Die Granula der Neutrophilen enthalten saure Hydrolasen, Defensine (30% des Inhalts), Plasminogenaktivatoren (t-PA, u-PA), Myeloperoxidase und neutrale Proteasen, wie Elastase, Kollagenase, Neuramidase und Cathepsin G. Dieser „Cocktail“ ermöglicht es den Neutrophilen, sich einen Weg durch das Bindegewebe und Fibringerinnsel zu bahnen und zu den Bakterien vorzudringen. Mit spezifischen Rezeptoren binden die Neutrophilen dabei die Proteasen auf der Zellmembran, so dass deren aktive Zentren von der Zelle weg in das Bindegewebe gerichtet sind.
Die Phagozyten entleeren dann auch sekundäre Granula. Diese enthalten Lactoferrin, ein Protein, das Eisen (Fe++) bindet und den Bakterien entzieht, sowie Lysozym, ein Enzym, das die Pepdidoglykane Gram-positiver Bakterien spaltet und damit toxisch auf diese Bakterien wirkt. Die Ausstattung der Neutrophilen mit Rezeptoren, die der Phagozytose dienen, ist ähnlich der der Makrophagen. Neutrophile besitzen ebenfalls CD14 und Mannose bindende Rezeptoren.
Eiter besteht zum großen Teil aus abgestorbenen neutrophilen Granulozyten. Dabei sind selbst die sterbenden Granulozyten noch für die Bakterien gefährlich. Wenn die Immunozyten sterben, stoßen sie aktiv ihren Zellkern aus. Die ausgeworfenen Nucleinsäuren bilden zusammen mit zytoplasmatischen bakteriziden Enzymen dichte Netze, sog. Neutrophil Extracellular Traps (NETs), in denen Bakterien hängen bleiben und abgetötet werden. An dieser Reaktion sind auch reaktive Sauerstoffspezies (ROS) beteiligt, die von der NADPH-Oxidase generiert werden. [1]
Bei Infektionen kommt es zu einem Anstieg der Zahl der neutrophilen Granulozyten im Blut (Neutrophilie). Zusätzlich kann es zu einer Zunahme des Anteils von stabkernigen Granulozyten und dem Auftreten von Vorstufen der Granulozyten im Differentialblutbild kommen. Man spricht von einer Linksverschiebung. Ein Mangel an neutrophilen Granulozyten (Neutropenie) kann zu schweren bakteriellen Infektionen führen. Bei der septischen Granulomatose ist deren Funktion völlig gestört; im Frühjahr 2006 wurde der erste erfolgreiche Versuch einer Gentherapie zur Behebung dieser Erkrankung veröffentlicht.
Makrophagen
Makrophagen stellen ebenfalls einen Teil der Patrouille des Immunsystems dar. Sie gehen aus den Monozyten hervor und halten sich im Gewebe auf, wo sie eingedrungene Erreger erkennen und phagozytieren. So spielen Makrophagen direkt bei der Bekämpfung und Beseitigung von schädlichen Substanzen und Abfallprodukten eine entscheidende Rolle.
Zusätzlich werden die aufgenommenen Teile im Inneren der Makrophagen in Oligopeptide (Epitope) zerlegt und durch MHC-II-Moleküle auf der Oberfläche präsentiert. Der Makrophage wird also zu einer Antigen-präsentierenden Zelle und damit zu einem Informanten der spezifischen Abwehr. Auf die präsentierten Antigene sprechen die T-Zellen der Klasse CD4 (T-Helferzellen) an. Diese können so, und nur so, erkennen, welche Fremdantigene sich im Körper bewegen.
Natürliche Killerzellen
Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) sind Teil des angeborenen Immunsystems, obwohl sie sich einen Knochenmarksvorläufer mit T-Zellen teilen. Erstmals beschrieben wurden sie 1975 am Karolinska Institut in Stockholm. Im Gegensatz zu T-Zellen können sie ohne vorherige Aktivierung unmittelbar reagieren. Im Laufe der 1980er Jahre wurde klar, dass NK-Zellen unter normalen Umständen von so genannten "MHC Klasse I"-Molekülen inhibiert werden, die sich an der Oberfläche fast aller Körperzellen befinden. Wird eine Zelle infiziert oder wandelt sich in eine Tumorzelle um, gehen unter Umständen "MHC Klasse I"-Moleküle auf der Oberfläche verloren. Das Resultat ist eine von NK-Zellen getragene Immunantwort gegen genau diese Zellen. Dieses Konzept wurde international als so genannte "missing-self" Erkennung (Klas Kärre et al.) bekannt.
Während der 1990er Jahre wurde dieses Konzept dahingehend erweitert, dass die Kontrolle von NK-Zellen von einem fein ausbalancierten Gleichgewicht zwischen inhibierenden und aktiverenden Signalen abhängt. Sowohl der Verlust von inhibierenden als auch die vermehrte Präsenz aktivierender Signale kann demnach zu einer NK Zellantwort führen. Zur Verarbeitung dieser Signale tragen NK-Zellen eine Vielzahl unterschiedlicher Rezeptoren auf ihrer Oberfläche, die auf den potenziellen Zielzellen inhibierende oder aktivierende Liganden wahrnehmen. Diese Integration multipler Signale unterstreicht die hohe Komplexität auch des angeborenen Immunsystems.
Eosinophile Granulozyten
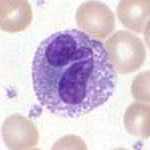
Eosinophile Granulozyten machen etwa 3 - 5% der Zellen im Differentialblutbild aus und sind an der zellulären Immunabwehr beteiligt. Ihren Namen beziehen sie vom Farbstoff Eosin, mit dem sie angefärbt werden können.
In ihrem Inneren enthalten sie Vesikel (Granula), die basische Proteine enthalten, z.B. das Major Basic Protein. Der Inhalt der Granula kann durch Exozytose an die Umgebung abgegeben werden.
Eosinophile werden unter anderem durch Antikörper der IgE-Klasse zur Exozytose angeregt. Sie sind zur Chemotaxis befähigt, d.h. sie können sich amöboid in Richtung eines anlockenden Stoffes (Attractant) fortbewegen.
Eosinophile spielen eine wichtige Rolle bei der Parasitenabwehr. Das vollzieht sich folgendermaßen: Sobald die Oberfläche des Parasiten mit IgE besetzt ist, können sich Eosinophile daran heften. Durch einen speziell angepassten Mechanismus geben sie ihre toxischen Proteine direkt auf die Oberfläche des Parasiten ab und schädigen diesen. Gleichzeitig dienen die exozytierten Proteine für andere Eosinophile als Lockstoffe, so dass die Abwehr verstärkt werden kann.
Eosinophile können aber auch eine für den Organismus selbst schädigende Rolle spielen. Bei Asthma beispielsweise wird das Lungenepithel durch die basischen Inhaltsstoffe der Eosinophilen angegriffen. Eine durch Eosinophile ausgelöste seltene Krankheit ist die eosinophile Fasciitis.
Bei Allergien ist die Anzahl der Eosinophile im Blut erhöht. Diese so genannte Eosinophilie ist ein wichtiger Indikator für das Vorhandensein einer Allergie. Eine Verminderung der Eosinophilenzahl nennt man Eosinopenie.
Basophile Granulozyten

Basophile Granulozyten besitzen zahlreiche grobe unregelmäßige Granula, die u. a. Histamin und Heparin enthalten. Im Differentialblutbild machen sie nur einen geringen Anteil aus (< 2 %). Basophile sind aus dem Knochenmark stammende Granulozyten, die mit den Eosinophilen einen gemeinsamen Vorläufer besitzen. Wachstumsfaktoren für die Basophilen sind u. a. IL-3, IL-5 und GM-CSF. Es gibt Hinweise für eine wechselseitige Kontrolle bei der Reifung zwischen Basophilen und Eosinophilen. Beispielsweise unterdrückt TGF-beta in Gegenwart von IL-3 die Differenzierung von Eosinophilen und fördert die der Basophilen. Sie besitzen einen Rezeptor für IgE, weshalb man annimmt, dass sie eine Rolle bei der Immunabwehr des Wirts gegen Parasiten spielen.
Wenn ihre Rezeptoren durch an IgE gebundene Allergene kreuzvernetzt werden, degranulieren die Basophilen und schütten toxische Mediatoren, wie Histamin und PAF (Plättchenaktivierender Faktor -> Aggregation der Thrombocyten), aus. Eosinophile, Basophile und Mastzellen können miteinander in Wechselwirkung treten und die gegenseitige Degranulation noch verstärken.
Die Aktivierung von Immunzellen, die Rezeptoren für IgE besitzen, kann zur allergischen Sofortreaktion wie z. B. Heuschnupfen führen. Eine systematische Aktivierung dieser Zellen (also die Aktivierung im ganzen Körper) kann zum anaphylaktischen Schock führen.
Zu einer Vermehrung von basophilen Granulozyten im Blut kann es bei myeloproliferativen Erkrankungen, insbesondere der chronischen myeloischen Leukämie, kommen.
Das angeborene humorale Immunsystem
Das Komplementsystem
Das Komplementsystem, eine Klasse von Blutproteinen ist in der Lage, sich an körperfremde sowie körpereigene Strukturen zu binden. Körpereigene Strukturen schützen sich dagegen durch bestimmte Proteine.
Um erkannte körperfremde Proteine zu bekämpfen, bedient sich das Komplementsystem hauptsächlich zweier Strategien:
- Es ist in der Lage ein Porin zu bilden, welches die Zellwände des Eindringlings durchlöchert und diesen auslaufen lässt.
- Es hat die Möglichkeit, Fresszellen anzulocken (Chemotaxis) und auf das markierte Objekt anzusetzen (Opsonierung).
Das Komplementsystem ist neben den Phagozyten ein wesentlicher Bestandteil der angeborenen Immunabwehr. Die mehr als 30 Proteine des menschlichen Komplementsystems sind im Blutplasma gelöst oder zellgebunden und dienen der Abwehr von Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Pilze, Parasiten), haben jedoch auch stark zellzerstörende Eigenschaften und können, wenn sie unreguliert wirken, im Verlauf vieler Krankheiten (z. B. Glomerulonephritis, hämolytisch-urämisches Syndrom, Herzinfarkt, systemischer Lupus erythematodes, Rheumatoide Arthritis) für Gewebsschäden verantwortlich sein.
Bestandteile des Komplementsystems
Direkt an den Signalwegen des Komplementsystem beteiligt sind folgende Proteine: die Komplementfaktoren C1 bis C9, das Mannose-bindende Lektin (MBL) und die an C1 bzw. MBL gebundenen Serin-Proteasen C1r und C1s bzw. MASP-1 bis 3 (engl. MBL-associated serine proteases). Durch Protease-vermittelte Spaltung der Komplementfaktoren C1 bis C5 und Zusammenlagerungen mit den Faktoren C6 bis C9 entsteht eine Vielzahl an Proteinen und Proteinkomplexen. Zu diesen gehören beispielsweise die Anaphylatoxine C3a, C5a und C2b mit gefäßerweiternder und chemotaktischer Wirkung (Entzündungsreaktion) und der Membranangriffskomplex (engl. Membrane Attack Complex (MAC)). Negativregulatoren des Systems sind der C1-Inhibitor, Faktor H, Faktor I, C4bp, CD35, CD46, CD55, CD59 und Vitronektin. Als einziger Positivregulator wirkt Properdin.
Ablauf und Wirkung der Komplement-Aktivierung
Man unterscheidet drei Wege durch die das Komplementsystem aktiviert wird:
- Den über Antikörper vermittelten klassischen Weg ("klassisch", weil zuerst entdeckt).
- Den spontanen und Antikörper-unabhängigen alternativen Weg.
- Den über Mannose-bindendes Lektin aktivierten Lektin-Weg.
Das Produkt jedes Wegs ist eine C3-Konvertase genannte Serin-Protease auf der Oberfläche der Zielzelle. Die von ihr ausgelöste Spaltungskaskade führt zu chemotaktischer Anlockung von Leukozyten, verstärkter Phagozytose, und letztendlich zur Lyse der Zielzelle. Spaltprodukte der Komplementfaktoren C1 bis C5 die in den einzelnen Wegen entstehen wirken zusätzlich als Anaphylatoxine und vermitteln eine Entzündungsreaktion.
Klassischer Weg Alternativer Weg
Zielzelle mit Antikörpern markiert Zielzelle mit auffälligen Membranproteinen
| (LPS, virusinduziert) |
|(schnell) (langsam) |
| P D |
| -> C1 -> C4 + C2 -> C4b2b = C3-Konvertase = C3bBb <- B + C3b <- C3 <-|
↑ ↓ ↓ |+ ..................↑ ↓
MASP C4a C2a C3 -> C3a + C3b C3a
↑ |
MBL C3b + C4b2b oder C3bBb -> C5-Konvertase
|+
Lektinweg C5a + C5b <- C5
|+
MAC (C5b-C9) <- C9-Polymerisation <- C5b + C6-C8
Der klassische Weg
Im klassischen Weg wird die „C3-Konvertase des klassischen Weges“ gebildet. Der Komplementfaktor C1 besitzt mehrere Bindungsdomänen für Antigen gebundenene Antikörper (Ig). Für die Aktivierung der an C1 gebundenen Serin-Proteasen (C1r und C1s) sind zwei 40nm voneinander entfernte Ig-Fc-Regionen nötig. Freie Antikörper führen daher nicht zur Aktivierung. Die Protease C1s katalysiert dann die beiden Startreaktionen des klassischen Weges, eine Spaltung von C2 in C2a und C2b und eine weitere von C4 in C4a und C4b. C2a und C4a diffundieren und wirken wiederum als Anaphylatoxine. C2b und C4b lagern sich zum C4b2b-Komplex zusammen und bilden so die „C3-Konvertase des klassischen Weges“.
Der alternative Weg
Der alternative Weg führt zur Bildung der „C3-Konvertase des alternativen Weges“. Ausgelöst wird dieser Weg durch den spontanen Zerfall des instabilen Komplementfaktors C3 in C3a und C3b. C3a diffundiert und besitzt eine chemotaktische und entzündungsauslösende Wirkung als Anaphylatoxin. C3b bindet kovalent an eine Zelloberfläche. Wenn es an körpereigene Zellen bindet wird es relativ rasch durch Regulatorproteine inaktiviert oder abgebaut. Auf pathogenen Oberfläche bleibt es dagegen aktiv und kann Faktor B binden. Am entstandenen C3bB-Komplex wird durch den Serum-Faktor D ein Stück des Faktors B (genannt Ba) abgeschnitten. Bb bleibt an C3b gebunden. Der Komplex C3bBb wird als „C3-Konvertase des alternativen Weges“ bezeichnet. Er ist sehr instabil und zerfällt, wenn er nicht von Properdin (P) stabilisiert wird.
Der Lektin-Weg
Im Lektin-Weg bindet das Mannose-bindende Lektin (MBL) an Mannose oder N-Acetyl-Glukosamin auf der pathogenen Oberfläche (z.B. bakterielles Peptidoglykan) und aktiviert dann die MBL-aktivierten Proteasen MASP-1, MASP-2 und MASP-3. Diese katalysieren dieselben Reaktionen wie im klassischen Weg. Auch hier bilden wieder C4b und C2b ein C4b2b-Heterodimer und damit ebenfalls die „C3-Konvertase des klassischen Weges“.
C3-Konvertase ausgelöste Reaktionen
Die im alternativen, klassischen und Lektin-Weg gebildeten C3-Konvertasen, C3bBb und C4b2b, spalten nun mit hoher Aktivität C3 in C3b und C3a. Die entstehenden C3b-Moleküle haben nun im Wesentlichen drei Möglichkeiten:
- Sie finden keine geeignete Oberfläche an die sie binden können und werden inaktiviert.
- Die Moleküle lagern sich an die Zelloberfläche einer Zielzelle an und führen so zu einem weiteren „Start“ des alternativen Weges. Eine positive Rückopplung entsteht. Außerdem wirken sie als Opsonine und markieren die Zielzelle als lohnendes Ziel zur Phagozytose.
- Einige der Moleküle binden an eine C3-Konvertase (C4b2a bzw. C3bBb). Die hierbei entstehenden trimolekularen Komplexe C4b2a3b und C3bBbC3b spalten nun nicht mehr C3 sondern C5, daher werden sie jetzt als „C5-Konvertasen des klassischen bzw. alternativen Weges“ bezeichnet.
Die beiden Produkte der C5-Spaltung fungieren einerseits als Anaphylatoxin und chemotaktischer Lockstoff (C5a) und andererseits leiten sie auch die Bildung des Membranangriffskomplex (MAC) ein (C5b). Dabei rekrutiert der „Anker“ C5b nacheinander die Faktoren C6, C7 und C8. Der entstandene C5b678-Komplex startet dann die Polymerisierung von C9. Nach der Zusammenlagerung von bis zu 18 C9 Monomeren stellt der C5b678poly9-Komplex den fertigen Membranangriffskomplex dar, der die Zielzelle unter anderem durch Porenbildung in der Zellmembran attackiert und zu ihrer Lyse führt.
Weblinks:
- http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/C/Complement.html
- http://www.srcf.ucam.org/~ajm226/mp/complement.jpg
- http://www.vu-wien.ac.at/i123/allvir/Komplement1.html
Das adaptive Immunsystem
Darüber hinaus besitzt das Immunsystem höher entwickelter Organismen ein sehr anpassungsfähiges und auch erinnerungsfähiges Teilsystem, welches vor allem gegen Viren hocheffektiv ist. T- und B-Zellen gehören beide zu den Lymphozyten, einer Untergruppe der Leukozyten (weiße Blutkörperchen). Beide Zelltypen entwickeln sich im Knochenmark (engl. bone marrow), wobei die T-Zellen im Fötus vor der Geburt eine weitere Reifung im Thymus (Name!) durchlaufen; der Reifungsort der B-Zellen wurde zuerst bei Vögeln beschrieben (Bursa fabricii, Name!). Bei Säugern fehlt die Bursa fabricii, Reifungsort bei ihnen ist ebenfalls das Knochenmark.
Die adaptative zelluläre Abwehr
T-Lymphozyten
T-Lymphozyten werden nach verschiedenen Kriterien unterschieden. Für die folgenden Erläuterungen ist die Unterscheidung der T-Zellen nach ihren Rezeptoren, die sie auf ihrer Oberfläche tragen, entscheidend.
T-Zellen verfügen über mehrere Rezeptoren, um ihnen das Andocken an passende Antigene zu ermöglichen. Neben dem passenden T-Zell-Rezeptor, mit dem ein spezielles Antigen erkannt wird (Schlüssel-Schloss-Prinzip), ist noch ein Oberflächenmarker entscheidend, der sie als CD4 / T-Helferzelle bzw. als CD8 / T-Killerzelle klassifiziert. Die Abkürzung CD steht für engl. Cluster of differentiation.
CD4-Lymphozyten (T-Helferzellen)
CD4-positive Zellen können über ihren spezifischen T-Zell-Rezeptor nur an körperfremde Strukturen andocken, die durch B-Zellen, antigenpräsentierende dendritische Zellen oder Makrophagen mit Hilfe des MHC-II Molekül präsentiert werden. Um die CD-4 Zelle in einen aktiven Zustand zu versetzen ist es zusätzlich Bedingung, dass die Makrophage die Kostimulanz B7 auf ihrer Oberfläche bildet und diese an den CD-28 Rezeptor der T-Zelle andockt. Die Aktivierung veranlasst die Teilung der T-Zelle und das Freisetzen von Lymphokinen, die weitere Teile des Immunsystems, die B-Zellen, mobilisieren.
CD8-Lymphozyten (Zytotoxische T-Zellen)
CD8 positive T-Zellen erkennen mit ihrem T-Zell-Rezeptor fremde Peptide, die im MHC-I Komplex an der Oberfläche von körpereigenen Zellen präsentiert werden. Nur wenn sich auch noch das CD28 Oberflächenprotein der T-Zelle an den MHC-Peptid-Komplex geheftet hat, wird die T-Zelle aktiviert und sezerniert zytotoxische Substanzen, welche die infizierte oder krankhaft veränderte Zelle in die Apoptose treibt.
Neutrophile Granulozyten
Bei einer kleinen Subgruppe der neutrophilen Granulozyten konnte kürzlich ein variables Antigen-Rezeptorsystem ähnlich dem T-Zellrezeptor nachgewiesen werden. Die Zellen bilden damit neben den B- und T-Lymphozyten offensichtlich ein weiteres Standbein der adaptativen Immunabwehr. [2]
Die adaptative humorale Immunantwort
B-Lymphozyten
B-Zellen, die mit ihrem an der Zelloberfläche befindlichen Antikörper bereits an ein Antigen angedockt haben, können durch Lymphokine aktiviert werden, die von aktivierten CD-4 T-Zellen ausgeschüttet werden (die ebenfalls das Antigen mit ihrem T-Zell-Rezeptor gebunden haben). Die aktivierte B-Zelle beginnt sich zu teilen (klonale Expansion) und die Tochterzellen wandeln sich in Antikörper-sezernierende Plasmazellen (z.T. auch in B-Gedächtniszellen) um. Während einer Erstinfektion dauert es mindestens fünf Tage, bis sich aus B-Zellen Plasmazellen entwickeln.
Diese sind in der Lage, auch freie (also nicht von MHC gebundene) Antigene zu erkennen und sie durch Anlagerung für das Komplementsystem oder Makrophagen zu markieren oder direkt z.B. durch Agglutination zu inaktivieren.
Antikörper
Jeder Antikörper besteht aus zwei identischen schweren Ketten und zwei identischen leichten Ketten. Die schweren Ketten sind u.a. für die Verankerung des Antikörpers auf der Oberfläche von Granulozyten zuständig; die leichten Ketten bilden zusammen mit den schweren Ketten das für die Erkennung eines spezifischen Antigens verantwortliche Fab-Fragment (antigen binding fragment). Durch somatische Rekombination können Antikörper mehr als 100 Millionen verschiedene Fab-Fragmente bilden und damit eine Unzahl verschiedener Antigene erkennen.
Antikörper sind globuläre Proteine (Immunglobuline), die in Wirbeltieren als Antwort auf Antigene gebildet werden und der Abwehr dieser Fremdstoffe dienen. Als Antigene wirken fast ausschließlich Makromoleküle oder an Partikel gebundene Moleküle, zum Beispiel Lipopolysaccharide an der Oberfläche von Bakterien. Ein bestimmtes Antigen induziert in der Regel die Bildung nur eines bestimmten, dazu passenden Antikörpers, der spezifisch nur an diesen Fremdstoff gebunden wird. Die spezifische Bindung von Antikörpern an die Antigene bildet einen wesentlichen Teil der Abwehr gegen die eingedrungenen Fremdstoffe. Bei Krankheitserregern (Pathogenen) als Fremdstoffe kann die Bildung und Bindung von Antikörpern zur Immunität führen.
Antikörper werden von zu Effektorzellen differenzierten B-Zellen (=Plasmazellen) sezerniert. Sie kommen im Blut und in der extrazellulären Flüssigkeit der Gewebe vor. Sie "erkennen" meist nicht die gesamte Struktur des Antigens, sondern nur einen Teil desselben, die sogenannte antigene Determinante bzw. das Epitop.
Jeder Antikörper besteht aus zwei identischen schweren Ketten (heavy chains, H) und zwei identischen leichten Ketten (light chains, L), die durch kovalente Disulfidbrücken zu einer Ypsilon-förmigen Struktur miteinander verknüpft sind. Die beiden Leichtketten sind je nach Organismus und Immunglobulin-Subklasse entweder vom Typ kappa oder lambda und bilden zusammen mit den oberhalb der Gelenkregion (hinge region) liegenden Anteil der schweren Ketten das Antigenbindende Fragment Fab, welches enzymatisch mit Hilfe von Papain von dem darunterliegenden kristallinen Fragment Fc abgespalten werden kann. Die ausgesprochene Variabilität der Antikörperbindungsstellen (abgekürzt CDR, Complementarity Determining Region) erreicht der Organismus über die V(D)J-Rekombination.
Die V(D)J-Rekombination
Die V(D)J-Rekombination (wird auch als somatische Rekombination bezeichnet) ist ein genetischer Umlagerungsprozess, der für die Variabilität und immer neue Varianten von antikörperproduzierenden Zellen (B-Zellen) sowie von T-Zell-Rezeptoren sorgt. Es handelt sich um eine komplizierte Rekombination, bei der die DNA-Abschnitte der Gene für die leichten und schweren Ketten der Antikörper und T-Zell-Rezeptoren neu und zufällig miteinander kombiniert werden, so dass in den variablen Bereichen der Antikörper neue antigenerkennende Proteinabschnitte erzeugt werden. Sie ist der wichtigste Bestandteil der Adaptiven Immunantwort.
Der Vorgang der V(D)J-Rekombination respektive der somatischen Rekombination: Die Antikörper bestehen grundlegend aus zwei langen (schweren) Ketten und zwei kurzen (leichten). Die schweren und leichten Ketten bestehen hierbei aus bestimmten Abschnitten, die wiederum aus kleinen, einzelnen DNA Segmenten (Exons) bestehen. Bei der Reifung von Antikörpern wird im Regefall jeweils ein Exon (bzw. Segment) aus jeweils einem Abschnitt mit den anderen zusammengefügt. So dass letztendlich ungefähr 1,92 Millionen Kombinationsmöglichkeiten vorhanden sind.
Antikörper als B-Zell-Rezeptoren
Membranständige Antikörper (als B-Zell-Rezeptoren (BCR) bezeichnet) können B-Zellen aktivieren, wenn sie durch Antigene quervernetzt werden. Die B-Zelle nimmt daraufhin den Immunkomplex durch Endocytose auf, verdaut das Antigen proteolytisch und präsentiert über MHC Klasse II-Moleküle kurze Fragmente davon (Peptide mit einer Länge von 8-12 Aminosäuren) auf ihrer Zelloberfläche. Wenn die präsentierten Fragmente dann von einer CD4-T-Zelle (T-Helferzellen) als fremd erkannt werden, stimuliert diese T-Zelle die B-Zelle, was weitere Reifungsprozesse (somatische Hypermutation, Klassenwechsel) sowie die Umwandlung der B-Zelle zur antikörpersezernierenden Plasmazelle oder zur Memory B-Zelle auslöst. Diese Reifungsprozesse finden innerhalb von Keimzentren in den sekundären lymphatischen Organen (Milz, Lymphknoten) statt und werden unter dem Begriff der Keimzentrumsreaktion zusammengefasst.
Wirkungsweisen von sezernierten Antikörpern
Sezernierte Antikörper wirken durch verschiedene Mechanismen:
- Die einfachste ist die Neutralisation von Antigenen. Dadurch, dass der Antikörper das Antigen bindet, wird dieses blockiert und kann beispielsweise seine toxische Wirkung nicht mehr entfalten, oder andere Wechselwirkungen des Antigens mit Körperzellen werden verhindert.
- Ein weiterer ist die Opsonisierung durch das Einhüllen von Krankheitserregern und Fremdpartikeln mit Antikörpern.
- Eine dritte Wirkungsweise ist, dass Antiköper das Komplementsystem über den klassischen Weg aktivieren.
- Antikörper, die an körpereigene Zellen binden, können NK-Zellen aktivieren, welche diese Zellen dann abtöten. Dieser Prozess wird auch als "Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity" (ADCC) bezeichnet.
Verschiedene Klassen (Isotypen) von Antikörpern
Es gibt im Körper fünf verschiedene Gruppen (Klassen) von Antikörpern. Die verschiedenen Isotypen kommen in verschiedenen Kompartimenten des Körpers vor und haben unterschiedliche Aufgaben:
IgA

- IgA wird auf allen Schleimhäuten der Atemwege, der Augen, des Magen-Darm-Trakts, des Urogenitaltrakts sowie über spezielle Drüsen rund um die Brustwarze von Müttern sezerniert und schützt dort vor Pathogenen (auch das Neugeborene). Sezerniertes IgA kommt in Form von Homo-Dimeren vor; die beiden Anteile sind durch das "Joining-Peptide" verbunden.
IgD
- IgD wird durch differentielles Spleißen der IgM/IgD-Prä-mRNA zusammen mit IgM als B-Zell Rezeptor (BCR) auf reifen, naiven (antigenunerfahrenen) B-Zellen membranständig coexprimiert.
- Es ist nur in geringen Mengen in sezernierter Form in Blut und Lymphe vorhanden, die Funktion ist unbekannt.
IgE
- IgE vermittelt den Schutz vor Parasiten, wie z.B. Würmern. Es wird durch Fc-Rezeptoren auf Mastzellen gebunden. Aus diesem Grund ist nahezu alles IgE membrangebunden, im Blut ist es praktisch nicht vorhanden. Bei Antigenkontakt wird es quervernetzt, was zur Ausschüttung von Histamin, Granzymen etc. durch die Mastzellen und Granulozyten führt. Diese töten den Erreger ab. Letztere wirken außerdem stark gefäßerweiternd und Permeabilitätserhöhend, was das Herankommen anderer Immunzellen erleichtert. Es wirkt außerdem muskelkontraktierend, was die Ausscheidung der Erreger über Lunge und Darm erleichtert.
- IgE ist ebenso an der allergischen Sofortreaktion beteiligt.
IgM

- IgM wird als erster Antikörper nach dem Kontakt mit Antigenen gebildet und zeigt die akute Infektionsphase einer Krankheit an. (z.B. Anti HBs IgM = gegen das Hepatitis B Virus gerichtete Antikörper der IgM-Klasse (Zeichen der aktiven Hepatitis B-Erkrankung)
- IgM ist ein Pentamer (Multimer) aus fünf Untereinheiten. Auch diese Untereinheiten sind durch das Joining Peptide verbunden.
- IgM ist nicht plazentagängig.
IgG

- IgG wird erst in einer verzögerten Abwehrphase (3 Wochen) gebildet und bleibt lange erhalten. Es zeigt eine durchgemachte Infektion an. (Bsp.: Anti HBs IgG = gegen das Hepatitis B-Virus gerichtete Antikörper der IgG-Klasse, Zeichen einer stattgefunden Hepatitis B-Erkrankung oder Impfung)
- IgG wird außerdem aktiv über das Blut und die Plazentaschranke in den Fötus transportiert und sorgt dort auch nachgeburtlich für einen ersten Schutz vor Infektionen (Nestschutz, Leihimmunität).
Anwendung von Antikörpern in der Medizin
Aus Tieren gewonnene Antikörper (Antiseren) werden als Therapeutikum für verschiedenste Zwecke eingesetzt. Ein wichtiges Beispiel ist die Verwendung als passiver Impfstoff.
Außerdem werden monoklonale Antikörper seit neuestem in der Medizin therapeutisch eingesetzt (Intravenöse Immunglobulingabe, IVIG). Hauptanwendungsgebiet ist die Hämatologie und Onkologie, daneben werden sie auch in der Behandlung von Autoimmunerkrankungen (z. B. bei Multipler Sklerose) wie der Rheumatoiden Arthritis (RA) eingesetzt. Hierbei erkennen diese Antikörper pro-inflammatorische Zytokine wie IL-1 oder TNF-a.
Antikörper können auch dazu benutzt werden bestimmte Stoffe im Körper ausfindig zu machen. Dazu hängt man an den Antikörper einen schwach radioaktiven Stoff. Wenn man den Antikörper nun darauf ausrichted, sich an einen bestimmten Stoff zu hängen, indem man die Antigen-Bindestelle entsprechend verändert, kann man durch Röntgenaufnahmen feststellen, wo der radioaktive Stoff sich genau befindet. Dies kann zum Beispiel dazu benutzt werden, Geschwülste im Körper ausfindig zu machen.
Früher war der konstante Teil der Antikörper noch murin (aus der Maus), was zu Abstoßungsreaktionen durch das Immunsystem führen konnte. Um dieses Problem zu umgehen, werden neuerdings sogenannte humanisierte Antikörper verwendet. Herkömmliche monoklonale Antikörper enthalten neben der die Spezifität gegen humane Antigene vermittelnden variablen Region immer noch Proteinbestandteile der Maus, die das menschliche Immunsystem möglicherweise als fremdartig abstößt. Mit Hilfe molekularbiologischer Verfahren werden deshalb die murinen Teile der konstanten Abschnitte entfernt und durch baugleiche konstante Teile menschlicher Antikörper ersetzt. Die konstanten Abschnitte der Antikörper spielen für die spezifische Bindung des monoklonalen Antikörpers keine Rolle. Der so entstandene monoklonale Antikörper wird als „humanisierter monoklonaler Antikörper" bezeichnet und wird vom Immunsystem des Menschen nicht mehr abgestoßen. Humanisierte Antikörper werden in einer Kultur aus Hamster-Ovarialzellen hergestellt, weshalb ihre Produktion sehr viel aufwendiger und deshalb auch teurer als die Produktion in Mikroorganismen ist.
Die hohe Spezifität, mit der Antikörper ihr Antigen erkennen, macht man sich in der Biologie und der medizinischen Diagnostik zu Nutze, um ein Antigen sichtbar zu machen. Es wird folgendermaßen vorgegangen: Zunächst muss das Antigen, gegen das der Antikörper gerichtet sein soll, ausgewählt und produziert werden. Dies kann auf verschiedene Weisen erreicht werden, zum Beispiel, indem ein Peptid in vitro synthetisiert wird oder das Protein als ganzes rekombinant in Bakterien hergestellt wird. Anschließend wird das Protein einem Tier injiziert, dessen Immunsystem dann Antikörper gegen das Protein bildet. Als Antikörper-Produzenten werden besonders Mäuse und Kaninchen, aber auch Ziegen, Schafe und Pferde verwendet. Die Immunisierung wird mehrfach wiederholt. Nach ein paar Wochen können die Antikörper aus dem Blut der immunisierten Tiere gewonnen werden und z.B. für die Immunhistochemie (Pathologie), die mikrobiologische Diagnostik (ELISA) oder anderes (Schwangerschaftstest, ELISPOT, FACS, SEREX) verwendet werden.
Zytokine
Ein Zytokin ist ein Glykoprotein das regulierend in die Aktivität, Proliferation und Differenzierung bestimmter Körperzellen eingreift. Zu den Zytokinen zählen z.B. Wachstumsfaktoren und Entzündungsmediatoren. Einige Zytokine werden heute kommerziell als rekombinante Proteine produziert. Man unterscheidet im Wesentlichen vier Hauptgruppen von Zytokinen:
Interferone (IFN)
Interferone werden von Leukozyten, Fibroblasten und T-Lymphozyten gebildet und haben eine immunstimulierende, vor allem einen antivirale und antitumorale Wirkung. Interferone werden auch als Medikamente eingesetzt, z.B. zur Behandlung chronischer Virushepatitiden. Nebenwirkungen sind hier unter anderem als ausgeprägte grippeähnliche Symptome möglich.
Interleukine (IL)
Interleukine dienen der Kommunikation der Leukozyten untereinander.
Koloniestimulierende Faktoren (CSF)
Hierbei handelt es sich um Wachstumsfaktoren der Blutzellen. Beispiele sind Erythropoetin (Erythrozyten) und G-CSF, Granulozyten-Koloniestimulierender Faktor). Therapeutische Einsatzmöglichkeiten bestehen bei der Niereninsuffizienz, bei Knochenmarkschäden nach Chemotherapie oder beim Myelodysplastischen Syndrom (MDS).
Tumornekrosefaktoren (TNF)
Zytokinrezeptoren
Die Rezeptoren für Zytokine lassen sich in 7 Gruppen unterteilen:
- Die Hämatopoetin-Rezeptorfamilie, Rezeptoren für IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-9, IL-11, L-12,IL-13, IL-15, EPO, TPO, LIF, G-CSF, GM-CSF
- Die Interferon-Rezeptorfamilie, Rezeptoren für IFNa/b, IFNg, IL-10
- Die TNF-Rezeptorfamilie (death receptors), Rezeptoren für TNF-alpha, TNF-beta, FasL, CD27, CD30, CD40 (Trimere Rezeptoren)
- Die Immunglobulin(Ig)-Superfamilie-Rezeptoren, Rezeptoren für IL-1a, IL-1b (aber auch BCR, TCR, MHC u.a.)
- Die Tyrosinkinase-Rezeptoren, Rezeptoren für M-CSF, SCF
- Ras/Raf-pathway
- Jak/STAT-pathway
- Die Serin-/Threoninkinase-Rezeptoren, Rezeptoren für TGFb u.a.
- Die Chemokin-Rezeptoren (7TMHR)
Interferone
IFN ist ein Protein oder Glykoprotein, das eine immunstimulierende, vor allem antivirale und antitumorale Wirkung entfaltet. Es wird als körpereigenes Gewebehormon v.a. von Leukozyten, Fibroblasten und T-Lymphozyten gebildet.
Interferon-alpha
- "Leukozyten-IFN", früher Typ I
- Struktur: Protein aus 150-172 Aminosäuren; 23 bekannte Varianten, die meisten davon sind nicht glykosyliert
- Bildung: Alpha-Interferon wird von Monozyten gebildet, die von Viren befallen sind oder Kontakt mit bösartigen Zellen gehabt haben.
- Antivirale Wirkung: Interferon aktiviert umliegende virusinfizierte sowie nichtinfizierte Zellen. In diesen Zellen werden folglich Proteine gebildet welche a) eine weitere (Virus-)Proteinsynthese in jenen Zelle hemmen und b) den Abbau von viraler und zellulärer RNA bewirken. Vermehrt werden MHC-Klasse-I-Moleküle sowie Proteasen gebildet, welche virusinfizierte Zellen durch T-Lymphozyten leichter angreifbar machen. Interferon alpha aktiviert NK-Zellen (natürliche Killer-Zellen dienen der Virus- und Tumorabwehr).
- Therapeutischer Einsatz : Interferon-alpha wird seit mehreren Jahren zur Therapie der akuten und chronischen Hepatitis-B- sowie zur Therapie der chronischen Hepatitis C-Infektion eingesetzt. Therapeutisch kommt bei diesen Erkrankungen das Interferon-alpha-2b zum Einsatz, das dreimal die Woche subkutan injiziert wird. Mittlerweile sind leicht veränderte, sogenannte pegylierte Interferone erhältlich (das Interferon wird mit einem verzweigten Polyethylen-Glykol-(PEG)-Molekül versehen), die aufgrund einer längeren Halbwertszeit nur einmal pro Woche verabreicht werden müssen. Neben dem therapeutischen Einsatz der alpha-Interferone in der Therapie der Virushepatitis werden Interferone dieser Gruppe auch in der onkologischen Therapie eingesetzt und zwar zur Therapie der Haarzellen-Leukämie, dem kutanen T-Zell-Lymphom sowie dem Kaposi-Sarkom. Die antitumorale Wirksamkeit der alpha-Interferone beruht zum einen auf einer antiproliferativen Wirkung, d.h. die Tumorzellen werden in ihrer gesteigerten Teilungsaktivität gehemmt und zum anderen sowohl auf der Aktivierung von natürlichen Killerzellen, die Tumorzellen selbst abtöten können als auch in der Differenzierungsinduktion.
Interferon-beta
- "Fibroblasten-IFN", früher Typ I
- Struktur: Glykoprotein aus 166 Aminosäuren; nur eine Variante
- Bildung: IFN-beta wird von virusinfizierten Fibroblasten und vermutlich auch von allen anderen Zellen gebildet. Siehe Interferon-alpha.
- Antivirale Wirkung: Interferon-beta bindet an den gleichen Rezeptor wie Interferon-alpha. Siehe Interferon-alpha
- Einsatz als Medikament: Behandlung der Multiplen Sklerose und schwerer Viruserkrankungen.
Interferon-gamma
- "Immun-IFN", früher Typ II
- Struktur: IFN-gamma ist Glykoprotein aus 146 Aminosäuren und liegt in aktiver Form als Heterodimer vor.
- Bildung: TH1-Zellen (Subpopulationen sowohl CD4+ als auch CD8+, Teil der adaptiven Immunabwehr) bilden IFN-gamma nach Kontakt mit einem Makrophagen, welcher Bakterien phagozytiert hat.
- Aktivierende Wirkung auf Makrophagen:
- Bessere Verschmelzung von Phagosomen mit Lysosomen
- Produktion des bakterizidem Stickstoffmonoxid
- Bildung reaktiver Sauerstoffradikale
- Induktion antimikrobieller Peptide
- Einsatz als Medikament: Gegen Osteoporose, gegen Tumoren (mit z.Z. geringerem Erfolg)
Entwicklung
- 1957 Entdeckung durch den Briten Alick Isaacs und den Schweizer Jean Lindemann am National Institute for Medical Research in London.
- 1979 Im Labor von Charles Weissmann in Zürich gelingt die Übertragung von menschlichen Interferon-Genen in Bakterien. Damit wurde die Herstellung von reinem Interferon in beliebigen Mengen möglich
Weblink: http://www.biotechpropertyrights.uni-bremen.de/empirie/erfasste-sachverhalte/chronologien/interferon-beta/w00000729/w00000729.htm - Chronologie der Entwicklung
Zulassungen als Arzneimittel
| Datum | Handelsname | Wirkstoff | Hersteller | Indikation |
| 1983 | Fiblaferon® | IFN beta | Rentschler | Schwere Viruserkrankungen / 2003 SARS |
| 04/1987 | Roferon A® | IFN alpha-2a | Roche | Krebs |
| 12/1992 | Imukin® | IFN gamma-1b | Boehr. Ing. | Krebs |
| 11/1995 | Betaferon® | IFN beta-1b | Schering | Multiple Sklerose |
| 03/1997 | Avonex® | IFN beta-1a | Biogen | Multiple Sklerose |
| 05/1998 | Rebif® | IFN beta-1a | Serono | Multiple Sklerose |
| 02/1999 | Inferax® | IFN alphacon 1 | Yamanouchi | Hepatitis C |
| 03/2000 | Intron A® | IFN alpha-2b | Schering-Plough | Hepatitis B/C |
| 02/2002 | PegIntron® | pegyliertes IFN alpha-2b | Schering-Plough | Hepatitis C |
| 06/2002 | Pegasys® | pegyliertes IFN alpha-2a | Roche | Hepatitis B/C |
Interleukine
Interleukinewerden in mehrere Untergruppen unterteilt, welche durch Zahlen gekennzeichnet werden (IL-1 bis IL-32; Stand Oktober 2005). Jedes Interleukin moduliert das Wachstum, die Differenzierung und die Aktivierung bestimmter Immunozyten.
Interleukin-1
IL-1 wird von Makrophagen gebildet und wirkt proinflammatorisch. Es lagert sich u.a. an Chondrozyten an und bewirkt die Freisetzung knorpelzerstörender Enzyme. Dadurch kommt es zum Abbau von Knorpelsubstanz und letztendlich zur Zerstörung der Gelenke. Im Bereich der Orthopädie wird seit etwa 1998 eine Therapie mit einem IL-1-Antagonisten betrieben, der aus körpereigenem Blut gewonnen wird und in angereichter Form in ein erkranktes Gelenk injiziert wird. Die bislang durchgeführten Studien deuten eine Therapieoption bei Frühformen der Arthrose an.
Bei schizophrenen Patienten konnten veränderte Interleukin-1 Werte im Blut, im Liquor sowie im präfrontalen Cortex festgestellt werden.
Interleukin-2
IL-2 ist therapeutisch eines der wichtigsten Interleukine. Es wird bei Immunreaktionen auslösenden, malignen Tumoren ausgeschüttet und bewirkt die Produktion von T-Helfer-Zellen. Außerdem interagiert es mit spezifischen Oberflächenrezeptoren auf Lymphozyten und aktiviert unspezifische zytotoxische Effektorzellen. Interleukin-2 ist ein Wachstumsfaktor für Lymphozyten und an der Reifung und Differenzierung von Thymozyten, B-Lymphozyten, Monozyten, Makrophagen und epidermalen dendritischen Zellen und NK-Zellen beteiligt.
Interleukin-3
IL-3 wirkt auf die Stammzellen im Knochenmark und wird zur Stimulation der Blutbildung nach einer Chemotherapie, nach Knochenmarks- oder Stammzelltransplantation eingesetzt.
Interleukin-4
IL-4 agiert (so wie IL-10 und IL-11) als sog. anti-inflammatorisches Zytokin, indem es überschießende Entzündungsreaktionen verhindert und somit wichtig für die Homöostase des Immunsystems ist. Außerdem stimuliert IL-4 die B-Zellaktivierung und die IgE-Produktion.
Interleukin-5
IL-5 wirkt positiv chemotaktisch auf eosinophile Granulozyten und steigert die Synthese und Sekretion von Immunglobulin A durch Plasmazellen.
Interleukin-6
IL-6 bewirkt in der Leber die vermehrte Synthese von Akute-Phase-Proteinen. Es werden sowohl pro- als auch antiinflammatorische Effekte diskutiert. Es wird vor allem von Monozyten/Makrophagen, aber auch von Epithel- und Endothelzellen sezerniert und besitzt eine prognostische Bedeutung in der Beurteilung von Trauma und Sepsis.
Interleukin-7
IL-7 wird von Stromazellen der lymphatischen Organe produziert und stimuliert das Wachstum von Vorläuferzellen der B- und T-Lymphozyten.
Interleukin-8
IL-8 ist ein Chemokin der CXC Familie und wird unter anderem durch Endothelzellen, Monozyten, Epithelzellen und Fibroblasten produziert. Ein wichtiger Angriffspunkt des Chemokins sind neutrophile Granulozyten. Die wesentlichen biologischen Wirkungen von IL-8 auf Granulozyten beinhalten die Förderung der Chemotaxis, die Stimulation der Expression von Adhäsionsmolekülen und die Aktivierung mit Freisetzung von Sauerstoffradikalen und Granula.
Interleukin-10
IL-10 agiert (so wie IL-4 und IL-11) als sog. anti-inflammatorisches Zytokin, indem es die Makrophagenfunktion hemmt und somit überschießende Entzündungsreaktionen verhindert. Gebildet wird es vor allem von TH2-Zellen sowie regulatorischen T-Zellen.
Interleukin-11
IL-11 agiert (so wie IL-4 und IL-10) als sog. anti-inflammatorisches Zytokin, indem es überschießende Entzündungsreaktionen verhindert und somit wichtig für die Homöostase des Immunsystems ist.
Interleukin-12
IL-12 besitzt eine zentrale Funktion in der Anstoßung und Fortdauer einer TH-1-Immunantwort und hat einen Einfluss den Verlauf von intrazellulären Infektionen [3]. Neuere Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass ILn-12 auch Enzyme aktivieren kann, welche dann in der Lage sind, geschädigte Erbsubstanz schneller wieder zu reparieren [4]. Eine weitere nachgewiesene Wirkung von IL-12 besteht darin, dass es die Möglichkeit von T-Killerzellen fördert, in einen Tumor einzudringen und ihn zu zerstören.
Interleukin-13
IL-13 wird von T-Lymphozyten produziert und stimuliert die Bildung und Differenzierung von B-Lymphozyten. Weiterhin inhibiert IL-13 die Aktivierung von Makrophagen.
Interleukin-16
IL-16 scheint eine Rolle bei der Rheumatoiden Arthritis zu spielen.
Interleukin-18
IL-18 konnte in erhöhter Konzentration in der Synovia von Patienten mit rheumatoiden Arthritis nachgewiesen werden.
Interleukin-23
Bei vielen Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise der rheumatoiden Arthritis, der Multiplen Sklerose, Morbus Crohn und der Psoriasis kann IL-23 die Bildung von T-Zellen stimulieren, die sich anschließend gegen den eigenen Körper richten [5]. Außerdem kann es die indirekt tumorzerstörende Wirkung von Interleukin-12 behindern.
Einsatz als Therapeutikum
Bei einer Immuntherapie oder Immunmodulation mit Interleukin (i.d.R. IL-2) wird versucht die Immunantwort des Organismus gegen maligne Tumoren oder eine Infektion (bspw. bei HIV) zu stimulieren.
Meist werden bei der Behandlung maligner Tumore (Nierenzellkarzinom, malignes Melanom) Kombinationspräparate von IL und anderen Mitteln eingesetzt, wie beispielsweise IFN und/oder Zytostatika. Die Nebenwirkungen bei einer Therapie mit IL können erheblich sein, beispielsweise Fieber, Müdigkeit, Exantheme, Herzrasen, Ödeme.
Häufiger und erfolgreich angewendet werden sogenannte "Anti-IL" bei Morbus Crohn und vor allem bei autoimmunbedingten rheumatischen Erkrankungen.
Tumornekrosefaktoren
Zur Familie der Tumornekrosefaktoren (TNF) gehören u.a. TNF-alpha und TNF-beta. Der erste Tumornekrosefaktor (TNF-α) wurde 1893 indirekt von William Coley entdeckt.
TNF-α
TNF-α (Kachektin) wird von Makrophagen/Monozyten sowie Lymphozyten und Mastzellen gebildet und ist ein Mediator, der auf Entzündungsprozesse, Blutbildung, Immunsystem, Angiogenese und Tumore einwirkt. Dabei ist er in seiner Wirkungsweise dem IL-1 sehr ähnlich. Im Hypothalamus stimuliert es die Freisetzung des Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH), löst Fieber aus und unterdrückt den Appetit (daher die von "Kachexie" abgeleitete Namensgebung). In der Leber setzt es das C-reaktive Protein (CRP) frei.
TNF-β
TNF-β (Lymphotoxin) wird nur von bestimmten T-Zellen sezerniert. TNF-β aktiviert dann Makrophagen, die infolge IL-1, IL-6 und TNF-α produzieren. TNF-β hat eine toxische Wirkung auf einige Tumorzelllinien.
Einsatz als Therapeutikum
Die Möglichkeiten Tumornekrosefaktoren therapeutisch zu verwerten sind vor allem durch die kurze Halbwertszeit dieser Stoffe beschränkt. TNF-α hemmende Medikamente werden vor allem in der Rheumatherapie eingesetzt. Diese Medikamente sind relativ neu und vielversprechend.
Reifung und Alterung des Immunsystems
Im Thymus, der Reifungsstätte der T-Zellen, differenzieren sich T-Zellen in die verschiedenen Typen wie CD4- und CD8-Zellen. Anschließend werden sie mit körpereigenen Substanzen konfrontiert. Wenn eine T-Zelle einen dazu passenden Rezeptor trägt und an die körpereigene Struktur bindet, stirbt die T-Zelle ab (negative Selektion). Dadurch wird sichergestellt, dass gereifte T-Zellen im Körper nur fremdartige Moleküle attackieren. Alle Mechanismen, die dafür Sorge tragen, dass sich das Immunsystem nicht gegen den eigenen Organismus wendet, werden unter dem Oberbegriff der Selbsttoleranz zusammengefasst. Ebenso findet eine positive Selektion statt. Nur T-Lymphozyten, die MHC-Fremdantigen-Komplexe richtig erkennen überleben.
Der Organismus von Säuglingen ist erst ab dem ca. 6.-8. Lebensmonat in der Lage, wirkungsvoll T-Zellen zu differenzieren. Diaplazentar (IgG) und auch über die Muttermilch (IgA) werden Antikörpern auf das Kind übertragen, um es bis dahin besser vor Krankheiten zu schützen (Leihimmunität, Nestschutz). Die Leihuimmunität ist auch der Grund, warum Lebendimpfungen (die Impfstämme müssen sich dazu im Impfling vermehren können) erst nach dieser Frist wirksam sind.
Ab der Pubertät atrophiert der Thymus, das Thymusgewebe wird größtenteils durch Fett ersetzt.
Immunologische Konstellationen
Die lokale Entzündungsreaktion
Eine Entzündung ist eine Gewebsabwehrreaktion.
Ursachen: Eine Entzündung kann durch Mikroorganismen (bakteriell eher eitrige, d.h. granulozytäre Entzündung, viral eher seröse, lymphoplasmazelluläre Entzündung) und durch mechanische, thermische, chemische oder durch ionisierende Strahlen verursachte Schäden ausgelöst werden.
Ablauf:
- Schädigung
- Gefäßreaktion, erhöhte Gefäßpermeabilität (Schwellung), Thrombosierung (Auskopplung vom Blutkreislauf), Ausschüttung von Entzündungsmediatoren und Zytokinen (Chemotaxis), Änderung der Genexpressionsmuster (Transkriptionsfaktor NF-κB)
- Granulo-monozytäre Reaktion (angeborenes Immunsystem)
- Lympho-plasmazelluläre Reaktion (adaptives Immunsystem) und Bildung von Granulationsgewebe (Fibroblasteneinwanderung, Angiogenese)
- Kollagenfaserbildung, Vernarbung
Die 5 klassischen Entzündungszeichen sind die Rötung (rubor), die Schwellung (tumor), die Überwärmung (calor), der Schmerz (dolor) und die Funktionseinschränkung (functio laesa).
Die systemische Entzündungsreaktion
Im Rahmen von größeren Gewebsschädigungen (z.B. Verletzungen, Operationen, Infektionen) kommt es zu einer unspezifischen Immunreaktion (Akute-Phase-Reaktion, SIRS). Endothelzellen, Fibroblasten und Entzündungszellen wie z.B. Makrophagen im geschädigten Gewebe setzen dabei Mediatoren frei, z.B. IL-1, IL-6, TNF-alpha, TGF-beta, IFN-gamma, EGF, LIF u.a., die über die Blutbahn die Leber erreichen. Dort stimulieren sie in Anwesenheit von Cortisol die Leber zur vermehrten Synthese der etwa 30 verschiedenen Akute-Phase-Proteine. Ihre Konzentration nimmt innerhalb von 6-48 Stunden nach dem schädigenden Ereignis auf das zwei- bis eintausendfache zu.
Funktionen der Akute-Phase-Reaktion:
- Lokalisierung der Entzündung
- Verhinderung der Ausbreitung
- Unterstützung des Immunsystems bei der Sanierung des Entzündungsherdes

Akute-Phase-Proteine
- Fibrinogen steigert die Gerinnungsneigung. Dadurch wird eine lokale Thrombusbildung im Entzündungsgebiet forciert und Erreger werden nicht weiter in die Blutbahn ausgeschwemmt.
- alpha1-Antitrypsin und alpha-Antichymotrypsin wirken den vermehrt freigesetzten Proteasen entgegen und reduzieren so die Entzündungsbedingte Gewebsschädigung.
- C-Reaktives-Protein bindet sich vermutlich an Erreger und dient der Opsonisierung und Aktivierung des Komplementsystems. Klinisch ist es der wichtigste Entzündungsparameter in der Labordiagnostik.
- saures Alpha1-Glykoprotein fördert Fibroblastenwachstum und interagiert mit Kollagen
- Haptoglobin ist für die Hämoglobinbindung und den -transport zuständig
- Coeruloplasmin hemmt die Bildung freier Sauerstoffradikale
- Komplement-C3 fördert die Opsonierung und Chemotaxis und ist für die Komplementkaskade wichtig.
- Plasminogen ist ein fibrinolytisches Peptid bzw. dessen Vorstufe.
- Transferrin und Albumin sind "Negativ-Akute-Phase-Proteine", d.h. ihre Serumkonzentration sinkt ab.
Autoimmunerkrankungen
Bei Autoimmunerkrankungen ist das üblicherweise sehr gut ausbalancierte Gleichgewicht zwischen potentiell autoreaktiven T-Zellen und regulatorischen T-Zellen gestört. Das Immunsystem richtet sich gegen körpereigene Strukturen.
Einige Beispiele für Autoimmunerkrankungen sind:
- Diabetes Typ I - Reaktion gegen Insulin produzierende B-Inselzellen des Pankreas
- Rheumatoide Arthritis - Reaktion gegen Synovialschleimhaut
- Multiple Sklerose - Reaktion gegen die Myelinscheiden im zentralen Nervensystem
Allergisch-hyperergische Reaktionen
Als eine Allergie (griechisch αλλεργία „die Fremdreaktion“, von άλλος „anders, fremd“ und έργον „die Arbeit, Reaktion“) wird eine überschießende und unerwünschte heftige Abwehrreaktion des Immunsystems auf bestimmte und normalerweise harmlose Umweltstoffe (Allergene) bezeichnet, auf die der Körper mit Entzündungszeichen und der Bildung von Antikörpern reagiert (Antigen(Allergen)-Antikörper-Reaktion).
Die konkrete Bezeichnung Allergie wurde 1906 von Freiherr Clemens von Pirquet, einem Wiener Kinderarzt, geprägt.
Überempfindlichkeitsreaktionen: Arten und Definitionen
Überempfindlichkeitsreaktionen sind inadäquate immunologische Reaktionen gegenüber hamlosen "Fremd"-Substanzen. Man unterscheidet:
- Echte Allergie: Unter Beteiligung des Immunsystems, insbesondere der Antikörper.
- Pseudoallergie: Ohne Beteiligung des Immunsystems, aber unter dem Einfluss von Histamin und anderen Mediatoren, die auch bei Immunreaktionen auftreten, z. B. Histaminose nach Rotwein- oder Käsegenuss.
- Intoleranz (auch unscharf Unverträglichkeit genannt): Vergiftungsymptome bei an sich normaler Dosierung oder Konzentration eines Stoffes wegen unzureichender Verarbeitung zugeführter oder freigesetzter Substanzen, ohne Beteiligung von Immunsystem oder Mediatoren, aber vermutlich mit Komplementaktivierung und / oder übermäßig labilen Zellmembranen von Mastzellen und basophilen Granulozyten oder Stoffwechselstörungen der Arachidonsäure. Beispiele sind die Zöliakie/einheimische Sprue und die klinisch wichtige Analgetika-Intoleranz.
Handelt es sich bei einer Intoleranz ursächlich um ein falsch oder zu wenig gebildetes Enzym, so spricht man auch von einer Idiosynkrasie. Beispiel ist die Alkoholintoleranz durch ALDH-Mangel (Asiaten, sporadisch).
Klinische Einteilung der Überempfindlichkeitsreaktionen
Die folgende Einteilung nach Coombs und Gell von 1963 lässt unterscheidet vier Typen. In der Realität bestehen vielfach Mischformen:
Typ I, Soforttyp
Anaphylaxie (häufigster Typ): Innerhalb von Sekunden oder Minuten vermitteln zellständige IgE-Antikörper die Freisetzung diverser Mediatoren wie Histamin, aber auch Prostaglandine und Leukotriene aus den basophilen Granulozyten und Mastzellen.
Typische Erkrankungen sind die Urtikaria, die allergische Konjunktivitis, der Heuschnupfen und das allergische Asthma; aber auch das angioneurotische Ödem und der anaphylaktische Schock sind Soforttyp-Reaktionen.
Eine etwas verzögerte zweite Reaktion kann nach bis zu sechs Stunden auftreten.
Typ II, Zytotoxischer Typ
Innerhalb von Stunden (bis zu zwölf) bilden zellständige Antigene (also aufgenommene Fremdsubstanzen wie gewisse Medikamente oder transfundiertes Blut) Immunkomplexe mit körpereigenen, im Blutstrom kreisenden IgG-Antikörpern; diese aktivieren zytotoxische Killerzellen und Komplement, daraufhin kommt es zur Zerstörung (Lyse) körpereigener Zellen.
Typische Erkrankungen sind die medikamentös-induzierte Thrombopenie und Agranulozytose (selten) sowie die hämolytische Anämie nach Transfusionszwischenfall (selten).
Typ III, Immunkomplex- oder Arthus-Typ
Innerhalb von Stunden bilden sich hier zellständige oder freie Antigen-Antikörper-Komplexe mit Stimulation der Komplementkaskade, der Phagozytose und Mediatorfreisetzung.
Typische Erkrankungen sind chronische Vaskulitiden, die so genannte Farmer-Lunge, die Serumkrankheit und die Aspergillose.
Typ IV, Spättyp, verzögerter Typ
Nach einem halben bis drei Tagen setzen sensibilisierte T-Lymphozyten chemotaktische Lymphokine frei, die lokal zur Entzündung führen. Der Typ IV ist die einzige zellvermittelte Reaktion.
Typische Erkrankungen/Phänomene sind die Kontaktallergie/-ekzem, die Abstoßungsreaktion nach Transplantation, das Arzneimittelexanthem, aber auch die Tuberkulinreaktion bei Verdacht auf Tuberkulose.
- ↑ Fuchs TA et al. “Novel cell death program leads to neutrophil extracellular traps”. J Cell Biol, Jan 8 2007. DOI:10.1083/jcb.200606027. PMID:17210947
- ↑ Puellmann K et al. “A variable immunoreceptor in a subpopulation of human neutrophils”. Proc Natl Acad Sci U S A, 103(39):14441-6, Sep 26 2006. Epub Sep 18 2006. DOI:10.1073/pnas.0603406103. PMID:16983085
- ↑ http://hepatitis-c.de/il12.htm
- ↑ Nature Cell Biology, Bd. 4, S. 26
- ↑ http://www.unipublic.unizh.ch/magazin/gesundheit/2005/1571.html
Allgemeines
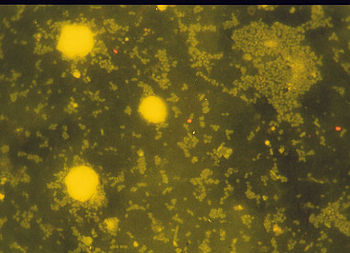
Je nach Fragestellung und Verdachtsdiagnose werden Blutkulturen, Urin, Stuhl, Liquor, Hautgeschabsel, Haare, Rachenabstrich, Wundabstrich, Sputum o.a. zur mikrobiologischen Untersuchung versandt. Bei der Probenentnahme und dem Versand müssen bestimmte Regeln beachtet werden. Damit der Mikrobiologe eher fündig wird sollten ein paar kurze klinische Angaben nicht fehlen.
Testverfahren Bakteriologie, Mykologie und Parasitologie
Mikroskopie
Lichtmikroskope bieten meist die Vergrößerung 40x, 100x und 400x. Diese ergibt sich als Produkt aus dem Vergrößerungsfaktor des Okulars (meist 10x) und des Objektivs (meist 4x, 10x und 40x). Mit speziellen 100x Objektiven ist zusammen mit der Verwendung von Immersionsöl eine 1000fache Vergrößerung möglich.
Bakterien werden üblicherweise in 400 bis 1000facher Vergrößerung angesehen.
Deckglaspräparat
Mit dem Deckglaspräparat können Mikroorganismen nativ, also in natura betrachtet werden.
Tuschepräparat

Das Tuschepräparat dient der Darstellung von Bakterienkapseln (z.B. Klebsiellen, Pneumokokken) oder Pilzkapseln (Cryptococcus sp). Die Kapsel färbt sich nicht an und bildet einen hellen Ring. Das Präparat kann auch hitzefixiert und mit Safranin gegengefärbt werden.
Mikroskopische Färbungen
Zur morphologischen Darstellung und Speziesdifferenzierung können verschiedene Färbungen durchgeführt werden.
Vorbehandlung: Mit einer in der Bunsenbrennerflamme sterilisierten Öse wird das Material auf den Objektträger aufgebracht und trocknen gelassen. Danach wird der Objektträger zur Hitzefixierung mehrmals mit der Probe nach oben durch die Flamme gezogen.


Gram-Färbung
Die Gram-Färbung ist eine Standardfärbung zur Beurteilung der Morphologie (Kokken, Stäbchen, Haufen, Ketten usw.) und des differentialdiagnostisch wichtigen Gram-Verhaltens.
Technik: Die Bakterien werden mit Kristallviolett für 30 Sekunden gefärbt und mit Lugolscher Lösung (Jod-Kalium-Lösung) für eine Minute gebeizt. In der bakteriellen Zellwand entsteht nun ein Jod-Farbstoff-Komplex ("Farblack"). Das vorsichtige, tropfenweise Entfärben (Differenzieren) mit Alkohol löst aus den dünnwandigen Gram-negativen Bakterien den Farbstoff viel stärker wieder heraus als aus der dicken Mureinhülle Gram-positiver Bakterien. Danach spült man gut mit Wasser, färbt mit Safranin (30 Sekunden) gegen, spült noch einmal und trocknet das Präparat.
Ergebnis: Gram-positive Bakterien erscheinen nach der Färbung blau-violett, Gram-negative rot-rosa.
Giemsa-Färbung
Mit der Giemsa-Färbung können u.a. Protozoen dargestellt werden. Das Färberesultat kann je nach verwendeten Reagenzien, Färbedauer und Fixierungstechnik unterschiedlich ausfallen.
Neisser-Färbung
Die Neisser-Färbung ist eine Standardfärbung zur Beurteilung von Corynebakterien, z.B. dem Corynebacterium diphtheriae.
Technik: Das Präparat wird 1 Minute mit Neisser I (Methylenblau, Kristallviolett, Ethanol) behandelt, die Farbe abgegossen (nicht gespült) und dann mit Neisser II (Chrysoidin- oder Bismarkbraunlösung) für 1 Minute gefärbt, die Farbe abgegossen (nicht gespült) und das Präparat zwischen Filterpapier getrocknet.
Ergebnis: Die meist terminal angeordneten aus Calcium und Polyphosphaten bestehenden metachromatischen Polkörperchen färben sich schwarz-blau und heben sich vom gelb-braun gefärbten Rest der Bakterienzelle ab.
Kinyoun-Färbung
Die Kinyoun-Färbung ist eine Standardfärbung zur Identifizierung von säurefesten Bakterien, die z.B. bei Befall mit Mycobacterium tuberculosis auftreten. Die Säurefestigkeit kommt durch einen hohen Anteil von sauren Lipiden und Wachsen in der Zellwand zustande.
Technik: Die hitzefixierten Präparate werden 2 Minuten mit Karbolfuchsin behandelt, gespült, mit Salzsäurealkohol entfärbt und nochmals gespült. Danach erfolgt die Gegenfärbung mit Methylenblau für 20-30 Sekunden. Das Präparat wird wieder mit Wasser gespült und zwischen Filterpapier getrocknet.
Ergebnis: Säurefeste Stäbchen heben sich leuchtend rot vom blauen Hintergrund ab.
Ziehl-Neelsen-Färbung

Wie mit der Kinyoun-Färbung können auch mit der Ziehl-Neelsen-Färbung säurefeste Bakterien dargestellt werden.
Sporenfärbung nach Schaeffer-Fulton
Mit der Sporenfärbung nach Schaeffer-Fulton werden Sporen dargestellt. Bakterien und Sporen werden aggressiv gefärbt und die vegetativen Formen entfärbt. Der Kontrast wird durch Gegenfärbung mit Safranin erhöht.
Technik: Das Präparat wird für 2 Minuten in heißer Malachitgrün-Lösung gefärbt, danach gründlich mit Wasser gespült und mit Safranin für 1 Minute gegengefärbt. Das Präparat wird dann zwischen Filterpapier getrocknet.
Kapselfärbung nach MANEVAL
Durchführung: Kongorot und Bakterien mischen, Ausstrich herstellen, lufttrocknen, abspülen mit MANEVAL`scher Lösung und 5-6 min einwirken lassen, vorsichtig mit Aqua dest. abspülen.
Prinzip: MANEVAL`scher Lösung (enthält Fuchsin, das färbt die Bakterien; FeCl3 und Phenol zur Festigung der Kapsel; Essigsäure oder verdünnte HCl zur Senkung des pH-Wertes). Kongorot ist der pH-Wert-Indikator und färbt sich bei saurem blau.
Ergebnis: Hintergrund blau, Kapsel weiß, Bakterien rot.
Kultur
Ziele der Kultur sind die Spezieseinordnung und die Gewinnung von Reinkulturen für weitere Untersuchungen.
Kulturformen
Primärkulturmedien dienen der Erstkultur aus dem Untersuchungsmaterial.
Anreicherungsmedien sind optimal auf das Wachstum einer bestimmten Keimart abgestimmt, um diese zu vermehren.
Spezialnährmedien dienen dem Anzüchten von Keimen, die auf bestimmte Wachstumsbedingungen angewiesen sind.
Selektivnährmedien enthalten zusätzlich Stoffe, die unerwünschten Begleitkeime hemmen und/oder das Wachstum des gesuchten Keims fördern.
Indikatormedien dienen zum Anzüchten einer Keimart mit gleichzeitiger Prüfung ihrer biochemischen Leistungen.
Anlegen und Bebrüten einer Kultur
3-Ösen-Ausstrich
Um Bakterien zu isolieren werden diese auf Agar mit dem 3-Ösenausstrich vereinzelt und das Wachstum der colony forming units (CFU) abgewartet. Technik: Mit der ausgeglühten und abgekühlten Öse wird etwas Material von der Probe entnommen und im Zick-Zack vom Rand zur Mitte auf einem Drittel der Agar-Oberfläche verteilt. Die Öse wird wieder ausgeglüht und nach Abkühlen zieht man sie einmal durch das bereits beimpfte Feld und dann im Zick-Zack über das zweite Drittel des Nährbodens. Nach Ausglühen wird in analoger Weise das letzte Drittel beimpft, nachdem man die Impföse einmal durch das zweite Drittel gezogen hat.
Im Gegensatz dazu wird beim konfluenten Ausstrich der gesamte Agar gleichmäßig beimpft.
Kulturbedingungen
Bakterien haben unterschiedliche Ansprüche. Wichtige Faktoren sind die Temperatur, der O2 und CO2-Gehalt der Luft und die Beschaffenheit des Nährmediums (Glucose-, NaCl-, Blut-, Serum-, Fleischextraktgehalt). Einige Bakterien benötigen zur Pigmentbildung Licht.
Kultur auf Agar
Kriterien zur Beurteilung der Kolonien auf festen Nährmedien sind die Größe und Oberfläche der Kultur, das Hämolyseverhalten, die Farbstoffbildung und Farbveränderungen bei Indikatorzusatz.
Blut-Agar

Beurteilen lassen sich hier die Morphologie der Kolonien und das Hämolyse-Verhalten.
- α-Hämolyse - Unvollständige Hämolyse: Um die Kolonien finden sich im Hämolysehof mehr oder weniger farbige Zwischenprodukte des Hämabbaus.
- β-Hämolyse - Vollständige Hämolyse: Um die Kolonien befindet sich ein farbloser Hof, das Häm ist vollständig abgebaut.
- γ-Hämolyse - keine Hämolyse
- Doppel-Hämolyse - Zwei im Agar verschieden schnell wanderende hämolytische Toxine führen zu Doppelringen (bei Clostridium perfringens).
MacConkey-Agar
Der MacConkey-Agar ist ein Selektivnährboden für gramnegative Stäbchen.
Leifson-Agar
Der Desoxycholat-Citrat-Agar nach Leifson dient zur Differenzierung coliformer Keime, da es sich um einen Selektivnährboden bzw. Differenzialnährboden handelt. Er wird vor allem für die Diagnostizierung der Gattungen Salmonella und Shigella genutzt.
Tinsdale-Agar (Natriumtellurit-Agar)
Auf diesem Indikatormedium bilden Corynebakterien schwarze Kolonien durch Reduktion des metallischen Tellur. In höheren Konzentrationen unterdrückt Tellurit auch das Wachstum anderer Bakterien der Rachenflora. Weitere Bakterien die Tellurit reduzieren können sind verschiedene Staphylokokken, Streptokokken, nicht-pathogene Corynebakterien und Hefen.
Kochblut-Agar
Haemophilus influenzae ist auf Hämin und NADP angewiesen und wächst daher nicht auf normalem Blutagar, aber auf Kochblut. Auf normalem Blutagar wächst er dann, wenn man ihn gleichzeitig mit Staphylococcus aureus bebrütet ("S. aureus-Amme").
Thayer-Martin-Agar
Dient zur Anzucht von Neisserien.
Sabouraud-Agar
Medium zur Anzucht von u.a. Candida albicans.
Citrat-Röhrchen
Indikatormedium zur Prüfung der Citratverwertung
Technik: Mit einer Impfnadel wird die Schrägfläche mit der verdächtigen Kultur bestrichen. Der Nährboden enthält Bromthymolblau als ph-Indikator, dieser schlägt bei Citratverwertung von grün (sauer) nach blau (alkalisch) um.
MIOH-Röhrchen
Mit dem MIOH-Röhrchen (Indikatormedium) werden 4 Reaktionen gleichzeitig überprüft:
- Motilität - Überprüfung der Ausbreitung im Nährboden.
- Indolreagenz – Prüfung, ob das Bakterium Tryptophan zu Indol abbauen kann. Positiv, wenn nach Zugabe des Kovacs- oder Ehrlich-Reagenz (Dimethylaminobenzaldehyd) innerhalb von 2 min. ein roter Farbstoff entsteht.
- Ornithinspaltung - Prüfung auf Ornithindecarboxylase-Aktivität. Positiv: blau, negativ: gelb.
- H2S-Bildung - H2S-Bildung führt zur Schwarzfärbung.
Anwendung: Differenzierung von Enterobakterien
Technik: Mit einer Impfnadel wird bis zum Boden in das Medium eingestochen.
Auswertung: MIOH + Citrat, Bsp.:
| Enterobacterium | M | I | O | H | Citrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Citrobacter freundii | + | - | + | + | + |
| Enterobacter aerogenes | + | - | + | - | + |
| Enterobacter cloacae | + | - | + | - | + |
| Escherichia coli | + | + | + | - | - |
| Klebsiella pneumoniae | - | - | - | - | + |
| Proteus mirabilis | + | - | + | + | +/- |
| Salmonella Typhimurium | + | - | + | + | + |
| Shigella sonnei | - | - | + | - | - |
Quellen: Microbiology and Bacteriology - The world of microbes - Key for Enteric Unknowns
Indikator-Zusätze
Neutralrot zeigt bei Farbumschlag zu Rot Laktoseverstoffwechselung an. Laktose wird z.B. von Escherichia coli, Klebsiella und Enterobacter verstoffwechselt, nicht aber von Proteus, Salmonella und Shigella.
Flüssignährmedien
Kriterien zur Beurteilung: Trübung, Flockung, Bodensatz, Oberflächenhäutchen, Farbstoffbildung.
Tryptic soy bouillon (TSB)
Tryptic soy bouillon (tryptisch verdaute Sojabohnen-Bouillon) ist ein Flüssignährmedium zur Kultur aerober Bakterien.
Brewer-Thioglykolat-Bouillon
Der Brewer-Thioglykolat-Bouillon erzeugt ein aneraobes Mileu (SH-Gruppen, Vitamin K) und einen Redoxindikator und dient damit zur Identifizierung anaerober Bakterien.
Biochemische Methoden
z.T. bei Nährböden schon behandelt (MIOH, Citrat, Neutralrot)
Oxidase-Test
Nachweis der Cytochrom c Oxidase.
Technik: Di- bzw. Tetramethyl-p-phenyldiamin reduziert über Cytochrom c die Cytochrom c Oxidase, und wird dabei oxidiert zu einem roten bzw. blauen Farbstoff. Reduziertes Dimethyl-p-phenyldiamin reagiert mit 1-Naphthol zu Indophenolblau. Man gibt einen Tropfen Oxidase-Reagenz auf ein Stück Filterpapier und verreibt darin mit der einer nicht-metallischen Impföse etwas von der Bakterienmasse. Eine positive Reaktion ist an der sofortigen Blaufärbung zu erkennen.
Katalase-Test
Technik: Man entnimmt mit der Öse ein Stückchen einer Kolonie und hält sie in einen Tropfen H2O2. Durch die Katalase freiwerdender O2 (2 H2O2 <-> 2 H2O + O2↑) führt zum Sprudeln. Katalase-positiv sind z.B. Staphylokokken, Katalase-negativ sind z.B. Streptokokken.
Koagulase-Test
Mit dem Koagulase-Test lässt sich die gebundenen Koagulase (clumping factor) von Staphylococcus aureus nachweisen und diesen Erreger damit gegen die Gruppe der Koagulase-negativen Staphylokokken (CONS) abgrenzen. Die Koagulase wandelt zusammen mit Thrombin Fibrinogen in Fibrin um.
Technik: Man suspendiert mehrere Kolonien in physiologischer NaCl-Lösung, so dass keine Klumpen mehr vorhanden sind. Dann gibt man Kaninchenplasma hinzu und schwenkt den Objektträger etwas. Bei Staphylococcus aureus kommt es binnen weniger Sekunden zur Koagulation (Klümpchenbildung, Flockung).
Durchführung als Deckglastest
Das zu untersuchende Material (eine Kolonie genügt) wird mit fibrinogenhaltigem Plasma verrieben. Sollte es sich bei der Probe um Staphylococcus aureus handeln, ist Clumping-Faktor A enthalten und die Probe flockt aus (Clumpingfaktor-positiv). Die Reaktion verläuft innerhalb von 1-2 Minuten und ist makroskopisch sichtbar.
Ist die Probe jedoch negativ, so handelt es sich (wahrscheinlich) nicht um Staphylococcus aureus, die Probe wird dann milchig-trübe. Bei MRSA (Methicillin resistenter Staphylococcus aureus) kann der Clumping-Faktor maskiert sein, so dass es zu einem falsch negativen Nachweis kommen kann.
Die Kolonie sollte jedoch vor Zugabe des Plasmas in 0,9% NaCl Lösung verrieben werden, da ein direktes Vermischen von Kolonie und Plasma bei Mikrokokken falsch positive Ergebnisse liefern kann.
Durchführung als Röhrchentest
Die zu prüfende Kolonie wird in sterilem NaCl auf Mc Farland 1 eingestellt. 50 µl dieser Suspension (entspricht ungefähr 3 Tropfen mit der sterilen Pasteurpipette) wird in einem Röhrchen mit 0,5 ml Kaninchenzitratplasma gemischt.
- Kontrollen
- Positivkontrolle mit Staph. aureus ATCC
- Negativkontrolle mit Staph. epidermidis
- Inkubation
- 18–24 h bei 37 °C im Wasserbad
- Auswertung
Nach 4 Stunden und nach 18–24 Stunden. Grund dafür ist eine mögliche Bildung von Fibrinolysin welche nach 24 Stunden ein falsches Negativergebnis liefern kann.
- negativ: keine Koagulase
- 1+ positiv: kleine , nicht zusammenhängende Klümpchen
- 2+ positiv: kleine , zusammenhängende Klümpchen
- 3+ positiv: großer Klumpen
- 4+ positiv: Der gesamte Röhreninhalt ist koaguliert und das Röhrchen kann auf den Kopf gestellt werden ohne das der Inhalt herausläuft.
Bacitracin-Test
Mit dem Bacitracin-Antibiotikum-Testplättchen lassen sich beta-hämolysierende Streptokokken näher differenzieren. Man legt das Testplättchen auf einen frischen konfluenten Ausstrich und drückt es leicht mit der Pinzette an. Streptococcus pyogenes ist gegenüber Bacitracin empfindlich und es bildet sich ein Hemmhof um das Plättchen aus.
Optochin-Test
Optochin ist ein Chiniderivat (kein Antibiotikum) aus der Rinde des Chinabaums und hemmt das Wachstum von Streptococcus pneumoniae (Testblättchen), so dass sich dieser Keim aus der Gruppe der α-hämolysierenden Streptokokken (Gram-positiv, Kettenbildend, α-hämolysierend, aerob, Katalase-negativ) identifizieren lässt.
Biochemische Test-Systeme
 |
 |
Mit speziellen Testkits z.B. dem API®-System der Firma bioMérieux[1] können dutzende verschiedener biochemischer Testreaktionen („biochemische bunte Reihe“) gleichzeitig und automatisiert durchgeführt werden, was das Verfahren für die Routinediagnostik prädestiniert.
Immunologischer Nachweis
Objektträger-Probeagglutination mit Antikörpern
Bei Verdacht auf pathogene Darmkeime (z.B. Salmonellen, enteropathogene E. coli) kann ein immunologischer Schnelltest eingesetzt werden.
Technik: Eine verdächtige Kolonie wird auf einem Objektträger mit dem jeweiligen anti-Verdachtserreger-Serum (z.B. anti-O-EPEC oder anti-O-Salmonella) vermischt, bis keine Klümpchen mehr sichtbar sind. Unter beständigem Schwenken kommt es bei positivem Ergebnis nach 30 bis 60 Sekunden zur Agglutination.
Wegen der mangelnden Genauigkeit muß eine nachträgliche biochemische Bestimmung allerdings trotzdem erfolgen.
Resistenztestungen
Indikationen für Resistenztestungen sind alle schweren Infektionen (Sepsis, Meningitis, Osteomyelitis, Endokarditis usw.), nosokomiale Infektionen, chronische Infektionen, Infektionen bei Immunsupprimierten und Therapieversager.
Neben dem therapeutischen Impact ergeben sich in der Gesamtschau vieler Resistenztestungen auch Rückschlüsse über die Resistenzlage in den Krankenhäusern und deren Fachabteilungen, so dass auch Patienten, bei denen die Testung noch aussteht, von einer besseren kalkulierten Therapie profitieren können.
Verdünnungs(Dilutions)-Methoden
Antibiotika werden in einer Verdünnungsreihe in flüssigen oder festen Nährmedien verdünnt (z.B. 128μg/ml, 64μg/ml, 32μg/ml,...), jeweils mit einer definierten Bakterienverdünnung beimpft und 18 Stunden bebrütet. Die Antibiotikakonzentration, bei der gerade noch kein Bakterienwachstum stattfindet, ist die minimale Hemmstoffkonzentration (MHK).
Zusätzlich kann man in den Proben, in denen kein Wachstum erfolgt ist, die Keimdichte bestimmen und mit der Ausgangsverdünnung vergleichen. Die Verdünnungsstufe, bei der 99,9% des Inokulums abgetötet wurden, ist die minimale bakterizide Konzentration (MBK).
Agardiffusionsmethoden
Agardiffusionstest
Ein festes Nährmedium wird mit einer Standard-Verdünnung an Testbakterien gleichmäßig beimpft und standardisierte Antibiotikum-Testplättchen aufgelegt, aus denen das Antibiotikum herausdiffundiert. Die Konzentration im Agar nimmt mit der Entfernung vom Testplättchen zunehmend ab. Nach 18 Stunden Bebrütung kann anhand der Größe des Hemmhofes (in mm) die Sensibilität bestimmt werden.
E-Test
Beim E-Test wird ein mit einem Antibiotikumkonzentrationsgradienten imprägnierter Teststreifen auf den beimpften Agar aufgelegt. Die MHK kann an der Stelle abgelesen werden, an der die Bakterien bis an den Teststreifen heranwachsen.
Bewertung
Alle Tests haben Vor- und Nachteile, diese nun im Überblick:
| Dilution | Agardiffusion | E-Test | |
|---|---|---|---|
| MHK-Bestimmung | präzise | ungenau | präzise |
| Unbeeinflusst vom Nährmedium | ja | nein | nein |
| Unbeeinflusst von der Diffusionsrate des AB | ja | nein | (ja) |
| Testung von Bakterien möglich, die Blut benötigen? | nein | ja | ja |
| Zur Notfalltestung geeignet? | nein | ja | unüblich |
| Teuer, aufwendig? | ja | nein | ja |
Hemmstofftest
Der Hemmstofftest dient zum Aufspüren antimikrobieller Substanzen im Untersuchungsmaterial (z.B. bei antibiotisch anbehandelten Infektionen), da diese zu verminderten Keimzahlen führen und die Ergebnisse verfälschen können. Dafür wird ein hochempfindlicher Laborkeim (z.B. Bacillus subtilis) in Anwesenheit von Untersuchungmaterial bebrütet. Ein Hemmhof ist dementsprechend ein positiver Nachweis.
Serologie
Die Infektionssserologie beschäftigt sich mit dem Nachweis von erregerspezifischen Antigenen (siehe Testverfahren Virologie) und Antikörpern in Serum, Liquor und Punktaten.
Antikörpernachweis: Antikörper bilden sich nach Antigenkontakt, IgM-Antikörper etwa 7 Tage nach der Infektion, IgA- und IgG etwas später. Während IgA und IgM nach einigen Wochen bis Monaten verschwinden, bleiben IgG-Antikörper Monate, Jahre und z.T. bis ans Lebensende nachweisbar (Seronarbe).
Die Bestimmung von Antikörpern wird eingesetzt bei Erregern, die schwer oder nicht anzüchtbar sind (Treponema pallidum, Toxoplasma gondii, Hepatitis-Viren), bei Postinfektionssyndromen ohne Erreger (Streptococcus pyogenes, Yersinien), bei epidemiologischen Fragestellungen (Herpes-Viren) und zur Kontrolle des Immunstatus (z.B. vor und nach einer Impfung).
Die Höhe des Antikörperspiegels wird in Titern oder Internationalen Einheiten (I.E.) angegeben. Der Titer wird bestimmt, indem vom Serum eine Verdünnungsreihe angelegt wird und diese getestet wird. Die niedrigste Konzentration mit noch positiver Reaktion ist dann der Titer, z.B. 1:16, 1:32 oder 1:64.
Agglutinationsmethoden
Messparameter ist die Agglutination durch Bildung von Antigen-Antikörper-Komplexen.
Hinweis: In den folgenden Abschnitten werden diese Begriffe und Zeichen synonym für Antikörper (Immunglobuline) benutzt: Ak, Ig, anti-X; bildhaft: Y, >-, -<
TPPA-Test

Treponema pallidum-Partikelagglutinationstest
Bei diesem Syphilis-Screeningtest, der frische und ältere Infektionen nachweist werden biologisch inerte Gelatinepartikel (G) eingesetzt, die mit Antigen (Ag) von Treponema pallidum Nichols-Stamm beladen wurden. Werden sie mit positivem Patientenserum (d.h. Serum mit Antikörpern S-Ig gegen T. pallidum) inkubiert kommt es zur Agglutination.
Ag|G|Ag >- Ag|G|Ag -> Ag|G|Ag Ag|G|Ag Ag|G|Ag ... (Agglutination über Fab des Ig)
Y Y Y
S-Ig S-Ig S-Ig S-Ig
Die Sensitivität liegt bei 99,9%, die Spezifität bei 99-100%. 1% der Gesunden werden meist transient falsch positiv getestet, der Test ist allerdings hochspezifisch, wenn er mit einem weiteren Test (VDRL oder FTA-abs-Test) kombiniert wird.
Die Syphilis-Diagnostik folgt diesem Schema:
- Suchreaktion: TPPA
- Bestätigung: FTA-abs-Test
- Verlaufskontrolle: VDRL-Test oder Cardiolipin-KBR (Komplementbindungsreaktion) und IgM-FTA-abs-Test zur Beurteilung der Aktivität und des Therapieerfolges.
VDRL-Test
Veneral-Disease-Research-Laboratories-Test
Bei der Syphilis (und vielen anderen Erkrankungen, die mit Gewebsschäden einhergehen) treten Autoantikörper gegen das mitochondriale Cardiolipin (Cl) auf. Diese können in einer Agglutinationsreaktion nachgewiesen und zur Verlaufskontrollle genutzt werden. Der VDRL-Test ist nicht spezifisch gegen T. pallidum gerichtet.
Cl >- Cl -> Cl Cl Cl ... (Agglutination über Fab des Auto-Ig)
Y Y Y
S-anti-
Cl-Ig
Daneben gibt es noch den Cardiolipin-Mikroflockungstest (CMT), der nur im akuten Stadium der Lues positiv reagiert und deswegen Auskunft über die Therapiebedürftigkeit gibt.
Immunfluoreszenz
Beim indirekten Fluoreszenztest wird das Antigen (Ag) auf den Objektträger gebracht und fixiert. Danach wird das Patientenserum aufgebracht und inkubiert. Enthält das Serum Antikörper (S-Ig), so binden diese an das Antigen und können dann mit einem Fluoreszenzmarkierten Anti-Humanimmunglobulin (anti-hIg-F) markiert und im Fluoreszenzmikroskop gesehen werden.
|Ag >- >-F
S-Ig anti-hIg-F
FTA-abs-Test
Fluorescent Treponemal Antibody - Absorption - Test
Der FTA-abs-Test wird zur Bestätigung positiver TPPA-Test-Ergebnisse benutzt. Das Patientenserum wird zur Beseitigung kreuzreagierender Antikörper mit T. phagedensis-Ultraschallhomogenat vorinkubiert und dann auf mit T. pallidum-Antigen imprägnierte Objekträger aufgebracht. Die Detektion erfolgt mit FITC-Anti-Humanglobulin (FITC: Fluoreszein-Isothiocyanat).
Beim IgM-FTA-abs-Test wird vor der Testung das IgG aus dem Patientenserum abgetrennt und zur Detektion ein μ-Ketten-spezifisches Anti-Humanglobulin eingesetzt.
Bakterien-Systematik
Eine Übersicht über die medizinische Bakterien-Systematik auf der Grundlage der vorgenannten Differenzierungsmethoden finden Sie zu Anfang des Kapitels Spezielle Bakteriologie.
Testverfahren Virologie
Elektronenmikroskopie

Viren, die in hoher Zahl im Patientenmaterial vorhanden sind können nach Fixierung und Kontrastierung im Elektronenmikroskop betrachtet werden. Die Identifizierung erfordert lange Berufserfahrung. Ein Elektronenmikroskop verursacht hohe Anschaffungs- (200.000 bis 500.0000 €) und Betriebskosten. Für den Routinebetrieb daher nur bedingt geeignet. Von der Technik her können Transmissions- (TEM) und Rasterelektronenelektronenmikroskopie (REM), engl. scanning electron micrography (SEM) unterschieden werden. Ersteres mißt Elektronen, die durch dünne Objektschichten hindurchgeschossen werden, letzteres mißt die am Objekt reflektierten Elektronen.
Weblink: Elektronenmikroskopie
Virusisolierung
Die Virusisolierung ist immer dann angebracht, wenn im Patientenmaterial sehr wenig virales Antigen nachweisbar ist. Zu diesem Zweck wird das Patientenmaterial auf Monolayer- oder in Suspensionszellkulturen gegeben. Falls eine Infektion erfolgt, kann bei einigen Viren eine Veränderung der Zellmorphologie, der zytopathische Effekt (CPE) beobachtet werden. Einen CPE verursachen z.B. Herpes Simplex-, Varicella-, Influenza-, Adeno-, Picorna-, Enteroviren, sowie Masern-, Mumps- und Rötelnviren. Einige andere Viren verursachen keinen CPE oder es existieren keine Zellen, die in vitro von diesen Viren infiziert werden.
Da im Patientenmaterial toxische Substanzen vorkommen können, die evtl. einen CPE vortäuschen, wird bei Nachweis eines CPE mit dem Überstand der Primärkultur eine Sekundärkultur angelegt. Die Zellen, die einen CPE zeigen oder der Kulturmedienüberstand dieser Zellen kann dann für weitere diagnostische Untersuchungen verwendet werden (siehe IFT, Ag-Nachweis in Zellen, Elektronenmikroskopie).
Viren quantifizieren
Anwendung: In der experimentellen Virologie, zur Aktivitätsprüfung von antiviralen Medikamenten, zur Konzentrationsseinstellung von Lebendimpfstoffen, vor der Virustypisierung im Neutralisationstest.
Endpunkttitration (Virus-Titer-Bestimmung)
Um die Virusmenge einer Lösung (Patientenmaterial, Viruskultur) grob abzuschätzen kann man von der Virussuspension eine geometrische Verdünnungsreihe anfertigen (1:10, 1:100, 1:1.000 usw.).Eine Multikulturplatte, deren Vertiefungen mit Zellen bewachsen sind, wird mit je einem Milliliter dieser Verdünnungen beimpft. Die Verdünnung, bei der nur noch 50% der Zellen einen CPE, d.h. Infektionszeichen zeigen, ist dann der Titer bzw. der TCID50/ml (TCID: tissue culture infective dose).
Plaque-Test

Mit dem Plaque-Test lässt sich die mit dem Neutralisationstest bestimmte Virusmenge weiter spezifizieren. Hierzu werden (meist) einige Petrischalen mit einer definierten Menge an Virussuspension (Verdünnungsreihe um den TCID50/ml-Wert herum) beimpft. Die Kulturen werden eine Stunde bei 37°C inkubiert, damit die Viren adhärieren können. Danach wird die Kultur mit einem Kristallviolett-haltigen Agar überschichtet, der den Viren nur noch die Ausbreitung von Zelle zu Zelle gestattet. Der enthaltene Vitalfarbstoff wird von lebenden, aber nicht von toten Zellen aufgenommen und gespeichert, so dass sich die infizierten Zellareale als helle Flächen vom blauen Zellrasen abheben.
Nach Kultur bei 37°C über 2- 7 Tage kann die Zahl der vermehrungsfähigen Viren als plaque forming units (PFU) angegeben werden bezogen auf die verwendete Verdünnung. Beispielweise bedeuten 15 PFUs bei der Verwendung von 1ml einer Serumverdünnung von 1:1.000 dann 15.000 PFUs pro ml Patienten-Serum.
Virus-Typisierung
Neutralisationstest (NT)
Hat man einen konkreten Anfangsverdacht so kann man mit dem Neutralisationstest den Erreger (Ag) bestimmen. Eine mittels Endpunkttritration definierte Virussuspension (1000 TCID50/ml) wird mit verschiedenen Antiseren (anti-X-Ig) gemischt und eine Stunde bei 37°C inkubiert. Passen Virus und Serum-Antikörper zusammen so ist die Infektiösität aufgehoben und das Virus löst in der folgenden Kultur keinen CPE mehr aus.
Ag3 >- -> keine Inaktivierung -> CPE
anti-1-Ig
Ag3 >- -> keine Inaktivierung -> CPE
anti-2-Ig
Ag3 >- -> -< Ag3 >- Inaktivierung -> kein CPE
anti-3-Ig
Serologischer NT
In Umkehrung des vorbeschriebenen NT können mit Hilfe bekannter Virusstämme Antikörper im Patientenserum nachgewiesen werden und zusätzlich deren Titer bestimmt werden. Hierzu wird 1000 TCID50/ml-Testvirussuspension mit den gleichen Volumina verschiedener Patientenserum-Verdünnungen (z.B. 1:4, 1:8, 1:16, ... ,1:128) 1 Stunde bei 37°C inkubiert und die verbliebene, d.h. nicht neutralisierte Infektionsfähigkeit in der Zellkultur (Mikrotiterplatte) getestet: Endpunkt-Titration der Antikörper.
1) Bestimmung des Antikörpers:
Ag1 >- -> keine Inaktivierung -> CPE
anti-3-Ig
Ag2 >- -> keine Inaktivierung -> CPE
anti-3-Ig
Ag3 >- -> -< Ag3 >- Inaktivierung -> kein CPE
anti-3-Ig
2) Titerbestimmung:
Ag3 + anti-3-Ig (Patientenserum in verschiedenen Verdünnungen) -> CPE/50%CPE/kein CPE
ELISA
Der Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) ist der Test, der für fast alle viralen Erreger angewendet wird. Durch den Einsatz von Teil- oder Vollautomaten, die die Teste bearbeiten, ist der ELISA am wirtschaftlichsten und daher weit verbreitet.
Der Test beruht auf Antigen-Antikörper-Interaktionen, die mittels Farbreaktionen nachgewiesen werden.
Serologischer ELISA
Ziel: Nachweis von Virusspezifischen Antikörpern im Patientenserum
Methode: Eine mit Virus-Antigen (Ag) beschichtete Oberfläche wird mit dem Patientenserum inkubiert, nicht gebundene Antikörper (>-) werden durch Spülen entfernt. Haben Serum-Antikörper des Patienten (S-Ak) an das Antigen gebunden, dann können diese im zweiten Schritt mit einem kettenspezifischen anti-Antikörper gegen humanes Immunglobulin G (anti-hIgG) markiert werden, der mit einem Enzym (E), z.B. Meerrettichperoxidase (HRP) oder Alkalische Phosphatase (AP) gekoppelt ist (>-E). Nach Entfernung von nicht gebundenem anti-hIg, wird im dritten Schritt ein Chromogen (Farbreagenz) zugegeben, das vom Enzym in ein farbiges Produkt (FR) umgesetzt wird.
Reaktion wenn S-Ak vorhanden:
|Ag >- >-E +|<-Chromogen
|Ag >- >-E +|
|Ag >- >-E +|-> farbiges Reaktionsprodukt (FR)
S-IgG anti-hIgG,Enzymgekoppelt
Durch die Verwendung geometrischer Verdünnungen des Patientenserums kann der Antikörper-Titer bestimmt werden.
Neben dem IgG kann auch IgM bestimmt werden. Hierzu wird ein μ-Kettenspezifisches anti-hIg benutzt. Im Serum evtl. vorhandene Rheumafaktoren (RF: IgM, das gegen körpereigenes IgG gerichtet ist) kann die Messung verfälschen, indem es an Ag-gebundenes IgG bindet und vom anti-hIgM detektiert wird. D.h. statt IgM mißt man IgG.
richtig-positiv: falsch-positiv durch RF:
|Ag >-X-< >-E -> FR |Ag >- >-X-< >-E -> FR
S-IgM anti-IgM S-IgG IgM-RF anti-hIgM
Um dieses Problem zu umgehen wurde die Anti-μ-Technik entwickelt. Hierbei werden alle IgM-Antikörper unabhängig von ihrer Spezifität auf einer mit anti-IgM beladenen Fläche gebunden. Im zweiten Schritt kann daran nun das Virusantigen (Ag) binden, das mit dem Enzym (E) gekoppelt wurde. Ist im Patientenserum IgM gegen das Virus vorhanden wird Ag-E gebunden und die Farbreaktion ist positiv.
|-< >-X-< Ag-E -> FR anti-IgM S-IgM
Virusnachweis mit ELISA
Virusantigen kann mit dem Sandwich-ELISA nachgewiesen werden. Auf der Oberfläche befinden sich gegen das Virusantigen gerichtete Antikörper. Bindet daran Virus-Antigen, das im Patientenmaterial enthalten ist, dann kann dieses mit einem zweiten, Enzym-gekoppelten Antikörper markiert werden, der allerdings gegen ein anderes Epitop des Antigens gerichtet sein sollte, um Kreuzreaktionen zu vermeiden.
|-< Ag >-E -> FR anti-Ag anti-Ag
Immunfluoreszenztest (IFT, IFA)
Sowohl IgG-Antikörper als auch IgM-Antikörper können mit dem IFT nachgewiesen werden. Am häufigsten ist die Anwendung des indirekten IFT bei Infektionen mit Influenzaviren und dem Epstein-Barr-Virus.
Hinweis: Freie Viren können nicht detektiert werden, da diese beim Waschen weggespült werden.
Antikörpernachweis (indirekter IFT bzw. IIF)
Ausgangsmaterial für den IIF sind meistens mit Testviren infizierte Zellen, die auf Glasplättchen fixiert und mit dem Patientenserum inkubiert werden. Durch Spülen werden die nicht gebundenen S-Ak abgewaschen. Die Zellen werden dann mit einem anti-hIg inkubiert, das mit einem Fluorochrom (z.B. Fluoresceinisothiocyanat, FITC) gekoppelt ist. Die Immunfluoreszenz kann im Fluoreszenzmikroskop gesehen werden.
|Ag >- >-F
S-Ig anti-hIg
Antigennachweis (direkter IFT bzw. DIF)
Das Antigen wird im Patientenmaterial direkt mittels Fluorochrom-markiertem Ak nachgewiesen.
|Ag >-F
anti-Ag
Hämagglutinationshemmtest (HHT)

Der HHT findet Anwendung bei Viren, deren Oberflächenproteine in der Lage sind an Erythrozyten zu binden und diese zu agglutinieren, was z.B. bei Rötelnviren der Fall ist. Die so gebundenen Erythrozyten bilden ein Netzwerk aus, das nicht mehr auf den Boden des Reaktionsgefäßes absinkt. Im HHT wird nun dem System aus Rötelhämagglutinin und Test-Erythrozyten das zu testende humane Serum zugegeben. Serum-Antikörper, die gegen das Virus gerichtet sind binden an die Öberflächenproteine der Viren und verhindern die Hämagglutination, die Erys sinken ab und bilden einen "Knopf". Zur Quantifizierung wird das zu testende Serum in Verdünnungsstufen in den Test eingebracht. Dadurch kann der Titer ermittelt werden, der gerade noch ausreicht, um die Hämagglutination zu unterbinden. In der Routinediagnostik wird dieser Test zur Bestimmung des Röteln-Titers verwendet.
R-Ag (Hämagg.) >- -> Hämagg.-Inakt. -> keine Agglutination, Test-Erys sinken ab ("Knopf")
S-Ig
R-Ag (Hämagg.) -> Agglutination ("Netz")
Komplementbindungsreaktion (KBR)

Die KBR erkennt im Wesentlichen nur IgG1-, IgG3- und IgM-Antikörper. Für die Diagnostik einer akuten Infektion sind daher 2 aufeinander folgende Serumproben (Abstand 5-10 Tage) notwendig, bei denen ein erhöhter KBR-Titer im Falle einer akuten Infektion festzustellen ist. Die KBR ist eine sehr alte Methode, die derzeit von neueren Verfahren abgelöst wird. Sie kann bei fast allen viralen Infektionen angewendet werden. Das hauptsächliche Anwendungsgebiet ist die Serologie von Influenza A/B, Parainfluenza, RSV, VZV, Masern, Mumps und Adenoviren.
Prinzip: Antikörper binden nach Antigenkontakt (am Fab-Teil) mit ihrem Fc-Teil Komplement.
Testverfahren: Das Patientenserum wird mit Testvirusantigen zusammengebracht und dann Komplement dazugegeben. Besitzt der Patient Ak gegen das Virus-Ag, so bilden sich Ag-Ak-Komplexe und der Ak bindet Komplement. Das Komplement wird dadurch weggefangen. Im zweiten Schritt werden dann Hammelerythrozyten dazugegeben, die mit Kaninchen-Antikörpern (anti-Hammel) bedeckt sind. Da kein freies Komplement da ist kommt es nicht zur Hämolyse. Ist das Patientenserum negativ, so bleiben das Ag und Komplement frei, Komplement bindet an das Kaninchen-Ig auf den Hammelerythrozyten und führt zur Hämolyse. Durch verschiedene Verdünnungen des Patientenserums kann eine Titerbestimmung erfolgen.
Virus-Ag >- Komplement -> kein Komplement übrig -> Ak-beladener Ery i.O. -> keine Hämolyse
S-Ig
Virus-Ag Komplement -> Komplement bindet an Ak auf dem Ery -> Hämolyse
Hämolyse-im-Gel-Test (HIG)
Mit Rötelnvirusantigen beschichtete Erythrozyten werden in Agarosegel gegossen. In das Gel werden kleine Löcher gestanzt und das Patientenserum zusammen mit Komplement eingefüllt. Wenn das Serum anti-Röteln-Immunglobuline enthält, so kommt es zur Hämolyse. die Größe des Hämolysehofs ist proportional zur Antikörperkonzentration im Serum.
Ery|Ag >- Komplement -> Hämolyse
S-Ig
Ery|Ag Komplement -> keine Hämolyse
Westernblot
Der Westernblot wird hauptsächlich bei der Diagnostik von HIV 1 und 2, Röteln, CMV, EBV, Hanta-Viren, HTLV und HCV eingesetzt. Er wird verwendet, um die in dem ELISA-Test erhaltenen Ergebnisse zu bestätigen oder um weitere diagnostische Fragestellungen zu bearbeiten. Er bietet die Möglichkeit Antikörper gegen mehrere virale Proteine gleichzeitig nachzuweisen.
Vorbereitung eines Teststreifens (Bsp. HIV): Eine T-Lymphozyten-Zellkultur wird mit HIV infiziert zur Erzeugung von viralen Antigenen. Die Zellen werden zentrifugiert und aus dem Lysepuffer ein Extrakt gewonnen. Die Proteine werden mittels Gel-Elektrophorese aufgetrennt und per Elektroblot auf Nitrocellulosefolie übertragen, die dann in (Test)Streifen geschnitten werden kann. Auf dem Streifen sind die Antigene dann in einer festen Reihenfolge angeordnet, die durch die Wanderungsgeschwindigkeit der Proteine im Gleichstromfeld vorgegeben ist.
Durchführung: Das Patientenserum wird auf den Teststreifen aufgetragen und beides inkubiert. Sind im Serum Antikörper vorhanden, dann können die Antigen-Antikörper-Komplexe wieder mit einem Chromogen- oder Fluorochrom-gekoppelten anti-hIg sichtbar gemacht werden. Im Bsp. sind S-Antikörper gegen Protein 1 und 3 vorhanden:
| | | |
Protein 1 |Ag1 >- >-E/C/F |x| pos
| | S-anti-Ag1 anti-hIg | |
Protein 2 |Ag2 | | neg
| | " | |
Protein 3 |Ag3 >- |x| pos
| | S-anti-Ag3 " | |
Teststreifen Teststreifen
Nukleinsäuren-Nachweis
in situ-Hybridisierung
Die in situ-Hybridisierung wird vor allem bei der Identifizierung und Typisierung von Humanen-Papilloma-Viren (HPV) angewendet.
Technik: Das Patientenmaterial wird aufgearbeitet und die angereicherte Nukleinsäure (NS) auf Nitrozellulosefolie oder Plastik fixiert. Mit spezifischen einzelsträngigen Gen-Sonden können nun bestimmte Nukleotidsequenzen in der denaturierten, einzelsträngigen DNA oder RNA aus dem Patientenmaterial nachgewiesen werden (Hybridisierung komplementärer Stränge). Die Gen-Sonden sind dafür mit Fluorochromen oder radioaktiven Isotopen markiert.
|NS Sonde-F
Erweiterte Hybridisierung
Die Signale der in situ-Hybridisierung können verstärkt werden, in dem die Sonde nicht direkt markiert ist, sondern ein markierter anti-Sonden-Ak eingesetzt wird, der gleich mehrfach an eine Sonde binden kann.
|NS Sonde >-F
anti-Sonde-Ig-F
Polymerasekettenreaktion (PCR)


Da Hybridisierungsverfahren manchmal an der zu geringen Nukleinsäuremenge scheitern, kann letztere durch die Polymerasekettenreaktion vermehrt werden.
Für RNA-Viren ist vor dem Verfahren noch ein Umschreiben der RNA in DNA mit Hilfe einer Reverse Transkriptase (RT) notwendig. Die reverse Transkription und die anschließende Amplifikation des Genoms via PCR wird unter der Abkürzung RT-PCR zusammengefasst. Die PCR bzw. RT-PCR ist für fast alle humanpathogenen Viren etabliert. Eingesetzt wird sie, wenn andere Nachweisverfahren kein positives Ergebnis liefern, aber ein dringender Verdacht auf eine virale Infektion besteht, zur Bestimmung von Genomäquivalenten für prognostische Zwecke, zum Therapie-Monitoring oder falls keine anderen Methoden zur Verfügung stehen.
Technik: Der Prozess verläuft in drei Schritten, die mehrfach wiederholt werden. 1.) Aufschmelzen der Doppelstränge in Einzelstränge bei ca. 95°C, 2.) Primerhybridisierung, je nach verwendetem Primer bei 50° bis 65° 3.) Erzeugung des Komplementärstrangs: Die Polymerase lagert sich an den Primer an und verlängert den neuen Strang in 5'3'-Richtung. Von der verwendeten Polymerase und der Länge des zu amplifizierenden DNA-Stücks hängen Temperatur (68-72°C) und Dauer dieser Phase ab. Danach wird der Zyklus wiederholt. Die Durchführung von X Zyklen amplifiziert dann einen DNA-Strang zu 2X identischen Tochtersträngen.
Weblink: Polymerase-Kettenreaktion
Größenbestimmung amplifizierter DNA-Fragmente mittels Agarosegelelektrophorese
Die DNA-Fragmente können im Agarosegel, an das eine definierte elektrische Spannung angelegt wird nach ihrer Größe (proportional zur Wanderungsgeschwindigkeit) aufgetrennt werden.
Prionen als Krankheitserreger
Überblick: Prionen (von engl. proteinaceous infectious particles) sind physiologisch im Körper vorkommende Proteine, die bei Fehlfaltung zu wasserunlöslichen β-Faltblatt-Strukturen Prionenerkrankungen auslösen können.
Die Fehlfaltung kann spontan auftreten (z.B. bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder fataler familiärer Insomnie) oder das pathogene Protein gelangt durch kontaminierte Nahrung in den Körper (z.B. bei BSE, Kuru). Das falsch gefaltete Protein kann in richtig gefalteten Proteinen die Fehlfaltung induzieren, was zu einer fatalen Kettenreaktion führt.
Prionenerkrankungen:
| Mammalian prions, agents of spongiform encephalopathies | |
|---|---|
| ICTVdb Code | Disease name |
| 90.001.0.01.001. | Scrapie |
| 90.001.0.01.002. | Transmissible mink encephalopathy (TME) |
| 90.001.0.01.003. | Chronic wasting disease (CWD) |
| 90.001.0.01.004. | Bovine spongiform encephalopathy (BSE) |
| 90.001.0.01.005. | Feline spongiform encephalopathy (FSE) |
| 90.001.0.01.006. | Exotic ungulate encephalopathy (EUE) |
| 90.001.0.01.007. | Kuru |
| 90.001.0.01.008. | Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) |
| (New) Variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD, nvCJD) | |
| 90.001.0.01.009. | Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome (GSS) |
| 90.001.0.01.010. | Fatal familial insomnia (FFI) |
| Mammalian prions, agents of spongiform encephalopathies | |||
|---|---|---|---|
| ICTVdb Code | Natural host | Prion name | PrP isoform |
| 90.001.0.01.001. | Sheep and goats | Scrapie prion | OvPrPSc |
| 90.001.0.01.002. | Mink | TME prion | MkPrPSc |
| 90.001.0.01.003. | Mule Deer and Red Deer | CWD prion | MDePrPSc |
| 90.001.0.01.004. | Cattle | BSE prion | BovPrPSc |
| 90.001.0.01.005. | Cats | FSE prion | FePrPSc |
| 90.001.0.01.006. | Nyala and greater kudu | EUE prion | NyaPrPSc |
| 90.001.0.01.007. | Humans | Kuru prion | HuPrPSc |
| 90.001.0.01.008. | Humans | CJD prion | HuPrPSc |
| Humans | vCJD prion | HuPrPSc | |
| 90.001.0.01.009. | Humans | GSS prion | HuPrPSc |
| 90.001.0.01.010. | Humans | FFI prion | HuPrPSc |
Hypothesen:
Das im menschlichen und tierischen Körper, besonders im Nervensystem vorkommende PrPc (Prion Protein cellular) kommt besonders an der Zelloberfläche vor und schützt die Zellen vor zweiwertigen Kupfer-Ionen, H2O2 und freien Radikalen. Des Weiteren wird vermutet, dass es einer der ersten Sensoren in der zellulären Abwehr von reaktivem Sauerstoff und freien Radikalen ist und Auswirkungen auf den enzymatischen Abbau von freien Radikalen hat.[1] Gerät dieses normale Eiweiß PrPc in Kontakt mit einem PrPSc genannten Eiweiß (Prion Protein Scrapie; pathogene Form des Prion-Proteins, das in der Form zuerst bei an Scrapie erkrankten Tieren gefunden wurde), nimmt PrPc die Konformation von PrPSc an. Es entwickelt sich eine Kettenreaktion, in der immer mehr PrPc in PrPSc umgewandelt wird. PrPSc führt zu Ablagerungen und Zellzerstörung mit Ausbildung schwammartiger Löcher, der spongiformen Enzephalopathie, die stets tödlich endet. Die Initiation der Krankheit kann auf drei Arten erfolgen, was unter allen Krankheiten einmalig ist:
1. sporadisch, d.h. zufällig bzw. ohne erkennbare Ursache: PrPc faltet sich „zufällig“ in PrPSc um und löst dadurch die Kettenreaktion aus. Ein Beispiel ist die klassische Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (sCJD).
2. genetisch: Das Gen PRNP, das PrPc kodiert kann einen Fehler enthalten, so dass ein für die Fehlfaltung anfälligeres Protein entsteht. Die Mutation wird auf die Kinder vererbt. Beispiele sind die familiäre Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (fCJD), das Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom (GSS) und die fatale familiäre Insomnie (FFI).
3. durch Übertragung bzw. „Ansteckung“: Führt man sich von außen PrPSc zu, kann dies das eigene PrPc wiederum in PrPsc umwandeln, allerdings nicht unter allen Umständen. Es kommt darauf an, welche Menge zugeführt wird, in welcher Weise und um welche Art von PrPSc es sich genau handelt. Eine Ansteckung im alltäglichen Kontakt mit Patienten ist nicht möglich. Eine Übertragung erfolgt, wenn stark PrPSc-haltiges Material, also z.B. Gehirn von kranken Tieren oder Menschen gegessen wird oder direkt in das Gehirn gelangt. Letzteres ist z.B. bei der iatrogenen Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (iCJD) der Fall. Im Rahmen von Operationen am Gehirn wurden versehentlich Gehirnteile von Erkrankten in das Gehirn von Gesunden gebracht. Ein anderes Beispiel ist Kuru, eine Krankheit auf Papua-Neuguinea; Angehörige des betroffenen Volksstamms aßen im Rahmen von kulturellen Riten das Gehirn von Verstorbenen und nahmen damit hohe Mengen an PrPSc zu. Das prominenteste Beispiel ist aber sicherlich BSE (Bovine spongiforme Enzephalopathie). Rinderbestandteile mit PrPsc wurden zu Tiermehl verarbeitet und dieses verfüttert, wodurch sich immer mehr Kühe infizierten. In geringerem Umfang könnten sich auch andere Tiere (Katzen, Zootiere) durch dieses Tiermehl infiziert haben. Schließlich erkrankten besonders in Großbritannien auch Menschen aufgrund des Verzehrs von BSE-Kühen an einer neuen Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, der „neuen Variante“ (nvCJD oder vCJD).
Auch die familiären Formen von Prionenkrankheiten lassen sich im Experiment übertragen, so kann beispielsweise das PrPSc erkrankter Menschen bei Mäusen eine Krankheit auslösen, wenn man etwas davon in ihr Gehirn injiziert.
Prionen sind sehr widerstandfähig gegen übliche Desinfektions- bzw. Sterilisationsverfahren, was auch ein Grund für die iCJD-Fälle und die BSE-Krise ist. Heute gibt es auf die erschwerte Inaktivierung von Prionen abgestimmte strenge Vorschriften für die Sterilisierung von Material, das mit möglicherweise prionhaltigem Gewebe in Kontakt gekommen ist.
Die 1982 von Stanley Prusiner veröffentlichte „Prionenhypothese“ wurde zunächst in der Wissenschaft kritisch aufgenommen, da ein nukleinsäurefreies infektiöses Agens bis dahin nicht vorstellbar war. Im Nachhinein erwies sich diese Hypothese jedoch als bahnbrechend und 1997 wurde Prusiner für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Prionenforschung mit dem Nobelpreis geehrt. In den Jahren nach der Aufstellung dieser Hypothese konnten in zahlreichen Experimenten Hinweise für die Richtigkeit dieser Hypothese gewonnen werden, allerdings kein endgültiger Beweis. 1986 begann die BSE-Epidemie in Großbritannien nachdem die Vorschriften zur Sterilisationstemperatur bei der Tiermehlerzeugung gelockert wurden, 1996 wurden die ersten Fälle von vCJD beschrieben.
Struktur des Prion-Proteins: Es handelt sich um ein beim Menschen aus 253 Aminosäuren (AS) bestehendes Glykoprotein, das im Prion-Protein-Gen (PRNP) codiert wird. Die AS-Homologie zu anderen Säugetieren beträgt 85% oder mehr, zwischen Rind und Mensch gibt es z.B. 13 AS-Unterschiede. Es sind jeweils eine oder mehrere Mutationen bekannt, die zu fCJD, GSS oder FFI führen. Am Codon 129 besteht ein Methionin/Valin-Polymorphismus, der für Krankheitsausbruch und –verlauf mitentscheidend ist. PrPc enthält zum großen Anteil alpha-Helices, PrPSc mehr beta-Faltblattstrukturen, aber beide enthalten die gleiche Aminosäuren-Primärsequenz. Der genaue Vorgang der „Umfaltung“ von PrPc in PrPSc ist noch unbekannt. Diese verändert die Eigenschaften des Prion-Proteins. Das PrPSc ist schlechter wasserlöslich (weil die hydrophoben Ketten nicht, wie bei der alpha-Helix üblich, zur Innenseite der Protein-Tertiärstruktur zeigen), hitzestabil und für Proteasen schwer verdaulich. PrPc ist vor allem an Synapsen lokalisiert. Die Funktion ist weitgehend unbekannt. PrP-Knockoutmäuse zeigen eine weitgehend normale Entwicklung. Es gibt jedoch Hinweise auf eine Rolle als kupferbindendes Protein an der Synapse.
Pathologie und Symptomatik von Prionkrankheiten: Alles in allem sind Prionkrankheiten vor allem durch motorische Störungen wie Ataxie und beim Menschen kognitive Störungen bis zur Demenz gekennzeichnet. Nach einer Inkubationszeit von Jahren bis Jahrzehnten enden die Krankheiten stets tödlich. Im Gehirn finden sich bei der neuropathologischen Begutachtung unter dem Lichtmikroskop spongiöse Veränderungen, eine astrozytäre Gliose und unter Umständen bestimmte Ablagerungen wie Amyloid, Kuru-Plaques und floride Plaques.
Literatur und Weblinks:
- Der Biologe Roland Heynkes informiert über die TSE-Forschung
- www.prionforschung.de Informationen über Prionen und TSEs von der TSE-Koordinierungsstelle Niedersachsen
- www.wissenschaft.de: Bluttest für Prionen (über einen Artikel in: Nature Medicine (Online-Vorabveröffentlichung vom 28. August, 2005)
- www.wissenschaft.de: Prionen auf verschlungenen Pfaden BSE-Erreger könnten ursprünglich vom Menschen stammen (über einen Artikel in: The Lancet, Bd. 366, S. 856, 2005)
- www.wissenschaft.de: Wie Prionen von Schaf zu Schaf reisen Studie zeigt, dass die infektiösen Eiweiße über den Urin übertragen werden können (über einen Artikel in: Science, Bd. 310, S. 324, 2005)
- Beat Hörnlimann, D. Riesner, H. Kretzschmar: Prionen und Prionenkrankheiten. de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-016361-6
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) (engl. Creutzfeldt Jakob Disease, CJD) ist eine beim Menschen sehr selten auftretende, tödlich verlaufende und durch Prionen gekennzeichnete transmissible Übertragbare spongiforme Enzephalopathie (TSE). Die Prionerkrankung kommt beim Menschen als übertragene, genetische oder sporadische Form vor. Charakteristisch für die Krankheit ist, dass die abnorm gefalteten Prionproteine vor allem im Gehirn den dort normalerweise vorhandenen Vettern mit gesunder Struktur ihre veränderte Struktur aufzwingen und so einen verhängnisvollen biochemischen Prozess auslösen, der letztlich zu einer Degeneration des Gehirns führt. Die krankhaft gefalteten Proteine lagern sich in Nervenzellen zusammen und bilden Klumpen. Die Funktion der Nervenzellen wird zunehmend gestört, es kommt zur Apoptose oder Nekrose. Bei fortschreitender Erkrankung nimmt das befallene Gehirn eine schwammartig durchlöcherte Struktur mit fadenförmigen, proteinhaltigen Ablagerungen an. Im Blut eines erkrankten Menschen sind nur kleinste Mengen der infektiösen Prionen vorhanden.
Die Krankheit wurde zuerst von den beiden deutschen Neurologen Hans-Gerhard Creutzfeldt und Alfons Maria Jakob im Jahr 1920 beschrieben.
Varianten:
CJK/CJD
Diese Erkrankung ist insgesamt die häufigste beim Menschen vorkommende TSE. Die klassische CJK wird in drei bisher bekannte Formen unterteilt:
1. Sporadische Prionerkrankung (sCJK)
Die sporadische Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ist außer im Vereinigten Königreich die häufigste weltweit beim Menschen auftretende Erkrankungsform.
Erreger: Die auslösenden Faktoren sind Prionen.
Häufigkeit: Die Erkrankung kommt weltweit mit einer ähnlichen Häufigkeit von etwa 1:1.000.000 pro Einwohner und Jahr vor. Das Erkrankungsrisiko nimmt mit steigendem Alter zu und der Erkrankungsgipfel liegt um das 70. Lebensjahr. In diesem Alter beträgt die jährliche Erkrankungswahrscheinlichkeit etwa 1:125.000. Danach sinkt das Risiko wieder ab. Vereinzelt erkranken auch junge Menschen. In Deutschland erkranken jährlich etwa 7 jünger als 50 Jahre alte Menschen an einer sporadischen CJK. Die Wahrscheinlichkeit, bereits vor dem 30. Lebensjahr zu erkranken, beträgt etwa 1:3.000.000.
Krankheitsverlauf/Symptome: Der Erkrankungsgipfel dieser Form liegt zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr. Die Erkrankung beginnt zunächst schleichend, dann verliert der Erkrankte unaufhaltsam und rasch fortschreitend seine geistigen Fähigkeiten. Nach und nach treten folgende Symptome auf: Schreckhaftigkeit, motorische Störungen mit Muskelzuckungen, Gedächtnisstörungen, Störungen der Wahrnehmung und Persönlichkeitsveränderungen, Kreislaufprobleme und Verwirrtheit bis hin zur Demenz. In der Regel führt die Erkrankung nach ca. sechs Monaten zum Tod.
2. Genetische Prionerkrankung
In dieser Form wird eine ganze Gruppe von familiär vererbaren Erkrankungen zusammengefasst. Bei all diesen Formen wird eine spezifische Mutation vererbt, welche zu einem fehlerhaften Prion-Protein führt. Diese Krankheitsgruppe ist sehr heterogen und durch variable klinische Symptome gekennzeichnet. Der Erkrankungsgipfel liegt hier insgesamt um das 50. Lebensjahr und damit früher als bei der sporadischen Form. Die Erkrankungsdauer ist häufig länger. Zu diesen Erkrankungsformen zählen die familiäre/genetische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, das Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom (GSS) und die fatale familiäre Insomnie.
3. Übertragene Formen
Eine direkte Übertragung des Erregers von Mensch zu Mensch ist bisher nur auf iatrogenem Weg über Kontakt mit infektiösem Gewebe nachgewiesen worden. Dies geschah besonders früher durch Hypophysentransplantate, Hirnhaut- und Hornhauttransplantate, sowie durch unzureichend sterilisierte neurochirurgische Instrumente. Außerdem wurde eine direkte Übertragung bei aus Leichenhypophysen extrahierten Wachstumshormonen bzw. Gonadotropinen beobachtet. Weltweit sind insgesamt 132 Fälle einer Infektion durch Wachstumshormonpräparate bekannt, wobei die meisten dieser Fälle aus Frankreich und Großbritannien berichtet wurden. In Deutschland wurde bislang noch kein Fall bekannt, obwohl auch hierzulande kleinwüchsige Patienten mit Wachstumshormonen behandelt wurden (Heute werden die Hormone gentechnisch hergestellt). Die meisten Fälle, die mit Hirnhauttransplantaten in Verbindung gebracht werden, traten in Japan auf. Diese Erkrankungen werden fast ausschließlich auf das deutsche Produkt Lyodura von der B.Braun Melsungen AG zurückgeführt. Aufgrund mangelnder Kontrollen der Hirnhautspender, sowie des Herstellungsprozesses, bei dem Hirnhäute ungenügend sterilisiert wurden und es obendrein zu einer Querkontamination gesunder Hirnhäute mit Prionen kam, galt dieses Produkt als besonders gefährlich. Lyodura wurde als eine Art "Pflaster" nicht nur zur Rekonstruktion der Hirnhaut, sondern auch in einer Vielzahl nicht-neurologischer Operationen verwendet, zumal es sich durch geringe Abstoßungsreaktionen auszeichnete.
vCJD
Großbritannien gab am 20. März 1996 bekannt, dass mehrere junge Menschen an einer neuen Variante von CJD gestorben waren.
Übertragung: Diese Variante (heute als vCJD bekannt) wird durch den Verzehr von BSE-verseuchtem Rindfleisch hervorgerufen. Vermutlich ist ein Großteil der Bevölkerung gegen die Ansteckung durch BSE-verseuchte Nahrung resistent, denn alle bisherigen vCJD-Erkrankten hatten eine genetische Veranlagung, die sich nur bei knapp 40 Prozent der europäischen Bevölkerung findet. An einer kritischen Stelle des Gens, welches das Prionen-Eiweiß kodiert, fand sich bei ihnen stets nur die Anweisung zum Einbau der Aminosäure Methionin (homozygot MM). Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist jedoch mischerbig und besitzt zusätzlich ein Gen, das den Einbau von Valin an dieser Stelle bewirkt (heterozygot MV). Es liegt die Schlussfolgerung nahe, dass sich menschliche Prionen leichter von BSE-Prionen umfalten lassen, wenn sie an der bezeichneten Stelle die Aminosäure Methionin enthalten. Nach neueren Erkenntnissen (Ward) sind allerdings auch non-MM-Personen nicht vor Prionenerkrankungen sicher.[2]
Menschen können auch über Bluttransfusionen mit der neuen Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit (vCJD) infiziert werden.
Diagnose: Im August 2005 gaben der Neurologe Claudio Soto und seine Kollegen von der University of Texas (USA) bekannt, dass nunmehr die Rinderseuche BSE und die neue Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit mit einem Bluttest diagnostiziert werden kann. Die Eigenschaft der abnorm veränderten infektiösen Prionen ihre Struktur anderen gesunden Prionen aufzuzwingen, nutzten die Forscher aus, um die im Blut von Erkrankten nur in verschwindend geringer Zahl vorhandenen infektiösen Prionen um den Faktor zehn Millionen zu vermehren und damit leicht nachweisbar zu machen. In Versuchsreihen mit Hamstern ließen sich so die infektiösen Prionen mit einer Zuverlässigkeit von 89% und ohne falsch positive Resultate nachweisen. An der Anwendbarkeit auch für die Diagnose beim Menschen und einer Kontrolle von Blutspenden wird gearbeitet.
Das falsch gefaltete Protein ist gegen die Aufspaltung durch Proteasen resistent, nicht jedoch die normale, gesunde Form von PrP. In der Diagnostik können also die normalen Proteine "verdaut" werden; und wenn Reste auftreten, dann muss es sich um die pathogene Form des Proteins handeln.
Abgesehen davon lassen sich vCJD-Prionen außerdem im Mandel-, Milz- oder Blinddarmgewebe nachweisen, lange bevor sie das Gehirn befallen. Zur Erhärtung des vCJD-Verdachts führt man daher routinemäßig Mandelbiopsien durch. Schon früh nach Ausbruch der Erkrankung zeigt sich zudem im EEG meist ein bestimmtes Signal in der Pulvinar-Region des Thalamus im Gehirn. Bei Vorhandensein dieses Zeichens gilt die Diagnose "vCJD" als sehr wahrscheinlich.
Krankheitsverlauf/Symptome: vCJD unterscheidet sich von klassischer CJD durch das Alter der Patienten von im Durchschnitt 28 Jahren im Vergleich zu 65 Jahren bei der klassischen CJD, durch andere Symptome und einen längeren Krankheitsverlauf von 14 Monaten im Vergleich zu 6 Monaten bei klassischer CJD. Für den Fall, dass die Krankheit durch den Verzehr von Rindfleisch übertragen wird, rechnen Epidemologen mit einer durchschnittlichen Inkubationszeit von 12,6 Jahren. Die Erkrankten zeigen meistens zunächst psychische Symptome, wie Depressionen, Wahnvorstellungen, Stimmungsschwankungen oder Angstzustände. Bereits in diesem Anfangsstadium ist das Kurzzeitgedächtnis gestört. Die Patienten klagen über Müdigkeit und die psychischen Symptome verschlechtern sich progressiv und sprechen meist nicht auf medikamentöse Behandlung an. Nach einigen Monaten kommt es in den meisten Fällen zu andauernden schmerzhaften Missempfindungen (Dysästhesien) am ganzen Körper und zu Schwindel und Übelkeit. Anschließend treten Koordinationsprobleme und andere Bewegungsstörungen wie Zittern, Nystagmus, Dystonie, Lähmungen oder unwillkürliche Muskelzuckungen und -bewegungen (Faszikulationen, Myoklonien, Chorea) sowie epileptische Anfälle auf. Außerdem kommt es zu Inkontinenz. Eine Fehlregulation des Muskeltonus bewirkt Gliederschmerzen und es tritt nun auch die für CJD typische, anfangs schleichende, später rasch fortschreitende Demenz in den Vordergrund. In diesem Verlauf kommt es dann zu Verwirrtheit und Halluzinationen. Die Erkrankung verläuft nun akut und führt in nur wenigen Monaten zum vollständigen Zerfall aller Gehirnfunktionen. Die Patienten verweigern die Nahrungsaufnahme. Gelegentlich sterben die Patienten in dieser Phase an vegetativen Störungen oder fallen ins Koma.
Im Endstadium von vCJD haben die Opfer der Krankheit keinerlei Möglichkeit mehr, Kontakt mit ihrer Umwelt aufzunehmen oder auf einen solchen zu reagieren. Darum werden vCJD-Kranke im Endstadium der Krankheit oft als „The Living Dead“ bezeichnet. Manchmal tritt hierbei eine vollständige spastische Lähmung des Körpers, die sogenannte Enthirnungsstarre, ein. Die Patienten verweilen recht lange in diesem Terminalzustand der Erkrankung, bis sie entweder an einer Pneumonie oder Atemlähmung versterben.
Häufigkeit: Bis zum November 2005 sind in Großbritannien 152 Menschen an vCJD gestorben. Die Zahl der Erkrankungen nimmt derzeit ab, daher gilt die Gefahr als gebannt. Es wurde jedoch vermutet, dass in den nächsten 10 Jahren eine massive Epidemie des „menschlichen Rinderwahnsinns“ Großbritannien heimsuchen wird und womöglich viele Tausend Menschen dieser Krankheit erliegen werden. Erhärtet wurde dieser Vermutung auch durch eine Studie, bei der durch Untersuchungen von entferntem Mandel- und Blinddarmgewebe festgestellt wurde, dass mehrere Tausend Briten den vCJD-Erreger in sich tragen müssen.
Die BBC berichtete allerdings am 12. Januar 2005 von Ergebnissen einer Gruppe von Wissenschaftlern, nach denen eine große Epidemie unwahrscheinlich ist. Dies wird u.a. dadurch gestützt, dass die Zahl der Todesfälle in Großbritannien von 28 im Jahr 2000 auf 9 im Jahr 2004 zurückgegangen ist. Ein erneuter Anstieg der Todesfälle kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Auch in Frankreich sind bereits offiziell 15 Menschen an vCJD erkrankt. Epidemologen führen die Erkrankungen fast ausschließlich auf importiertes britisches Rindfleisch zurück. Sie erwarten für Frankreich insgesamt etwa 50 Todesfälle. Als größter Risikofaktor gilt hierbei der Verzehr von Fast Food mit Separatorenfleisch-Bestandteil (Hamburger, Döner). Ein Großteil der Betroffenen wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 2 Jahre sterben und dürfte bereits jetzt (November 2005) erste Symptome zeigen. Darüberhinaus sind in letzter Zeit in einigen weiteren Europäischen Ländern (Spanien, Italien, Niederlande) erstmals vCJD-Fälle aufgetreten.
Die am meisten gefährdeten Menschen sind zwischen 1980 und 1990 geboren.
Literatur und Weblinks:
- Prionforschungsgruppe Göttingen (Deutsche CJD-Surveillance)
- Deutsche Gesellschaft für Neurologie: Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
- Uni Düsseldorf: Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
- BBC-Bericht (englisch) über die Wahrscheinlichkeit einer größeren Epidemie
- Voraussage der Entwicklung der nvCJD-Fallzahlen in Frankreich (derzeit das am stärksten betroffene Land)
Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom
Das Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndrom (GSSS) (auch Gerstmann-Sträussler-Krankheit oder Gerstmann-Sträussler-Syndrom) ist eine transmissible spongiforme Enzephalopathie (TSE), die durch Prionen hervorgerufen wird, sie ähnelt somit der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Sie basiert auf einer dominant vererbten Mutation im Prion-Protein (PRNP)-Gen, meist im Codon 102, das eine Prävalenz von ca. 1:10.000.000 hat. Das PRNP-Gen befindet sich auf dem kurzen Arm von Chromosom 20 (20pter-p12). Der Gendefekt führt zur Bildung eines fehlerhaften Proteins, dass sich anschließend vornehmlich im Kleinhirn in Form von Amyloid-Plaques ablagert. Symptome sind Ataxie, Dysarthrie und Nystagmus. Später kann sich auch eine Demenz entwickeln. Meist führt die Krankheit innerhalb von 1 bis 11 Jahren nach dem Ausbruch zum Tod.
Die Krankheit ist nach ihren Entdeckern Josef Gerstmann und seinen Mitarbeitern E. Sträussler und I. Scheinker benannt.
Fatale familiäre Insomnie (FFI)
Bei der fatalen familiären Insomnie handelt es sich um eine erbliche, sehr seltene und im Verlauf von Monaten bis Jahren stets tödlich endende übertragbare spongiforme Enzephalopathie (TSE).
Klinik: Die betroffenen Menschen sind meist im mittleren Alter und werden auffällig durch zunehmende Probleme der Körperregulation (progrediente Insomnie und Dysautonomie). Hinzu kommen im weiteren Verlauf der Krankheit Ataxien, Myokloni, Dysarthrie, Gedächtnis- und Orientierungsstörungen bis hin zur Demenz. Zur Diagnostik werden unter anderem die Polysomnographie und die EEG eingesetzt. Es gibt keine Behandlungsmöglichkeit und die Patienten sterben innerhalb weniger Jahre.
Genetik: Die FFI ist autosomal dominant erblich, d.h. Kinder von betroffenen Menschen erkranken jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% und alle betroffenen Menschen haben ein betroffenes Elternteil. Verantwortlich ist eine zum Aminosäureaustausch führende Mutation im für das Prionprotein kodierenden Gen.
Epidemiologie: FFI galt selbst unter den Prionkrankheiten als äußerst selten. In letzter Zeit wurden etwas mehr Fälle diagnostiziert, was vermutlich auf eine Verbesserung der Diagnostik zurückzuführen ist. Auch wenn man von weiteren unentdeckten Fällen ausgeht, bleibt es vermutlich eine sehr seltene Erkrankung. Über den gesamten Globus verteilt gibt es eine zweistellige Anzahl an betroffenen Familien. Auch in Deutschland und Österreich gibt es Fälle.
Geschichte: Die Krankheit wurde 1986 erstmals beschrieben, wobei sie damals nicht als TSE erkannt wurde. 1992 wurde die zur Krankheit führende Mutation im PRNP-Gen beschrieben und 1995 die experimentelle Übertragbarkeit nachgewiesen. Die merkwürdig erscheinende Tatsache, dass eine Erbkrankheit übertragbar ist, ergibt sich aus den Besonderheiten der Prionkrankheiten.
Durch die „BSE-Krise“ und das Auftreten von vCJD in den 1990er Jahren wurde das Interesse der Öffentlichkeit an den TSE und damit auch in gewissem Umfang an FFI geweckt.
Literatur und Weblinks:
- Montagna P, Gambetti P, Cortelli P, Lugaresi E.: Familial and sporadic fatal insomnia. Lancet Neurol. 2003 Mar;2(3):167-76. Review.
- Lugaresi E, Medori R, Montagna P, Baruzzi A, Cortelli P, Lugaresi A, Tinuper P, Zucconi M, Gambetti P.: Fatal familial insomnia and dysautonomia with selective degeneration of thalamic nuclei. N Engl J Med. 1986 Oct 16;315(16):997-1003.
- Medori R, Tritschler HJ, LeBlanc A, Villare F, Manetto V, Chen HY, Xue R, Leal S, Montagna P, Cortelli P, et al.: Fatal familial insomnia, a prion disease with a mutation at codon 178 of the prion protein gene. N Engl J Med. 1992 Feb 13;326(7):444-9.
- Tateishi J, Brown P, Kitamoto T, Hoque ZM, Roos R, Wollman R, Cervenakova L, Gajdusek DC.: First experimental transmission of fatal familial insomnia. Nature. 1995 Aug 3;376(6539):434-5.
Kuru
Bei Kuru handelt es sich um eine Prionenkrankheit, die im 20. Jahrhundert epidemieartig beim Stamm der Fore in Papua-Neuguinea und in geringerem Ausmaß bei einigen Nachbarstämmen auftrat.
Die Krankheit äußert sich vor allem in Bewegungsstörungen und führt nach 12 Monaten zum Tod. Symptome sind Gang- und Standunsicherheiten im Sinne einer cerebellären Ataxie, rhythmischer Tremor und im weiteren Verlauf unnatürliches Lachen, weswegen die Krankheit auch Lachkrankheit genannt wird.
Nachdem das Hochland von Papua-Neuginea erst in den 30er Jahren überhaupt erste Kontakte mit der Zivilisation hatte, wurde die Krankheit in der zweiten Hälfte der 50er Jahre erstmals beschrieben und untersucht. Besonders verdient machte sich dabei D. C. Gajdusek. Als Ursache der Krankheit, die damals von den gut 10.000 Fore jährlich über 200 Opfer forderte, nahm man zunächst eine genetische Ursache an. Intensive Suche nach Umweltgiften oder Infektionsquellen blieben auch erfolglos, nachdem die genetische Hypothese aus epidemiologischen Gründen immer unwahrscheinlicher wurde. Erst nachdem W. J. Hadlow die (neuropathologische) Ähnlichkeit mit der damals schon als übertragbar bekannten Scrapie erkannte, untersuchte man die Übertragbarkeit der Kuru auf Affen unter langer Beobachtungszeit und war damit in den 60er Jahren erfolgreich. Nach weiteren jahrzehntelangen medizinischen, epidemiologischen und anthropologischen Forschungen etablierte sich die Hypothese, dass Kuru bei den Fore durch Endokannibalismus (Verzehr von Fleisch verstorbener Stammesgenossen) und den im Zusammenhang damit stehenden Umgang mit hochinfektiösem Gehirn übertragen wurde. Da der Kannibalismus 1954 (aus anderen Gründen) verboten worden war, nahm auch die Häufigkeit der Erkrankungen stetig ab, um gegen Ende des Jahrhunderts auf Null zu gehen.
Retrospektiv wurde ein Beginn der Epidemie an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eruiert, vermutlich von einem einzigen (sporadischen) Fall ausgehend. Frauen und Kinder, die sich beim Umgang mit dem infektiösen Gehirn auf parenteralem Weg infizierten, erkrankten vermutlich nach kurzer Inkubationszeit, während die alleinige orale Aufnahme zu einer Erkrankung erst nach Jahrzehnten führte. Männer waren vermutlich allgemein weniger betroffen, da sie das kaum infektiöse Muskelfleisch zu sich nahmen.
Die Kuru ist medizinhistorisch von großem Interesse, wurde aber von einer breiteren Öffentlichkeit vor allem nach dem Auftreten von BSE und vCJD in den 90er Jahren beachtet.
Das Wort Kuru stammt aus der Sprache der einheimischen Bevölkerung und bedeutet „Muskelzittern“.
Literatur und Weblinks:
- Bons N, Mestre-Frances N, Belli P, Cathala F, Gajdusek DC, Brown P.: Natural and experimental oral infection of nonhuman primates by bovine spongiform encephalopathy agents.Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 Mar 30;96(7):4046-51.
- Gibbs CJ Jr, Asher DM, Kobrine A, Amyx HL, Sulima MP, Gajdusek DC.: Transmission of Creutzfeldt-Jakob disease to a chimpanzee by electrodes contaminated during neurosurgery. Neurol Neurosurg Psychiatry. 1994 Jun;57(6):757-8.
- Tateishi J, Brown P, Kitamoto T, Hoque ZM, Roos R, Wollman R, Cervenakova L, Gajdusek DC.: First experimental transmission of fatal familial insomnia. Nature. 1995 Aug 3;376(6539):434-5.
BSE
BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie, deutsch: "das Rind betreffende, schwammartige Gehirnkrankheit") ist eine durch Prionen verursachte tödliche Erkrankung des Gehirns vor allem bei Schlachtrindern.
Übertragung: Aufgrund epidemiologischer Studien wird mehrheitlich als Ursache der Verzehr infektiösen Futters angenommen. In England wurden seit den 70er Jahren Schlachtabfälle unzureichend erhitzt (zusätzlich bei zu geringen Überdruck), so dass vermutet wird, dass der Scrapie-Erreger nicht zerstört wurde. Die Schlachtabfälle enthielten viel Material von Schafen, da die Schafpopulation in England groß ist. Das Tiermehl aus diesen Tierkörperverwertungsanlagen wurde unter anderem auch an Rinder verfüttert. Damit kamen die Tiere mit dem Scrapie-Erreger in Kontakt und laut der gängigen Theorie konnte dadurch das spezifische PrPSc entstehen.
Rund 5-10% der Kälber von BSE-kranken Kühen entwickeln BSE, eine maternale (von der Mutter auf das Kalb) Übertragung ist aber derzeit (Stand 2004) nicht gesichert. Es besteht weiter der Verdacht, dass die Übertragung durch die statt der Kuhmilch verfütterte Kälberersatznahrung erfolgte. Zumindest in Deutschland sind heute tierische Fette im Rinderfutter gänzlich verboten.
Rinder erkranken in der Regel im Alter von 4-5 Jahren an BSE und sterben dann innerhalb weniger Monate. Die Inkubationszeit (d. h. die Zeit ab Befall durch Erreger bis zur sichtbaren Krankheitsentfaltung) beträgt aber mehrere Jahre.
Neuere Forschungen zeigen, dass BSE-verwandte Krankheiten bei Schafen, Elchen und Hirschen auch über den Urin verbreitet werden: Schafe und wildlebende Tiere kommen schließlich niemals mit Tiermehl in Kontakt.
Krankheitsverlauf/Symptome: Bei der Krankheit wird das Gehirn schwammartig durchlöchert und damit in seinen Funktionen gestört. In diesem schwammartig durchlöcherten Gewebe lassen sich dann die o.g. Prionen nachweisen.
Die betroffenen Tiere zeigen Verhaltensänderungen und Bewegungsstörungen. Die Rinder beginnen zu straucheln, stolpern über die eigenen Beine und reagieren schreckhaft auf Lärm und Lichtreize. Muskelzittern, Zungenspiel und gelegentlich lebhaftes Ohrenspiel und Juckreiz werden beobachtet.

Die Diagnose erfolgt durch eine genaue Untersuchung eines spezifischen Gehirnabschnitts (Obex-Region) eines toten Tiers.
Die Methoden lassen sich gliedern in:
- Histologie: Nachweis der Vakuolen (Hohlräume)
- Immunhistochemie: Nachweis der Prionen
- seit 1999: Schnelltests (bekannt als BSE-Test) (ELISA, Western-Blot): Antikörper auf PrPSc
Beim Schnelltest werden Blutproben aus dem Gehirn entnommen und in 2 Fraktionen geteilt. Zu einer gibt man das Proteasen zu, welches das gesunde PrPc abbaut, das veränderte PrPsc allerdings nicht. Die zweite Fraktion bleibt unbehandelt. Nun werden beide Proben mittels Western Blot aufgetrennt. Ist das Tier gesund, erscheint auf dem Gel keine Bande, da das gesunde Protein abgebaut wurde. Ist das Tier aber krank, enthält also das veränderte Protein PrPsc, kann man in der Protease+ und in der Protease- Probe jeweils eine Bande erkennen, die jeweils PrPsc darstellen.
Sowohl die Prionen als auch die Vakuolen sind erst im Spätstadium der Erkrankung nachzuweisen, sodass die Europäische Union beschlossen hat, Rinder erst ab 24-30 Monate (je nach Untersuchungskategorie) untersuchen zu lassen.
Ein Nachweis von Prionen am lebenden Tier war lange Zeit nicht möglich. Am 11. Juli 2005 wurden von Brening et al. an der Universität Göttingen mit einer erfolgreichen, großen klinischen Studie ein Test vorgestellt, der erstmals auch an lebenden Tieren zuverlässig angewandt werden kann. Möglicherweise könnte dieses neue Verfahren schon 2006 in Deutschland zugelassen werden.
Im August 2005 gaben der Neurologe Claudio Soto und seine Kollegen von der University of Texas (USA) bekannt, dass nunmehr die Rinderseuche BSE und die neue Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit mit einem Bluttest zu diagnostizieren ist. Die Eigenschaft der abnorm veränderten infektiösen Prionen ihre Struktur anderen gesunden Prionen aufzuzwingen, nutzten die Forscher aus, um die im Blut von Erkrankten nur in verschwindend geringer Zahl vorhandenen infektiösen Prionen um den Faktor zehn Millionen zu vermehren und damit leicht nachweisbar zu machen. In Versuchsreihen mit Hamstern ließen sich so die infektiösen Prionen mit einer Zuverlässigkeit von 89% und ohne falsch positive Resultate nachweisen. An der Anwendbarkeit auch für die Diagnose beim Menschen und einer Kontrolle von Blutspenden wird gearbeitet.
Ausbreitung: Nach Angaben der Vereinten Nationen nahm die Anzahl der BSE-Fälle in den letzten drei Jahren stetig ab. Während es 2003 weltweit noch 1646 Fälle gegeben habe, wurden 2004 noch 878 und 2005 nur noch 474 Krankheitsfälle festgestellt.
Nach der Entwicklung der Schnelltests 2000 setzte die Phase der aktiven Überwachung in der Europäischen Union (EU) ein und in vielen Mitgliedsstaaten wurden erst dann BSE-Fälle offiziell bestätigt. Die vorherige passive Überwachung beruht allein auf der Meldepflicht der Menschen, die mit Rindern Umgang haben und erwies sich als unzureichend.
Deutschland: Der erste offiziell nachgewiesene Fall von BSE wurde für Deutschland am 26. November 2000 amtlich bestätigt; bis Februar 2005 sind allein in Deutschland über 360 Fälle nachgewiesen worden, davon 2004 65 und 2003 54. 2006 gab es bislang 3 bestätigte BSE Fälle. Seit Beginn der Kontrollen wurden bisher etwa 900.000 Proben durchgeführt.
Frankreich: Im November 2004 wurde in Frankreich bei einer Ziege der Verdacht auf eine Infektion mit einer TSE festgestellt, die mit Hilfe von Tests nicht eindeutig von der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE) zu unterscheiden war.
Grossbritannien: 1985 und 1986 wurde BSE erstmals in Kent (England) bei zehn Rindern festgestellt. Möglicherweise war aber BSE unter dem Namen Stoddy bereits in Yorkshire schon etwas länger bekannt. Die Fallzahlen stiegen daraufhin bis 1992 auf über 36.000 an, um dann wieder zu sinken.
Nachdem bereits in 17 Ländern Importverbote für einzelne britische Rinder-Produkte bestanden, erließ Frankreich am 30. Mai 1990 ein vollständiges Verbot.
Österreich: In Österreich ist im November 2001, rund ein Jahr nach der flächendeckenden Einführung der BSE-Schnelltests, der erste Fall aufgetreten. Es handelte sich um ein aus Tschechien in das Waldviertel (Niederösterreich) importiertes Tier. Ein zweiter Fall trat im Juni 2005 im Vorarlberger Kleinwalsertal auf. Das Rind ist allerdings schon 1994 geboren. Den dritten Fall, so wurde am 28. Oktober 2005 bekannt, gab es in einem Schlachthof in Salzburg. Am 13. Mai 2006 wurde in einem Schlachthof im Mühlviertel in Oberösterreich der vierte Fall bekannt. Es handelte sich dabei um eine 6 Jahre alte Kuh aus einem Bergbauernhof.
Schweiz: Ebenfalls 1990 wurde der erste offizielle Fall in der Schweiz bestätigt. 1995 wurde der vorläufige Höhepunkt mit 68 Fällen erreicht und 1999 nochmal ein Höhepunkt mit 50 Fällen. Wie das Bundesamt für Veterinärwesen am 1. Juli 2004 mitteilte, ist in der Schweiz der weltweit erste Fall einer BSE-Erkrankung bei einem Buckelrind entdeckt worden. Betroffen ist ein 18-jähriges Zwerg-Zebu aus dem Zoo Basel.
USA: In den USA wurde der erste Fall Ende 2003 festgestellt; dabei handelte es sich wahrscheinlich um ein ca. zwei Jahre zuvor aus Kanada importiertes Tier.
Eindämmung der Ausbreitung: Alle bei Tieren auftretenden spongiforme Enzephalopathien sind in Deutschland anzeigepflichtig. Jeder Verdacht ist sofort dem zuständigen Veterinäramt zu melden. Ist auch nur ein Tier einer Herde infiziert, so wird versucht, eine Übertragung auf andere Herden zu vermeiden. Dies geschieht vor allem durch Eliminierung einer Herde, also durch Schlachtung und hat sich als sehr wirkungsvoll herausgestellt. Es sei hierbei angemerkt, dass bestimmte Rinder auch eine erbliche Veranlagung dazu haben, BSE zu entwickeln (die Krankheit trat beispielsweise gehäuft bei Tieren der Frisian-Holstein-Rinderrasse auf). Schlachtet man BSE-verseuchte Herden, so löscht man auch die genetische Disposition für BSE bei Rindern aus.
Da das Auftreten der Krankheit auf infektiöses Tierfutter zurückgeführt wird, gab und gibt es in betroffenen Nationen Sicherheitsvorschriften zur Herstellung von diesem Tiermehl. So wurde in England 1988 verboten, verendete Rinder erneut zu Rinder-Futter zu verarbeiten. Diese Maßnahme bewirkte dort sehr wahrscheinlich den Rückgang der Epidemie ab 1993.
Weiter steht das Insektenvernichtungsmittel Phosmet im Verdacht, BSE-Infektionen zu begünstigen oder die Inkubationszeit zu verkürzen. Von 1982 bis 1992 mussten in England sämtliche Rinder damit hochdosiert behandelt werden, um die Dasselfliegen-Plage zu bekämpfen. Obgleich umstritten, wird Phosmet auch heute noch eingesetzt.
Aufgrund einer EU-Vorschrift müssen seit dem Jahre 2001 von älteren Tieren Gewebe mit hoher Erregerkonzentration (Hirn, Rückenmark, Milz) bereits bei der Schlachtung entfernt und entsorgt werden. So soll das Risiko einer Übertragung auf Menschen minimiert werden. Auch die Verarbeitung von Rinderdärmen zur Wurstherstellung ist in Deutschland und Frankreich verboten. In Südamerika ist die Krankheit bisher noch nicht nachgewiesen worden. Wenn Rinderdärme in Deutschland zur Produktion von Wurst Verwendung finden, so sind dies immer aus Südamerika importierte Därme.
Literatur und Weblinks
- Beat Hörnlimann, D. Riesner, H. Kretzschmar: Prionen und Prionenkrankheiten. de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-016361-6
- Anonymus: Die bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) des Rindes und deren Übertragbarkeit auf den Menschen. Bundesgesundheitsblatt 44(5), S. 421 - 431 (2001), ISSN 1436-990
- European Communities: Report on the monitoring and testing of ruminants for the presence of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) in the EU in 2003, including the results of the survey of prion protein genotypes in sheep breeds. 2004, ISSN 1725-583X, ISBN 92-894-7431-9. Als PDF hier
- D. Heim, U. Kihm: Risk management of transmissible spongiform encephalopathies in Europe. Revue scientifique et technique de l office international des Epizooties. Band 22 (1). 2003. S. 179 -199, ISSN 0253-1933
- M.J. Prince, J.A. Bailey, P.R. Barrowman, K.J. Bishop, G.R. Campbell, J.M. Wood: Bovine spongiform encephalopathy. Revue scientifique et technique de l office interntaional des Epizooties. Band 22 (1), 2003. S. 37-60, ISSN 0253-1933
- S. Modrow, D. Falke, U. Truyen: Molekulare Virologie, 2. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag/Gustav Fischer Verlag, Heidelberg/Berlin 2003, ISBN 3-8274-1086-x
- Ekkehard Schütz, Howard B. Urnovitz, Leonid Iakoubov, Walter Schulz-Schaeffer, Wilhelm Wemheuer, Bertram Brenig: Bov-tA short interspersed nucleotide element sequences in circulating nucleic acids from sera of cattle with bovine spongiform encephalopathy (BSE) and sera of cattle exposed to BSE. Clin. Diagn. Lab. Immunol. 12: 814-20 (2005).
- ↑ Nicole T. Watt, David R. Taylor, Andrew Gillott, Daniel A. Thomas, W. Sumudhu S. Perera, and Nigel M. Hooper: Reactive Oxygen Species-mediated ß-Cleavage of the Prion Protein in the Cellular Response to Oxidative Stress. Journal of Biological Chemestry 2005 Vol. 280, NO.43, pp 35914-35921 Volltext
- ↑ Ward H J T: Evidence of a new human genotype susceptible to variant CJD. Euro Surveill 2006 11(6):E060601.3 online
Allgemeines
Als Virus (Singular: das Virus, Plural: die Viren; von lat. virus „Schleim, Saft, Gift“) bezeichnet man in der Biologie genetische Elemente in Form von Nukleinsäuren, die als Fremdbestandteile in Zellen von Lebewesen („Wirtszellen“) unabhängig von deren eigenen Nukleinsäuren mit Hilfe der Replikationseinrichtungen dieser Zellen repliziert werden. Virus-Nukleinsäuren sind entweder Desoxyribonukleinsäuren (DNA) oder Ribonukleinsäuren (RNA). Bestimmte Viren befallen Zellen von Pflanzen, Menschen, Tieren oder anderen Eukaryoten. Viren, die Bakterien als Wirte nutzen, werden Bakteriophagen genannt. Eine typische Virusinfektion bei Säugetieren ist eine zyklische Allgemeininfektion oder eine Lokalinfektion an den Atemwegen oder am Darm.
Eigenschaften von Viren


Viren kommen sowohl als Nukleinsäure in den Wirtszellen als auch als freie und infektiöse Partikel außerhalb von Zellen vor.
Ein Viruspartikel außerhalb von Zellen bezeichnet man als Virion (Plural Viria, Virionen). Virionen bestehen aus einem zusammengepackten Nukleinsäuremolekül (Kern, Core), das von einer Proteinhülle (Kapsid) umgeben ist und mit diesem zusammen als Nukleokapsid bezeichnet wird. Das Kapsid setzt sich aus identischen Proteineinheiten, den Kapsomeren zusammen. Einige Virenarten besitzen außer einer Proteinhülle noch eine Lipoproteinhülle (Envelope), die meist von der Zellmembran der Wirtszelle abstammt und in die verschiedene Glykoproteine eingelagert sein können, die z.T. als Spikes deutlich herausragen.
Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel, weder Ribosomen noch Mitochondrien. Daher können sie sich auch nicht selbst replizieren. Im Wesentlichen ist ein Virus also eine Nukleinsäure, auf der die Informationen zur Steuerung des Stoffwechsels einer Wirtszelle enthalten sind, insbesondere zur Replikation der Virus-Nukleinsäure und zur weiteren Ausstattung der Viruspartikel (Virionen).
Viren sind deutlich kleiner als Bakterien, jedoch etwas größer als Viroide.
Sind Viren Lebewesen?
Ob Viren als Lebewesen bezeichnet werden können, ist abhängig von der Entscheidung für eine der unterschiedlichen Definitionen von Leben (siehe unten: Kontroversen). Eine einzige, unwidersprochene und damit allgemein anerkannte Definition diesbezüglich gibt es bislang nicht. Daher findet sich auch unter Wissenschaftlern keine Einigkeit in der Beantwortung dieser Frage. Hinsichtlich der Einordnung von Viren zu den Parasiten bestehen ebenfalls verschiedene Ansichten. Ein Teil der Wissenschaftler betrachtet sie als solche, da sie einen Wirtsorganismus infizieren, um seinen Stoffwechsel für ihre eigene Vermehrung zu benutzen. Diese Forscher definieren also Viren als obligat intrazelluläre Parasiten (Lebensform, die zwangsläufig nur innerhalb einer Zelle ein Parasit ist), die aus einem Genom, einem Kapsid und eventuell einer Membranhülle bestehen und zur Replikation eine Wirtszelle benötigen. Das bedeutet, dass Viren zwar spezifische genetische Informationen besitzen, aber nicht den für ihre Replikation notwendigen Synthese-Apparat.
Evolution der Viren


Viren sind vermutlich später als andere Lebewesen (falls man Viren zu den Lebewesen zählt) entstanden, da sie auf letztere angewiesen sind. Entstehungsmechanismen lassen sich im Zusammenhang mit Plasmiden oder Transposonen verstehen. Für eine späte Entstehung spricht auch, dass Viren, die Eukaryonten befallen, das alternative Splicing der Eiweißsynthese nutzen. Dementsprechend besitzt ihr Erbgut variante Introns und Exons.
Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien als Wirte nutzen.
Virentypen
Die Größe von Viren liegt zwischen 10 nm und 400 nm. Damit sind fast alle Viren nur unter dem Elektronenmikroskop erkennbar. Eine Ausnahme bilden Pockenviren, die unter dem Lichtmikroskop als kleine Partikel sichtbar werden, ebenso das erst 2003 entdeckte Mimivirus, mit 400 nm (eine Untersuchung von 2004 nennt den Wert 800 nm) das größte bisher bekannte Virus. Zum Vergleich: Tabakmosaikvirus (300 nm), Bakteriophagen (200 nm), Herpesviren (200 nm), Masernviren (180 nm), Tollwutviren (180 nm), Grippeviren (100 nm), Adenoviren (90 nm), Rötelnviren (80 nm) und Poliovirus (25 nm). Die Struktur der Proteinhülle, und damit die Virusart, kann u. a. nach Kristallisation durch Röntgenbeugung entschlüsselt werden. Das Gewicht bei Viren der Pockenschutzimpfung beträgt nach einer Messung amerikanischer Forscher 10 fg. Es ist allerdings noch (2005) umstritten, ob es sich um einen Virus oder eine höhere Stufe von Leben handelt.
Nach ihrer Erbinformation unterscheidet man zwischen DNA-Viren und RNA-Viren. Die für den Menschen sehr bedeutenden Retroviren, wie beispielsweise HIV, sind RNA-Viren. Die Erbinformation kann einzelsträngig oder doppelsträngig, segmentiert oder unsegmentiert, und linear oder zirkular sein.
Viren haben entweder eine Lipoproteinhülle oder sind hüllenlos. Das Proteinkapsid kann unterschiedliche Form haben, zum Beispiel ikosaederförmig, isometrisch, helikal oder geschossförmig. Ikosaeder bestehen aus 20 gleichseitigen Dreiecken (Kapsomeren). Jedes dieser Kapsomere besteht zur Formung eines Dreiecks aus 3 oder 3n Proteinen. Daher besteht das Kapsid solcher Viren meist aus 60n Proteinen (20 x 3n), also 60, 120, 180, 240 usw. Proteinen.
Behüllte Viren

Die Lipidhülle stammt von der Wirtszelle und dient zur Tarnung vor dem Immunsystem. Umhüllte Viren sind besser geeignet, chronische oder latente Infektionen hervorzurufen (wie zum Beispiel HIV, chronische Hepatitis B, C oder D, oder Herpes). Sie werden aber leicht deaktiviert, wenn die Hülle austrocknet oder chemisch durch Seife oder Gallensäuren angegriffen wird. Deshalb werden umhüllte Viren meist durch Tröpfcheninfektion übertragen und infizieren dann den Atemtrakt (Lokalinfektion). Manche erzeugen von dort aus auch eine zyklische Allgemeininfektion (Kinderkrankheiten: Masern, Mumps, Röteln, Ringelröteln, Drei-Tage-Fieber, Windpocken). Manche werden sogar nur durch mehr oder weniger direkten Blutkontakt übertragen. Dabei spielt dann auch die Replikationsrate eines Virus (Viruslast), also die Zahl der Kopien pro Milliliter Blut, eine Rolle. Hepatitis B ist ein sehr stark replizierendes Virus, hier können Blutspritzer auf der scheinbar intakten Haut genügen, um durch Mikro-Läsionen einzudringen. HIV wird hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen. Bei Hepatitis C dagegen ist selbst das sehr selten, es wird unter anderem durch infizierte Spritzen übertragen.
Unbehüllte Viren
Hüllenlose Viren können sehr umweltstabil sein und sowohl Austrocknung als auch Desinfektionsmittel überstehen. Hygienische Maßnahmen, wie beispielsweise Händewaschen oder Putzen, dienen hier eher dazu, möglichst viele Viren wegzuschwemmen. Teilweise lässt sich Übertragung innerhalb eines Haushalts aber kaum vermeiden. Hüllenlose Viren werden deshalb leicht per Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion übertragen und infizieren den Darm, meist als Lokalinfektion, seltener als zyklische Allgemeininfektion (zum Beispiel Poliovirus). Sie bleiben nicht chronisch.
Der Lebenszyklus von Viren

1. Adsorption (attachment): Das Virus dockt an Rezeptoren der Wirtszelle an.
2. Injektion: Bakteriophagen injizieren ihre Nukleinsäuren in die Zelle, während das Kapsid außen bleibt. Die meisten tierischen Viren wandern als Ganzes in die Zelle, indem sie z.B. die Endozytose aktivieren.
3. Uncoating: Das Virus befreit sich von seiner Proteinhülle und setzt sein Genom frei.
4. Replikation: Das Virusgenom wird in das Wirtsgenom integriert, transkribiert und translatiert. (Das Virus kann auch latent und nur als DNA-Sequenz abgespeichert als sogenannter Provirus in der Zelle verbleiben, so z.B. bei Herpes labialis, und den Zeitpunkt für die Replikation selbst wählen).
5. Assembly (Zusammenbau): Die synthetisierten Bauelemente (Proteine, DNA/RNA) organisieren sich zu neuen Viruspartikeln.
6. Freisetzung: Die Viren werden je nach Virus-Species durch Knospung (budding) oder Lysierung der Zelle freigesetzt.
Die Auswirkung der Virusvermehrung auf die Wirtszelle nennt man zytopathischer Effekt. Es gibt verschiedene Arten des zytopathischen Effekts: Zelllyse, Pyknose (Polioviren), Zellfusion (Masernvirus, HSV, Parainfluenzavirus), intranucleäre Einschlüsse (CMV, Adenoviren, Masernvirus), intraplasmatische Einschlüsse (Tollwutvirus, Pockenvirus).
Variabilität
Höher organisierte Lebewesen haben per Rekombination bei der geschlechtlichen Fortpflanzung eine sehr effektive Möglichkeit der genetischen Variabilität besonders in Richtung einer Umweltanpassung und damit Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Art entwickelt. Virionen beziehungsweise Viren zeigen als überdauerungsfähige Strukturen, die für ihre Vermehrung und damit auch Ausbreitung auf lebende Wirte angewiesen sind, ohne geschlechtliche Fortpflanzung allein mit ihrer Mutationsfähigkeit eine mindestens ebenbürtige Möglichkeit für eine genetische Variabilität.
Dabei ist es dann letztlich unerheblich, dass diese Mutationen im Genom der Viren im Grunde zu allererst auf Kopierfehler während der Replikation innerhalb der Wirtszellen beruhen. Was zählt, ist allein der daraus für die Arterhaltung resultierende positive Effekt der extremen Steigerung der Anpassungsfähigkeit. Während Fehler dieser Art zum Beispiel bei einer hochentwickelten Säugetierzelle zum Zelltod führen können, beinhalten sie für Viren sogar einen großen Selektionsvorteil.
Kopierfehler bei der Replikation drücken sich in Punktmutationen, also im Einbau von falschen Basen an zufälligen Genorten aus. Da Viren im Gegensatz zu den höherentwickelten Zellen nur über wenige oder gar keine Reparaturmechanismen verfügen, werden diese Fehler nicht korrigiert.
Sonderformen der genetischen Veränderung bei Viren werden beispielsweise bei den Influenza-Viren mit den Begriffen Antigendrift und Antigenshift (genetische Reassortierung) dort genau beschrieben.
Virologie
Die Virologie beschäftigt sich mit Viren, deren Eigenschaften und Vermehrung, sowie mit der Prävention und Behandlung von Viruserkrankungen.
Die erste bekannte Anwendung des Wissens über Viren findet sich bereits 1000 Jahre v. Chr. in China. Dort wurde der Schorf der Wunden von Pockenkranken, welche die Krankheit überlebt hatten, zu Staub gemahlen und inhaliert, um vor Pocken zu schützen (impfen). Im Jahre 1796 benutzte Edward Jenner ein ähnliches Verfahren, um den 8-jährigen James Phipps gegen Pocken zu impfen.
Die moderne Virologie nutzt vor allem molekularbiologische und molekulargenetische Untersuchungsverfahren und beschäftigt sich mit der Gestalt und Größe, dem Aufbau, der chemischen Zusammensetzung und dem Nachweis von Viren, des weiteren mit ihrer Vermehrung, ihrer Übertragung und ihren krankheitsauslösenden Eigenschaften. Erforscht werden auch die Wechselwirkungen der Viren mit ihren Wirtszellen. Die Virologie versucht ferner, die Vielzahl der existierenden Viren zu klassifizieren.
Virenklassifikation
Viren können aufgrund verschiedener Merkmale klassifiziert werden:
- aufgrund ihrer Größe (Filtrierbarkeit)
- aufgrund ihrer Form
- aufgrund ihrer Hülle
- aufgrund der Organismen, die sie infizieren
- aufgrund des Übertragungsweges
- aufgrund der Krankheit, die sie verursachen
- aufgrund der Form ihrer Nukleinsäure: Einzelstrang oder Doppelstrang, (+)- oder (-)-Polarität, DNA oder RNA
Das klassische System der Virusklassifikation
Im Jahre 1962 wurde von André Lwoff, R.W. Horne und P. Tournier entsprechend der von Carl von Linné begründeten binären Klassifikation der Lebewesen eine Taxonomie der Viren eingeführt.
In ihr werden analog zur Taxonomie anderer Lebewesen, die folgenden Taxa unterteilt:
- Genom-Gruppe
- Ordnung (...virales)
- Familie (...viridae)
- Unterfamilie (...virinae)
- Gattung (...virus)
- Art (<Krankheit> virus)
- Gattung (...virus)
- Unterfamilie (...virinae)
- Familie (...viridae)
- Ordnung (...virales)
Die entscheidenden Charakteristika für diese Klassifikation waren.
- 1. die Natur des viralen Genoms (DNA oder RNA)
- 2. die Symmetrie des Kapsids
- 3. Vorhandensein einer Lipidumhüllung
- 4. Größe von Virion und Kapsid
Die Baltimore-Klassifikation
Auf Grundlage des Wissens um die Molekularbiologie der Viren hat sich eine weitere Klassifikation etabliert, welche auf den Nobelpreisträger David Baltimore zurückgeht.
Die verschiedenen Möglichkeiten ergeben sich dadurch, dass ein Strang der doppelsträngigen DNA, so wie sie in allen anderen Lebewesen vorliegt, redundant ist und daher entfallen kann. Ebenso kann das Virusgenom auch in verschiedenen Formen der RNA vorliegen, die in Zellen als Zwischenstufe bei der Proteinsynthese auftreten. Bei einzelsträngiger RNA kommen beide möglichen Kodierungsrichtungen vor. Die normale Richtung 5'->3', die als (+) Polarität bezeichnet wird, wie sie in der mRNA vorliegt, und die komplementäre Richtung (-), in der die RNA quasi als Negativ vorliegt.
Es gibt daher bisher nur 3 Ordnungen, und viele Familien sind noch keiner Ordnung zugeordnet. Derzeit sind ca. 80 Familien und ca. 4000 Arten bekannt.
- Baltimore-Gruppe I: Doppelstrang-DNA - dsDNA. Normale Genom-Form allen Lebens.
- Baltimore-Gruppe II: Einzelstrang-DNA - ssDNA. Enthält DNA sowohl positiver als auch negativer Polarität.
- Baltimore-Gruppe III: Doppelstrang-RNA - dsRNA
- Baltimore-Gruppe IV: Positive Einzelstrang-RNA - ss(+)RNA. Sie wirkt direkt als mRNA.
- Baltimore-Gruppe V: Negative Einzelstrang-RNA - ss(-)RNA. Sie wirkt als Matrize zur mRNA Synthese.
- Baltimore-Gruppe VI: Positive Einzelstrang-RNA, die in DNA zurückgeschrieben, und ins Zellgenom eingebaut wird.
- Baltimore-Gruppe VII: Doppelstrang-DNA, die zur Replikation einen RNA-Zwischenschritt benutzt.
Die Baltimore-Klassifikation wurde mittlerweile weiterentwickelt und von der sehr ähnlichen, aber in mancher Hinsicht aussagekräftigeren Viren-Taxonomie des International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) abgelöst.
Die aktuelle Viren-Taxonomie des International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)
Aktuell werden die Viren nach der Virus-Taxonomie des International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) klassifiziert. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Tabelle (gleichzeitig Inhaltsverzeichnis) mit der Einordnung der wichtigsten humanpathogenen Virenarten (ohne Aufführung der Serotypen) nach der neuen ICTV-Systematik vom 27. Mai 2005 [1]. Um den Bezug zur Morphologie herzustellen wurde in den letzten beiden Spalten noch einmal die Kapsidsymmetrie und die Art der Umhüllung aufgeführt.
Über die Virusfamilie gelangen Sie zur Beschreibung der einzelnen Virenarten.
DNA-Viren
| Ordnung | Familie | Subfamilie | Genus | Art | Umhüllung | Kapsid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsDNA-Viren | ||||||
| Poxviridae | Chordopox-virinae | Orthopoxvirus | Vaccinia virus | umhüllt | komplex | |
| Variola virus | ||||||
| Parapoxvirus | Orf virus | |||||
| Molluscipox-virus | Molluscum contagiosum virus | |||||
| Herpesviridae | Alphaherpes-virinae | Simplexvirus | Human herpesvirus 1 | umhüllt | ikosaedrisch | |
| Human herpesvirus 2 | ||||||
| Varicellovirus | Human herpesvirus 3 | |||||
| Betaherpes-virinae | Cytomegalo-virus | Human herpesvirus 5 | ||||
| Roseolovirus | Human herpesvirus 6 | |||||
| Human herpesvirus 7 | ||||||
| Gammaherpes-virinae | Lymphocrypto-virus | Human herpesvirus 4 | ||||
| Rhadinoovirus | Human herpesvirus 8 | |||||
| Adenoviridae | Mastadeno-virus | Human adenovirus A-F | nackt | ikosaedrisch | ||
| Polyoma-viridae | Polyomavirus | Simian virus 40 | ||||
| BK polyomavirus | ||||||
| JC polyomavirus | ||||||
| Papilloma-viridae | Alpha-papilloma-virus | Human papilloma-virus | ||||
| Beta-papilloma-virus | ||||||
| Gamma-papilloma-virus | ||||||
| Mupapilloma-virus | ||||||
| Nupapilloma-virus | ||||||
| ssDNA-Viren | ||||||
| Parvoviridae | Parvovirinae | Erythrovirus | Human parvovirus B19 | nackt | ikosaedrisch | |
DNA- und RNA revers transskribierende Viren
| Ordnung | Familie | Subfamilie | Genus | Art | Umhüllung | Kapsid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsDNA RT-Viren | ||||||
| Hepadna-viridae | Ortho-hepadna-virus | Hepatitis B virus | umhüllt | ikosaedrisch | ||
| ssRNA RT-Viren | ||||||
| Retroviridae | Orthoretro-virinae | Lentivirus | Human immunodeficiency virus 1 | umhüllt | ikosaedrisch | |
| Human immunodeficiency virus 2 | ||||||
| Delta-retrovirus | Human T-lymphotropic virus 1 | |||||
| Human T-lymphotropic virus 2 | ||||||
RNA-Viren
| Ordnung | Familie | Subfamilie | Genus | Art | Umhüllung | Kapsid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsRNA-Viren | ||||||
| Reoviridae | Rotavirus | Rotavirus A-E | nackt | ikosaedrisch | ||
| Coltivirus | Colorado tick fever virus | |||||
| ss(-)RNA-Viren | ||||||
| Mononega-virales | Rhabdo-viridae | Vesiculo-virus | Vesicular stomatitis Indiana virus | umhüllt | helikal | |
| Lyssavirus | Rabies virus | |||||
| Australian bat lyssavirus | ||||||
| Duvenhage virus | ||||||
| European bat lyssavirus 1 | ||||||
| European bat lyssavirus 2 | ||||||
| Lagos bat virus | ||||||
| Mokola virus | ||||||
| Filoviridae | Marburg-virus | Lake Victoria marburgvirus | ||||
| Ebolavirus | Zaire ebolavirus | |||||
| Paramyxo-viridae | Paramyxo-virinae | Respirovirus | Sendai virus | |||
| Morbilli-virus | Measles virus | |||||
| Rubulavirus | Mumps virus | |||||
| Henipavirus | Hendra virus | |||||
| Pneumo-virinae | Pneumo-virus | Human respiratory syncytial virus | ||||
| Orthomyxo-viridae | Influenza-virus A | Influenza A virus | ||||
| Influenza-virus C | Influenza C virus | |||||
| Influenza-virus B | Influenza B virus | |||||
| Bunya-viridae | Orthobunyavirus | Bunyamwera virus | ||||
| Hantavirus | Hantaan virus | |||||
| Nairovirus | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus | |||||
| Phlebovirus | Rift Valley fever virus | |||||
| Arenaviridae | Arenavirus | Lymphocytic choriomeningitis virus | ||||
| Lassa virus | ||||||
| Deltavirus | Hepatitis delta virus | nackt | kein eigenes Kapsid | |||
| ss(+)RNA-Viren | ||||||
| Picorna-viridae | Enterovirus | Human enterovirus A (Coxsackie) | nackt | ikosaedrisch | ||
| Human enterovirus B (Echo, Coxsackie) | ||||||
| Human enterovirus C (Coxsackie) | ||||||
| Poliovirus | ||||||
| Rhinovirus | Human rhinovirus A-B | |||||
| Hepatovirus | Hepatitis A virus | |||||
| Cardiovirus | Encephalo-myocarditis virus | |||||
| Aphthovirus | Foot-and-mouth disease virus | |||||
| Parechovirus | Human parechovirus | |||||
| Calici-viridae | Norovirus | Norwalk virus | ||||
| Sapovirus | Sapporo virus | |||||
| Hepevirus | Hepatitis E virus | |||||
| Astroviridae | Mamastro-virus | Human astrovirus | ||||
| Nidovirales | Corona-viridae | Coronavirus | Human coronavirus 229E | umhüllt | helikal | |
| Human coronavirus OC43 | ||||||
| Human enteric coronavirus | ||||||
| SARS coronavirus | ||||||
| Flaviviridae | Flavivirus | Tick-borne encephalitis virus (FSME) | umhüllt | ikosaedrisch | ||
| Dengue virus | ||||||
| Japanese encephalitis virus | ||||||
| St. Louis encephalitis virus | ||||||
| West Nile virus | ||||||
| Yellow fever virus | ||||||
| Hepacivirus | Hepatitis C virus | |||||
| Hepatitis G virus | ||||||
| Togaviridae | Alphavirus | Everglades virus | ||||
| Mayaro virus | ||||||
| Mucambo virus | ||||||
| O’nyong-nyong virus | ||||||
| Ross River virus | ||||||
| Semliki Forest virus | ||||||
| Sindbis virus | ||||||
| Chicun-gunya virus | ||||||
| Rubivirus | Rubella virus | |||||
Literatur und Weblinks
- ICTVdB: The Universal Virus Database of the International Committee on Taxonomy of Viruses
- VIPERdb: Virus Particle Explorer
- UK Clinical Virology Network
- Virensteckbriefe vom Forschungsinstitut für Virologie und Biomedizin Wien
- The Big Picture Book of Viruses
- Viruses: From Structure to Biology
- All the Virology on the WWW
- Homepage der Gesellschaft für Virologie e.V.
Poxviridae
Orthopox-Variola-Virus
| Orthopox-Variola-Virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, komplex | ||||||||||||||
Die Pocken, med. Variola, auch Blattern genannt, sind eine gefährliche Infektionskrankheit, die durch Pocken-Viren übertragen wird. Seit 1977 sind keine Pockenfälle mehr aufgetreten. Der letzte Fall in Deutschland trat im Jahre 1972 in Hannover auf. Durch das konsequente Impf- und Bekämpfungsprogramm der WHO und anderer Gesundheitsorganisationen wurde erreicht, dass 1980 die Welt von der WHO für pockenfrei erklärt werden konnte, weil der Mensch das einzige Reservoir für den Erreger darstellt. Weitere Pockeninfektionen, z.B. durch Laborunfälle oder Bioterrorismus sind nicht ausgeschlossen und die Krankheit unterliegt nach wie vor der gesetzlichen Meldepflicht.
Erreger: Die Erreger der Pocken beim Menschen sind Viren aus der Gattung Orthopoxvirus. Pockenviren sind mit etwa 230x350nm die größten bekannten tierpathogenen Viren. Sie weisen Eigenschaften auf, die denen primitiver Zellen ähneln, so replizieren sie z.B. ihre DNA außerhalb des Wirt-Zellkerns.
| Erkrankung | Medizinischer Name | Erreger | Sterblichkeit |
|---|---|---|---|
| Echte Pocken | Variola vera, Variola major |
Orthopoxvirus variola | 10-90%, je nach Stamm |
| Weiße Pocken | Variola minor, Alastrim |
Orthopoxvirus alastrim | 1-5% |
| Ostafrikanische Pocken | Variola haemorrhagica | ? | 5% |
Tierpocken: Neben den menschlichen Pockenerkrankungen gibt es auch bei einer Reihe von Tieren durch verwandte Viren ausgelöste Erkrankungen. Die ebenfalls durch Orthopox-Viren hervorgerufenen Tierpocken (Kuh-, Kamel-, Affen- und Mäusepocken) sind, mit Ausnahme der Mäusepocken, prinzipiell auch für den Menschen pathogen und damit Zoonosen, lösen aber meist nur leichte Erkrankungen aus. Die übrigen durch Pockenviren hervor gerufenen Tierkrankheiten (u. a. Schweine-, Schaf-, Ziegen-, Euter- und Vogelpocken, Myxomatose, Kaninchenfibromatose, Stomatitis papulosa der Rinder) sind dagegen streng wirtsspezifisch und für den Menschen ungefährlich.
Von besonderer Bedeutung ist der Erreger der Kuhpocken Orthopoxvirus vaccinia, der mit dem Variolavirus eng verwandt ist, beim Menschen aber nur eine leichtere Krankheit auslöst. Dafür ist der Patient nach einer Ansteckung mit Kuhpocken gegen die echten Pocken immunisiert. Deshalb wurden Varianten von Vaccinia für die Pockenimpfung verwendet. Das Erregerreservoir stellen vermutlich Nagetiere dar und ein wichtiger Überträger auf den Menschen sind Katzen. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem (AIDS, hochdosierte Kortisonbehandlung) können durch Katzen übertragene Kuhpockeninfektionen auch tödlich enden.
Krankheitsbild: Pocken können direkt von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion beim Husten übertragen werden. Daneben kann die Ansteckung auch durch Einatmen von Staub erfolgen, der z.B. beim Ausschütteln von Kleidung oder Decken von Pockenkranken entsteht.
Die Inkubationszeit beträgt ein bis zweieinhalb Wochen, meistens jedoch 12–14 Tage. Die Viren befallen zunächst den Nasen- und Rachenbereich und verbreiten sich dann über den Blutweg im ganzen Körper, was zu starkem Fieber und Schüttelfrost führt. Etwa vier Tage nach den ersten Anzeichen tritt der typische Ausschlag auf. Es bilden sich Bläschen an fast allen Stellen des Körpers, wobei Kopf, Hände (inklusive Handflächen) und Füße am stärksten, Brust, Bauch und Oberschenkel nur schwach betroffen sind, während in den Achselhöhlen und Kniekehlen praktisch keine Bläschenbildung auftritt.
Die Flüssigkeit in den Bläschen trübt sich und es entstehen eitrige Pusteln, die einen sehr unangenehmen Geruch verbreiten. Bei einem weniger schweren Krankheitsverlauf trocknen die Pusteln etwa zwei Wochen nach Ausbruch der Krankheit nach und nach ein und hinterlassen deutlich erkennbare Narben. In schwereren Fällen können Erblindung, Taubheit, Lähmungen oder Hirnschäden auftreten. Oft verläuft die Krankheit jedoch tödlich. Die geschätzte Letalität der unbehandelten Pocken liegt bei etwa 30%.
Impfung: Gegen Pocken gibt es kein antivirales Arzneimittel, das - aus nachvollziehbaren Gründen - am Menschen getestet wurde. Eine vorbeugende Impfung ist möglich. Die Impfung kann ihre Schutzwirkung auch noch entfalten, wenn sie bis etwa fünf Tage nach der Infektion vorgenommen wird.
Die Pockenimpfung ist eine Lebendimpfung und durch eine Reihe von Impfkomplikationen (z.B. Enzephalitis) belastet, so dass nur bei eindeutigen Pockenausbrüchen geimpft werden sollte. Nach Erfahrungswerten aus den 50er und 60er Jahren rechnet das CDC mit 15 lebensbedrohlichen Komplikationen und zwei Todesfällen pro einer Million Geimpfter. Nach Meinung von Experten würde eine Massenimpfung der deutschen Bevölkerung mehr Opfer fordern als eine früh erkannte Pockeninfektion, die dann konsequent und unter Quarantäne behandelt werden würde. Eine Massenimpfung ist z.B. in den USA gar nicht vorgesehen – die dortigen Notfallpläne sehen nur eine Impfung der gefährdeten Personen vor.
Die schweren Nebenwirkungen der Impfung können durch eine Vorimmunisierung mit MVA-BN, einem "modified vacciniavirus Ankara" (MVA) der dänischen Firma Bavarian Nordic abgeschwächt werden. Der schon vor 30 Jahren bekannte Impfstamm kann sich in Säugetierzellen nicht vermehren.[2]
Quarantänemaßnahmen (die Isolierung von Kranken und Krankheitsgebieten) haben sich gegen die Pocken bewährt und sind eine notwendige Maßnahme zur Eindämmung der Erkrankung.
Die gesetzliche Pockenschutzimpfung wurde am 26. August 1807 von Bayern als weltweit erstem Land eingeführt. Baden folgte 1815, England 1857 und das Deutsche Reich 1874.
Einfache Formen der Impfung sind schon lange bekannt. Die vorbeugende Ansteckung mit geringen Mengen von Variolaviren, heute Variolation genannt, ist schon seit mindestens 3.000 Jahren aus China bekannt, wo zerriebener Schorf der Pusteln geschnupft wurde. In Indien wurde dieses Material in die Haut eingeritzt. In Europa führte Lady Montagu, die Frau eines britischen Diplomaten in Istanbul, die Variolation durch Einritzen von etwas Flüssigkeit aus den Pockenbläschen in die Haut ein.
Impfung mittels Vaccinia-Viren
Die zweite, sicherere Impfmethode wurde ab ca. 1771 in Einzelfällen entdeckt und erprobt u.a. von Sevel, Jensen, Benjamin Jesty (1774), Rendall und Peter Plett (1791), bevor Edward Jenner sie 1796 in England einführte. Auch er glaubte der Landbevölkerung, die berichtete, dass Menschen, die von Kuhpocken angesteckt worden waren, nicht mehr die echten Pocken bekommen könnten. Zur Überprüfung dieser These infizierte Jenner einen Jungen zunächst mit Kuhpocken und, nach Abklingen der Krankheit, mit den echten Pocken. Der Junge überlebte. Dieses Verfahren wird, nach den verwendeten Vaccinia-Viren, Vakzination genannt. Das Wort vaccination bedeutet heute im Englischen Impfung ganz allgemein, auch bei uns werden Impfstoffe Vakzine genannt. In vielen Ländern wurde die Impfung von Kleinkindern und auch die Nachimpfung nach etwa 12 Jahren gesetzlich vorgeschrieben.
Geschichte: Pocken sind schon seit Jahrtausenden bekannt. Die Mumie von Pharao Ramses II. von Ägypten zeigt deutliche Pockennarben.
Nach Europa kamen die Pocken wahrscheinlich 166 mit dem Einzug der siegreichen Legionen nach der Einnahme der syrischen (heutiges Irak) Stadt Seleukia-Ktesiphon. Sie breitete sich rasch bis zur Donau und zum Rhein hin aus. Die Folge war ein Massensterben über 24 Jahre hin. Der Namen "variola" soll der Krankheit von dem Arzt und Übersetzer Constantinus Africanus gegeben worden sein. Der Name Variola (von lat. varius = bunt, scheckig, fleckig) wurde von Bischof Marius von Avenches (heute Schweiz) um 571 n. Chr. geprägt. Die Kreuzritter des 11. und 13. Jahrhunderts trugen zu ihrer Verbreitung wesentlich bei. Seit dem 15. und 16. Jahrhundert waren die Pocken weltweit verbreitet, über 10% der Kinder starben vor dem 10. Lebensjahr an dieser Infektionskrankheit. Der Name "Pocken" kommt zum ersten Mal in einer angelsächsischen Handschrift aus dem 9. Jahrhundert am Ende eines Gebetes vor: "geskyldath me wih de lathan Poccas und with ealleyfeln. Amen." (Beschützt mich vor den scheußlichen Pocken und allem Übel. Amen.) Das Wort Pocken kommt aus dem Germanischen und bedeutet Beutel, Tasche, Blase (=Blatter) und ist mit den engl. pocket/pox/pocks und dem französischen poche verwandt.
Die europäischen Eroberer brachten die Pocken nach Amerika, wo sie unter den Ureinwohnern (Indianer) verheerende Epidemien auslösten, die Millionen von Toten forderten. In Nordamerika wurden die Pocken auch als Waffe eingesetzt, indem der britische Befehlshaber eines von Indianern besetzten Forts, ein Oberst Henry Bouquet, zwei Häuptlingen als Zeichen seiner Anerkennung pockeninfizierte Decken schenkte. Dies führte unter den völlig ungeschützten Indianern zu einer schweren Pockenepidemie mit vielen Toten. Die Europäer selbst waren durch zahlreiche frühere Pockenepidemien z.T. immunisiert und weniger gefährdet.
In Europa galten Pocken teilweise als Kinderkrankheit. Ab dem 18. Jahrhundert häuften sich die Pockenfälle und lösten die Pest als schlimmste Krankheit ab. Nach Schätzungen starben jedes Jahr 400.000 Menschen an Pocken. Berühmte Persönlichkeiten wie Mozart, Haydn, Beethoven oder Goethe blieben von der Krankheit nicht verschont. Die Heiratspolitik der Habsburger wurde gleichfalls von den Pocken immer wieder durcheinandergebracht. Die Kaiserin Maria Theresia, die mit der Verheiratung ihrer Töchter an andere Herrschaftshäuser Allianzpolitik betrieb, musste mehrfach ihre Pläne ändern, weil zwei ihrer Töchter an den Pocken starben und eine dritte durch diese völlig verunstaltet wurde.
Noch in den 50er und 60er Jahren gab es in Europa Pockenepidemien, so z.B. 1950 in Glasgow, 1957 in Hamburg oder 1967 in der Tschechoslowakei. Ab 1967 wurde mit groß angelegten Impfaktionen ein weltweiter Feldzug zur Ausrottung der Pocken gestartet. Der letzte Pockenfall in Deutschland trat 1972 als eine aus Jugoslawien eingeschleppte Erkrankung auf, der weltweit letzte Fall wurde in Somalia 1977 dokumentiert. Am 8. Mai 1980 wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgestellt, dass die Pocken ausgerottet sind.
Seitdem gibt es, zumindest offiziell, nur noch zwei Orte, an denen Pockenviren lagern, nämlich das Forschungszentrum der US-amerikanischen Seuchenbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in Atlanta und ihr russisches Gegenstück in der Nähe von Nowosibirsk.
Die meisten Staaten hoben ab den 70er Jahren die Pockenimpfpflicht wieder auf (in Deutschland 1975 die Erstimpfung für Kleinkinder und ein Jahr später die Wiederimpfung für Zwölfjährige), da auch die Impfung nicht völlig risikofrei ist. Nach Erfahrungswerten aus den 50er und 60er Jahren rechnet das CDC mit 15 lebensbedrohlichen Komplikationen und zwei Todesfällen pro einer Million Geimpfter.
Literatur und Weblinks:
Parapoxvirus - Orf virus

| Orf-Virus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||
| umhüllt, komplex | ||||||||||||
Zoonose (Schafe, Ziegen). Übertragung durch direkten Kontakt (Landwirte).
Krankheitsbild: Melkerknoten
Verlauf: selbstlimitierend
Diagnose: Anamnese!
Weblinks: DermIS - Melkerknoten
Molluscum contagiosum Virus
| Molluscum contagiosum Virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, komplex | ||||||||||||||
Das Molluscipoxvirus (aus der Familie der Poxviren (Pockenviren) bzw. Paravaccinia-Viren) ist ein behülltes, doppelsträngiges DNA-Virus (dsDNA) und der Erreger des Molluscum contagiosum (Synonyme: Dellwarze, Epithelioma molluscum, Epithelioma contagiosum, Molluske, Schwimmbadwarze), einer häufigen, gutartigen und weltweit verbreiteten Infektionskrankheit der Haut.
Krankheitsbild: Dellwarzen sind stecknagelkopf- bis erbsengroße, weiße, rötliche oder hautfarbene Knötchen mit glatter und oft glänzender Oberfläche, die stets multipel auftreten. Sie haben meist in der Mitte eine Delle, die eine kleine Öffnung aufweisen kann, und treten in unterschiedlicher Anzahl (wenige bis mehrere Hundert Mollusken) am ganzen Körper auf, besonders an Armen, Händen, Fingern, Genitalien und Oberkörper. Beim Erwachsenen ist die Verbreitung im Genitalbereich vorherrschend. Druck auf Dellwarzen führt zur Entleerung einer rahmartigen bis teigigen Masse, die auch Molluscumbrei oder Molluscumkörperchen genannt wird. Dellwarzen kommen besonders häufig bei Kindern vor, insbesondere bei Kindern mit atopischem Ekzem (Neurodermitis). Gelegentlich kann es zu einer lokalen Entzündung bzw. Ekzembildung in der Umgebung der Dellwarzen kommen.
Entgegen der gebräuchlichsten deutschen Bezeichnungen werden Mollusken nicht zu den Warzen (Verruccae) gezählt.
Übertragung: Die Übertragung erfolgt beim Menschen durch Schmierinfektion oder Kontaktinfektion, häufig in Schwimmbädern und Kindergärten durch die gemeinsame Benutzung von Handtüchern. Ein erster Erkrankungsgipfel wird in der Kindheit, ein zweiter im frühen Erwachsenenalter – hier auch als sexuell übertragbare Krankheit (STD) – beobachtet. Die Inkubationszeit ist sehr variabel und liegt zwischen 17 Tagen und 20 Monaten.
Diagnose: I.d.R. Blickdiagnose.
Therapie: Dellwarzen können chirurgisch durch Abtragung mit dem scharfen Löffel oder einer speziellen Pinzette bei örtlicher Betäubung entfernt werden. Die Kryotherapie (Vereisung) ist eine mögliche Alternative.

Bei einem großen Teil der Patienten bilden sich die Veränderungen nach sechs bis neun Monaten ohne Behandlung spontan zurück. Sie können aber auch mehrere Jahre bestehen bleiben. Das Wachstum der Mollusca contagiosa ist sehr langsam.
Literatur und Weblinks:
Quellen
- ↑ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/Ictv/fr-fst-g.htm
- ↑ . “Komplikationen einer Pockenimpfung können durch einen zweiten Impfstoff aufgefangen werden”. Ärzte Zeitung, 17.01 2003.
Herpesviridae
Allgemeines
Herpesviridae (von herpes (griech.): kriechen) sind behüllte, doppelsträngige DNA-Viren, die mit einem ikosaedrischen Kapsid (mit einer aus Dreiecksflächen bestehenden Proteinhülle) ausgestattet sind, die jeweils noch von einer Hüllmembran umgeben ist. Mit Herpes-Viren werden oft nur HSV-1 und HSV-2 gemeint, generell umfasst die Gruppe der Herpesviren 8 verschiedene humanpathogene Herpesviren (HHV), die in drei Gruppen einteilt werden:
Alpha-Herpesviren replizieren schnell, haben ein breites Wirtsspektrum und überleben in den Ganglien des Wirtes dauerhaft
- HHV-1: Herpes simplex Typ 1 (HSV-1) - Krankheitsbilder: Herpes labialis, Herpes genitalis, Stomatitis aphtosa
- HHV-2: Herpes simplex Typ 2 (HSV-2) - Krankheitsbilder: Herpes genitalis
- HHV-3: Varizella-Zoster-Virus (VZV) - Krankheitsbilder: Windpocken, Gürtelrose (Herpes Zoster)
Beta-Herpesviren replizieren langsam und haben ein enges Wirtsspektrum
- HHV-5: Cytomegalovirus (CMV) - Krankheitsbilder: CMV-Pneumonie, CMV-Sialoadenitis, CMV-Retinitis u.a.
- HHV-6: Humanes Herpes-Virus 6 - Krankheitsbilder: Drei-Tage-Fieber
- HHV-7: Humanes Herpes-Virus 7 - Krankheitsbilder: Drei-Tage-Fieber, Pityriasis rosea
Gamma-Herpesviren haben sehr unterschiedliche Replikationszeiten und zeigen ein sehr enges Wirtsspektrum
- HHV-4: Epstein-Barr-Virus (EBV) - Krankheitsbilder: Pfeiffersches Drüsenfieber, Nasopharynxkarzinom, (Morbus Hodgkin: Verdacht auf Kofaktor, jedoch nicht nachgewiesen), Non-Hodgkin-Lymphome (u.a. Burkitt-Lymphom), Post-Transplantations-Lymphoproliferation (PTLD)
- HHV-8: Humanes Herpes-Virus 8 - Krankheitsbilder: Kaposi-Sarkom, bestimmte Lymphome
Alpha-Herpesvirinae
Alpha-Herpesviren infizieren in der Regel zuerst Epithelzellen, wo sie sich vermehren und die Zellen zum Absterben bringen. Nach kurzer Zeit dringt das Virus in die Nervenzellen ein, die das entsprechende Hautareal innervieren. Im Zellkern dieser Neurone wird die virale DNA neben der Wirtszell-DNA als episomale DNA abgelegt (die im Kern angelangte virale DNA schließt sich zu einem Ring). In dieser Form verhält sich das Virus dann still und ist für das Immunsystem nicht zu entdecken. Durch bestimmte Einflüsse (Immunsuppression, Stress, Krankheit, Hormonschwankungen, UV-Strahlung) wird das Virus wieder aktiv, wandert entlang des Axons und befällt dann erneut Epithelzellen, so dass wieder eine akute Herpeserkrankung auftritt.
Simplex-Viren (HSV-1/HHV-1, HSV-2/HHV-2)
| Simplex-Viren | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||||||
Krankheitsbilder: Die Simplex-Viren verursachen Lippenherpes, den Herpes ophthalimicus (1. Trigeminusast) und die Stomatitis aphtosa (bevorzugt HSV-1), sowie den Genitalherpes (bevorzugt HSV-2). Die Viren halten sich in den Nervenzellen der betroffenen Segmente auf (Trigeminuskerne, Sakralmark) und führen unter bestimmten inneren und äußeren Bedingungen wie Stress, Sonneneinsstrahlung, Infekte etc. zu den typischen Symptomen.

Persistenz: Das Immunsystem kann nur die akute Erkrankung bekämpfen, nicht aber die Viren welche in den Spinal- oder Hirnnervenganglien des Nervensystems verbleiben. Auf diese Weise verbleibt ein Reservoir von Herpesviren lebenslang im infizierten Organismus (lebenslange Persistenz). Bei einer persistierenden Infektion wandern die HSV aus den Ganglien herab und es kommt zu einer kontinuierlichen, geringen Vermehrung und Freisetzung infektiöser Viren. Bei einer latenten Infektion dagegen ist das Virusgenom stumm, d.h. es kommt zu keiner Expression von viruskodierten Proteinen. Erst bei einer Sekundärinfektion wird das Virus somit wieder aktiv.

Verlauf: Beim Krankheitsverlauf wird zwischen der Erstinfektion (Primärinfektion) und den Folgeinfektionen unterschieden:
- Primärinfektion: Es entstehen Bläschen im Gesicht, im Genitalbereich und um den After; Lymphknotenschwellung, Schmerzen; Abtrocknung nach 10 Tagen.
- Sekundärinfektion: Bei geschwächtem Immunsystem, z. B. bei Fieber, Schlafmangel, Menstruation, Stress, UV-Strahlung.
Schwere Verlaufsformen: Bei Immundefizienz kann es zur Herpes-Ösophagitis kommen.
Die Herpes-Enzephalitis betrifft vorwiegend den Temporallappen. Sie führt nach einem mehrtägigen uncharakteristischen Prodromalstadium zu Herdsymptomen wie Paresen, Aphasien und Krampfanfälle. Dazu kommen Wesensveränderung, Vigilanzstörungen, sowie Fieber und Nackensteifigkeit. Die jährliche Inzidenz wird mit 1 Neuerkrankung auf 100.000 Einwohner beziffert. Unbehandelt sterben 70 % der Erkrankten.
Herpes-simplex kann auch generalisiert verlaufen und z.B. bei Erwachsenen eine Herpeshepatitis als Begleithepatitis bei Befall der Leber durch Herpes simplex (als viszeraler Herpes) auftreten.
Sehr gefährlich ist der Herpes neonatorum. Hierbei kann die Übertragung sowohl von der mit Herpes simplex erkrankten Mutter ausgehen (Lippenherpes, Genitalherpes mit oder ohne Bläschen), als auch von anderen an der Geburt beteiligten erkrankten Personen. Man unterscheidet hier 3 Verlaufsformen mit unterschiedlicher Prognose:
- Septische Allgemeinerkrankung (ohne Bläschen) mit einer Letalität von 80%.
- Enzephalitis (ohne Bläschen) mit einer Letalität von 10%, es verbleiben aber meist Restschäden.
- Exanthemische oft generalisierte Form mit Bläschen und sehr guter Prognose.
Therapie: Aciclovir. Bei Genitalherpes der Schwangeren Entbindung als Sectio caesarea.
Literatur und Weblinks:
- RKI - Herpes-Infektionen
- DermIS - Herpes simplex, DermIS -Herpes simplex labialis , DermIS - Herpes simplex oralis, DermIS - Herpes simplex genitalis, DermIS - Herpes simplex analis
Varizella-Zoster-Virus (VZV/HHV-3)
| Varizella-Zoster-Virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
Das Varizella-Zoster-Virus (VZV) - auch als Humanes-Herpes-Virus-3 bezeichnet - ist der Verursacher der Windpocken.
Das DNA-Virus ist membranumhüllt, enthält doppelsträngige DNA (dsDNA) und ist als Ikosaeder mit 162 Kapsomeren 150-200 nm groß. Das Virus gehört zur Gattung Varicellovirus, zur Unterfamilie der alpha-Herpesvirinae und zur Familie der Herpesviridae. Mit den Herpes simplex-Viren ist es nahe verwandt und teilt mit diesen einen großen Teil seines Genoms.
Windpocken: Die Windpocken (Varizellen) - auch als Wasserpocken, Feuchtblattern, Spitze Blattern oder Wilde Blattern bezeichnet (ICD-10- Kode: B01) - ist eine durch das Varicella-Zoster-Virus ausgelöste und per Tröpfcheninfektion übertragene Erkrankung. Der Name Windpocken kommt von der hohen Ansteckungsfähigkeit dieser Viren, die auch über einige Meter in der Luft übertragen werden. Die Erkrankung, von der überwiegend Kinder im Vorschulalter betroffen sind, führt bei 90% der Infizierten zu einer lebenslangen Immunität. Eine Impfung ist möglich, eine Mehrfachimpfung gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken ist in Vorbereitung.
Übertragung: Die hoch ansteckenden Viren werden per Tröpfcheninfektion oder über Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion übertragen, wenn Gegenstände mit den feinen Tröpfchen der Ausatemluft in Berührung kommen. Da die Erreger an der Luft nur für etwa zehn Minuten überlebensfähig sind, ist eine Übertragung durch herumliegende Kleidung oder Spielzeug in der Regel nicht zu befürchten.
Windpocken sind schon zwei Tage vor Auftreten des Hautausschlags ansteckend und bleiben dies sieben bis zehn Tage nach Bildung der ersten Bläschen bzw. bis das letzte Bläschen verkrustet ist. In dieser Zeit sollte die erkrankte Person nicht in Kontakt mit anderen kommen, vor allem nicht mit älteren Menschen oder Frauen, die sich in der 8. bis 21. Schwangerschaftswoche befinden. Die Meinung, dass die Ansteckungsfähigkeit bis zum Abfallen der letzten Kruste vorhanden sei, gilt als überholt.
Klinik und Verlauf: Nach einer Inkubationszeit von 10 bis 21 (meist 14 bis 17) Tagen kann es zum Auftreten von leichtem und kurzanhaltendem Fieber sowie Kopf- und Gliederschmerzen kommen. Tags darauf können im Bereich des Rumpfes und Gesichtes, typischerweise aber auch des behaarten Kopfes, erst später an den Gliedmaßen bis zu linsengroße, manchmal juckende rote Flecken bzw. später Knötchen folgen, in deren Zentrum sich innerhalb von Stunden bis maximal Tagen reiskorngroße Bläschen bilden können. Diese können gedellt sein und entwickeln sich durch Leukozyteneinwanderung in weiterer Folge rasch zu Pusteln (mit Eiter gefüllten Bläschen in der Oberhaut). Seltener können auch die Schleimhäute im Bereich des Mundes (hier vor allem am Gaumen als gelblich belegte Erosionen sichtbar), der Nase, der Augen, sowie die Haut der Genitalien und des Afters betroffen sein. Die Bläschen platzen schließlich, und es bildet sich eine hellbraune Kruste. Da die Läsionen nicht gleichzeitig entstehen, findet sich zu einem gegebene Zeitpunkt eine vielgestaltigen Ausprägung der Hauterscheinungen, so dass oft von einem Bild ähnlich einem „Sternenhimmel“ gesprochen wird, was oft eine Blickdiagnose ermöglicht.

Der Krankheitsverlauf ist meist gutartig. Die Krusten fallen ohne Narbenbildung ab, sofern darauf geachtet wird, dass das Kind nicht kratzt und damit eine bakterielle Superinfektion mit Streptokokken oder Staphylokokken herbeiführt.
Komplikationen: Die häufigsten Komplikationen betreffen Lungenentzündung (bei Erwachsenen 0,2-0,3%), eine zerebelläre Ataxie oder eine bakterielle Sepsis ausgehend von der Haut (bei Kindern 2-3/10.000). Weitere schwere Komplikationen sind das Reye-Syndrom, Enzephalitis oder Meningitis sowie Leber- oder Gelenksbeschwerden. In Folge solcher Komplikationen wird die Todesrate bedingt durch Varizelleninfektion auf 25-40 Fälle pro Jahr in Deutschland geschätzt.[1][2]
Windpocken in der Schwangerschaft können eine ernste Gefährdung des Embryos bedeuten (besonders im ersten und zweiten Trimenon, 13. bis 20. Woche). Rund um den Geburtstermin (ca. fünf Tage vor und zwei Tage nach der Geburt) kann es beim Neugeborenen zur neonatalen Varizellen-Infektion mit ernsten Komplikationen kommen. Daher sollten sich Frauen mit Kinderwunsch, die sich nicht sicher sind, ob sie die Windpocken schon hatten, beim Frauenarzt auf Antikörper untersuchen und gegebenenfalls impfen lassen. In diesem Fall sollte allerdings etwa drei Monate mit einer Schwangerschaft gewartet werden, um eine Schädigung des Kindes auszuschließen.
Die Erkrankung an Windpocken sowie der labordiagnostische Nachweis sind in Deutschland mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 29. März 2013 meldepflichtig geworden. Bei einer Studie wurde hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland eine Komplikationsrate von 5,6% ermittelt (inkl. leichtere Komplikationen wie Otitis media). Die Hospitalisierungsrate wegen Varizellen liegt bei 2,5-7 pro 100.000 Einwohner in Deutschland.[1]
Verlauf/Komplikationen bei Erstinfektion im Erwachsenenalter: Erstinfektion mit dem Varizellenvirus im Erwachsenenalter (Varicellae adultorum) sind sehr selten und nehmen in der Regel einen schwereren Krankheitsverlauf und sind auch teilweise mit Komplikationen wie Enzephalitis, Meningitis, Pneumonie, Hepatitis und Arthritis verbunden.

Gürtelrose als Zweiterkrankung bei Erwachsenen: Menschen, die in ihrer Kindheit an Windpocken erkrankt waren, können später an Herpes Zoster, der Gürtelrose erkranken. Die Ursache bilden nach der Erkrankung im Körper verbliebene Varicella-Zoster-Viren, die entlang sensibler Nervenfasern in die Spinalganglien eingewandert sind und dort latent verbleiben. Bei Immunschwäche können diese Viren reaktiviert werden und eine Gürtelrose im Versorgungsgebiet der betroffenen Nerven (Dermatome) verursachen.
Komplikationen besonders bei Immundefizienz sind die Zoster-Meningitis, die Zoster-Enzephalitis und die Zoster-Myelitis (Rückenmark-Entzündung). Auch die selteneren Zoster-Formen wie Zoster generalisatus, Zoster ophthalmicus und Zoster oticus werden gelegentlich zu den Komplikationen gezählt.
In seltenen Fällen bleiben Schmerzen auch nach der Ausheilung bestehen. Man spricht dann von postherpetischer oder post-Zoster–Neuralgie.
Erwachsene mit Gürtelrose können Windpocken auf Ungeschützte übertragen, während umgekehrt ein Windpockenkrankes Kind zwar die Windpocken verbreiten kann, aber keine Infektionsquelle für eine Gürtelrose darstellt.
Therapie der Windpocken: Die Behandlung beschränkt sich meist auf die Linderung eines bestehenden Juckreizes, z.B. mit Polidocanol (Anaesthesulf® Lotio). Die Fingernägel des Kindes sollten geschnitten werden, um die Gefahr der Entwicklung einer bakteriellen Superinfektion zu minimieren. Fieber sollte, wenn überhaupt, mit Paracetamol behandelt werden (ASS bei Kindern mit viralem Infekt kann ein Reye-Syndrom hervorrufen). Aciclovir oder Vidarabin soll die Symptome bei Kindern, die älter als zwei Jahre sind, minimieren helfen, sofern es innerhalb von 24 Stunden eingenommen wird. Bei einer bestehenden Immunschwäche sollte eines dieser Medikamente ebenfalls verabreicht werden.
Therapie des Herpes zoster: Das Varizella-Zoster-Virus kann mit Virostatika behandelt werden. Üblicherweise erfolgt die Behandlung mit Brivudin, Aciclovir, Famciclovir oder Valaciclovir, meistens in Tablettenform. In Ausnahmefällen ist auch eine intravenöse Behandlung möglich.
Neuerdings gilt die Behandlung mit Brivudin (Zostex®, in Österreich MevirZostex®) als wirksam und vielversprechend. Ergebnisse der klinischen Studie dazu sind unten beigefügt.
Wie bei den Windpocken auch kann bei Juckreiz und zum schnelleren Eintrocknen der Bläschen Anaesthesulf® Lotio aufgetragen werden. Meistens ist die zusätzliche Gabe von starken Schmerzmitteln angezeigt. Bei etwa 8% der betroffenen Patienten können die akuten Schmerzen nicht durch Schmerzmittel beeinflusst werden.
Fälle von postherpetischer Neuralgie (etwa 30% der Betroffenen haben noch vier bis fünf Wochen nach der Verkrustung diffuse oder lokal begrenzte, teils starke Schmerzen) sind oftmals schwer zu behandeln. In Betracht kommen hier neben Schmerzmitteln auch Antidepressiva und Neuroleptika, gelegentlich sogar chirurgische Eingriffe. Die Behandlung mit Elektrotherapie (Galvanisation, Reizstrom oder TENS) kann Schmerzen lindern. Dabei sind jedoch Hautläsionen (Bläschen und Pusteln) zu berücksichtigen.
Ein Impstoff (Zostavax™), der vorbeugend das Erkrankungsrisiko auf etwa die Hälfte senkt und bei den übigen Fällen die Schmerzen deutlich lindert, wurde am 25. Mai 2006 in den USA durch die zuständige Behörde FDA zugelassen.
Prophylaxe: Zur Vorbeugung ist eine Impfung möglich, welche in Deutschland seit 2004 von der Stiko (Ständige Impfkommission) empfohlen wird.[1] Der Impfstoff besteht aus attenuierten (abgeschwächten), lebenden Varizella-Zoster-Viren, die sich im Geimpften vermehren und wird subkutan(!) verabreicht.
Die Impfung kann ab einem Alter von neun bzw. zwölf Monaten (je nach Impfstoffhersteller) gegeben werden. Kinder vor dem 13. Geburtstag erhalten eine Injektion. Bei Kindern ab dem 13. Geburtstag und Erwachsenen ist eine zweite Injektion im Mindestabstand von sechs Wochen notwendig.
Wer soll geimpft werden?
- Kinder im Alter von elf bis 14 Monaten, parallel zur ersten MMR-Impfung oder frühestens vier Wochen nach dieser.
- Die Impfung wird für bestimmte Personen empfohlen, die die Windpocken noch nicht durchgemacht haben und bisher auch nicht dagegen geimpft wurden:
- Neun- bis 17-jährige Jugendliche
- Frauen mit Kinderwunsch
- Patienten mit schwerer Neurodermitis
- Patienten mit Leukämie, Patienten vor geplanter immunsuppressiver Therapie oder Organtransplantation.
- Personen mit Kontakt zu den oben genannte Patienten mit Neurodermitis etc.
- Medizinisches Personal, besonders in der Kinderheilkunde, Onkologie, Frauenheilkunde/Geburtshilfe, Intensivmedizin
- Neuangestellte in Gemeinschaftseinrichtungen für das Vorschulalter
Wer soll nicht geimpft werden?
Wer an einer akuten, behandlungsbedürftigen Krankheit mit Fieber (über 38,5°C) leidet, soll nicht geimpft werden. Im Allgemeinen werden auch Personen mit Immunschwäche nicht gegen Windpocken geimpft, allerdings sind Ausnahmen unter Umständen möglich und notwendig. Während einer Schwangerschaft wird in der Regel keine Impfung vorgenommen, da das Impfvirus auf das Kind übertragen werden könnte. Aus dem gleichen Grund ist für die Dauer von mindestens drei Monaten nach der Impfung eine Schwangerschaft zu vermeiden. Bislang wurden allerdings nach Impfung von unwissentlich Schwangeren noch keine Schäden des ungeborenen Kindes nachgewiesen.
Literatur und Weblinks:
Beta-Herpesvirinae
Cytomegalievirus (CMV/HHV-5)
| Cytomegalievirus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||
Das humane Zytomegalievirus (CMV) gehört zur Familie der Herpesviren und ist weltweit verbreitet. Die Übertragung erfolgt über den Speichel, Sperma sowie Bluttransfusionen.
Ep.: Je nach geografischer Lage sind 60 bis 100% der Menschen mit dem persistierenden Virus infiziert.
Krankheitsbild:
- Immunkompetente: Die Erstinfektion mit CMV verläuft in 99% ohne oder nur mit geringen Krankheitssymptomen. Durch noch unklare Faktoren kann dieses Virus bei ansonsten gesunden Menschen zu einer schweren Erkrankung führen. Das Leitsymptom ist dabei hohes, manchmal wochenlang anhaltendes Fieber mit typischerweise erhöhten Leberwerten. Komplikationen wie Myokarditis, Thrombozytopenie oder Pneumonie sind beim Immunkompetenten selten, so dass keine antivirale Therapie gegeben werden muss.
- Unter Immunsuppresion: Einen viel schwereren Verlauf beobachtet man regelmäßig bei immunsupprimierten Patienten, z.B. bei HIV mit niedriger CD4+ Zellzahl: CMV-Retinitis mit akuter Erblindungsgefahr; nach Organtransplantationen: CMV-Pneumonie. Eine rasche Therapieeinleitung mit antiviralen Substanzen wie Gancyclovir oder Foscarnet ist notwendig.
- In der Schwangerschaft: Besonders gefährlich stellt sich das Virus in der Schwangerschaft dar. Kongenitale Erkrankungen sind: Hepatosplenomegalie, Petechien, Mikrozephalus, intrazerebrale Verkalkungen und Chorioretinitis (Entzündung der Aderhaut -Choroidea- und der Retina -Netzhaut-). Die Letalität beträgt 12-30%. Die Überlebenden weisen zu mehr als 90% Spätfolgen auf. Seronegative Schwangere sollten deshalb die Exposition mit dem Virus meiden (v.a. Kinderpflegerinnen).
- Säuglinge: Schwerwiegende Krankheiten können bei Säuglingen auftreten (teilweise erst Jahre später als sogenanntes Zytomegalie-Virus-Syndrom, u. a. mit frühkindlichem Hirnschaden, Retardierung und Innenohrschwerhörigkeit). Die Infektion erfolgt über die Muttermilch seropositiver Mütter. Bei Frühgeburten und positivem CMV-Antikörper-Titer sollte in jedem Fall auf das Stillen verzichtet werden.
Diagnostik: Bei Immunsupprimierten sind Antikörpernachweise nicht zielführend, der CMV-Nachweis erfolgt daher über den Nachweis der Virus-DNA mittels PCR im Blut oder über den Nachweis des CMV-Antigens pp 65 in Leukozyten mit einem IFT.
Roseoloviren: Humanes-Herpesvirus 6 und 7 (HHV-6 und HHV-7)
| Roseoloviren | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||||||
HHV-6 und 7 sind die Erreger des Drei-Tage-Fiebers, einer Kinderkrankheit. Es handelt sich um doppelsträngige DNA-Viren, die mit dem Cytomegalie-Virus (CMV) eng verwandt sind. Von HHV-6 existieren zwei Serotypen (6A und 6B). In Europa erkranken Kinder praktisch nur an Typ 6B. Nach Abklingen der akuten Infektion persistiert das Virus im Wirtsorganismus und kann z.B. bei Immunsuppression reaktiviert werden.
Symptome: Das Drei-Tage-Fieber (Exanthema subitum, Roseola infantum, Sechste Krankheit) ist eine Erkrankung des Säuglings- oder frühen Kleinkindesalters (Kinderkrankheit), Kinder jenseits des zweiten Lebensjahres erkranken quasi nicht. Bei typischen Verlauf besteht drei Tage (2-8 Tage) anhaltendes hohes Fieber. Bei Entfieberung tritt ein Hautausschlag mit feinen, manchmal auch leicht erhabenen Flecken auf, der typischerweise am Stamm und im Nacken lokalisiert ist. Die Flecken können zusammenfließen und sich auf Gesicht und Extremitäten ausbreiten.
Epidemiologie: Humane Herpes-Viren kommen auf der ganzen Welt vor. Erregerreservoir ist nur der Mensch. Die Übertragung erfolgt überwiegend durch Speichel, möglicherweise auch durch Tröpfcheninfektion. Gesunde HHV-seropositive Kinder und Erwachsene können immer wieder HHV im Speichel ausscheiden. Dadurch stellen diese Personen eine kontinuierliche Erregerquelle dar. Die Inkubationszeit beträgt 5-15 Tage.
Komplikationen: Zu den häufigsten Komplikationen durch die HHV-6 und -7 gehören Diarrhoe und Erbrechen, Schwellung der Augenlider, Papeln auf dem weichen Gaumen und am Zäpfchen, Husten, Schwellung der Halslymphknoten, vorgewölbte und gespannte Fontanelle sowie Fieberkrämpfe. Letztere scheinen bei HHV-7 etwas häufiger aufzutreten als bei HHV-6.
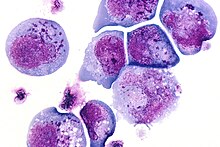
Diagnose: Bei typischer Klinik mit Auftreten des Exanthems nach Entfieberung wird die Diagnose klinisch gestellt. Prinzipiell kann eine vermutete Primärinfektion durch den Nachweis von HHV-spezifischen IgM-Antikörpern betätigt werden. Humane Herpesviren selbst können Blut, Speichel und Liquor, HHV-7 auch in der Muttermilch nachgewiesen werden. Diese Untersuchungen haben aber kaum praktische, sondern eher wissenschaftliche Bedeutung.
Therapie: Die meisten Infektionen erfordern keine Therapie. Evtl. werden fiebersenkende Maßnahmen notwendig. Fieberkrämpfe können mit Diazepam unterbrochen werden. Eine virusspezifische Therapie gibt es nicht.
Prophylaxe: Eine Isolierung von Kindern mit akuter HHV-Infektion ist nicht erforderlich. Eine Impfung existiert nicht. Über die prophylaktische Wirkung von Immunglobulinen liegen bisher keine Erkenntnisse vor.
Literatur und Weblinks:
Gamma-Herpesvirinae
Lymphocryptoviren: Epstein-Barr-Virus (EBV/HHV-4)
| Epstein-Barr-Virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
Das Epstein-Barr-Virus (EBV) ist ein humanpathogenes, behülltes, doppelsträngiges DNA-Virus aus der Familie der Herpesviridae bzw. der Herpetoviridae. Erstmals beschrieben wurde es 1964 von Sir Michael Anthony Epstein (*1921) und Yvonne M. Barr (*1932). Sie entdeckten EBV in B-Lymphozyten, die von einem afrikanischen Patienten mit Burkitt-Lymphom stammten.
Übertragung: Hauptübertragungsweg des Virus ist die Tröpfcheninfektion oder die Kontaktinfektion ("Kissing Disease") bzw. Schmierinfektion, seltener sind Übertragungen im Rahmen von Transplantationen oder Bluttransfusionen. Die Tatsache, dass EBV auch in Sekreten der Genitalen festgestellt werden konnte, macht auch den Übertragungsweg durch sexuelle Kontakte möglich.
Pathogenese: Der Erreger infiziert die Schleimhäute des Mund-Nasen-Rachen-Raums sowie B-Lymphozyten. Nach einer Infektion verbleibt der Erreger - wie alle Herpes-Viren - lebenslang im menschlichen Körper.
Krankheitsbilder: Während bei Infektionen im Kindesalter meist keine Symptome auftreten kommt es bei jugendlichen oder erwachsenen Infizierten in 30–60% der Fälle zum Ausbruch einer infektiösen Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber). Jeder Infektion folgt im Normalfall eine lebenslange Resistenz gegen diese Krankheit. Im höheren Lebensalter sind etwa 95% der Menschen mit EBV infiziert.
Das Epstein-Barr-Virus verbleibt nach der Infektion im Körper und kann wie alle Herpesviren unter Immunsuppression reaktiviert werden und verschiedenartige mehr oder weniger schwerwiegende Krankheitserscheinungen erzeugen.
Als EBV-assoziierte Komplikationen können das Burkitt-Lymphom, nasopharyngeale Karzinome (im asiatischen Raum) und selten B-Lymphome entstehen. Dabei spielen weitere Faktoren eine Rolle, wie z.B. die chromosomale Translokation des c-myc Genes; Malaria wird als weiterer Cofaktor diskutiert. Auch menschliche Brustkrebszellen sind häufig durch Epstein-Barr Viren infiziert, ohne dass ein ursächlicher Zusammenhang gesehen wird.
Die infektiöse Mononukleose: Das Pfeiffersche Drüsenfieber, auch Pfeiffer-Drüsenfieber, infektiöse Mononukleose, Mononucleosis infectiosa oder auch Kusskrankheit (engl.: Kissing Disease) genannt, ist eine häufige Viruserkrankung mit typischer Schwellung der zervikalen Lymphknoten. Die Inkubationszeit wird meist mit 8 bis 21 Tagen angegeben, z.T. auch mit 8 bis 50 Tagen. Nach der Primärinfektion beginnt die Krankheit häufig mit grippeähnlichen Beschwerden wie Fieber (38–39°C), Gliederschmerzen, Leibschmerzen und starker Müdigkeit. Zusätzlich schwellen die Lymphknoten der Erkrankten an Hals, Nacken und selten auch unter den Achseln an (Lymphadenopathie). Bei vielen Betroffenen bildet sich außerdem eine Angina tonsillaris aus, bei der ein eher schmutziggrauer statt weißer Belag auf den Mandeln entsteht, der nicht auf die Umgebung der Tonsillen übergreift. Ziemlich auffällig ist daher bei vielen Patienten ein fauliger Mundgeruch (Foetor ex ore). Die Krankheit dauert in der Regel 2 Tage bis 2 Wochen.
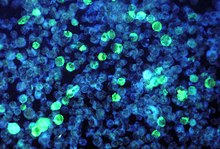

Am häufigsten sind ältere Kinder und junge Erwachsene von der Krankheit betroffen. Bei Kindern unter zehn Jahren verläuft die Erkrankung in der Regel ohne Symptome. Bei Erwachsenen treten meist grippeähnliche Krankheitsanzeichen und nur selten Komplikationen auf. Schätzungsweise 95% der Menschen infizieren sich bis zum 30. Lebensjahr, wodurch sich Antikörper gegen das Virus bilden. Der Name geht auf den Kinderarzt Emil Pfeiffer (1846–1921) zurück.
Diagnose: Das Pfeiffersche Drüsenfieber wird häufig nicht diagnostiziert. Bei extremer Müdigkeit und Schwächegefühl ist deshalb immer auch an eine (evtl. chronische) Epstein-Barr-Infektion zu denken. Eine eindeutige Diagnose erfolgt durch den Nachweis von Epstein-Barr-Virus-Antikörpern und einer auffälligen Leukozytose zwischen 10.000 und 25.000 pro mm³ mit 60 bis 80% lymphoiden (mononukleären) Zellen, also atypischen Lymphozyten. Auch die Leberwerte können gelegentlich erhöht sein. Serologisch sind richtungsweisend IgM gegen Early Antigen (EA) und/oder Viral Capsid Antigen (VCA) bei negativen EBNA-1 (Epstein-Barr Nuclear Antigen-1) IgG. Hohe Konzentrationen von EBNA-1 IgG schließen dagegen eine frische Infektion praktisch aus, da diese Antikörper erst im Laufe von mehreren Wochen bis Monaten nach Auftreten der Symptome vom Immunsystem produziert werden.
Differentialdiagnose: Differentialdiagnostisch ist eine Infektion mit dem Cytomegalievirus (CMV) oder mit dem HI-Virus abzuklären.
Krankheitsverlauf: Die Epstein-Barr-Infektion ist zwar häufig sehr kräftezehrend, verläuft aber in der Regel ohne Komplikationen. Latente, wiederkehrende oder chronische Verläufe sind selten. Allerdings gilt die Infektion auch in diesen Fällen als ungefährlich.
Komplikationen: In etwa 10% der Fälle kommt es im Krankheitsverlauf zu einer Superinfektion der Tonsillen mit Streptokokken. Noch seltenere Komplikationen sind Enzephalitis, autoimmunhämolytische Anämie, Thrombozytopenie, Agranulozytose, Hepatomegalie oder Splenomegalie (Gefahr der Milzruptur!), Lungenentzündung, Myokarditis, Nephritis und Ikterus. Beim Auftreten dieser Symptome kann ein Krankenhausaufenthalt notwendig werden.
Bei Kindern mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten kann diese Erkrankung einen besonders schweren oder sogar letalen Verlauf nehmen.
Man vermutet, dass das Epstein-Barr-Virus bei der Entstehung des Chronischen Erschöpfungssyndroms (chronic fastigue syndrome, CFS), seltenen Tumoren des Rachenraumes und seltenen Lymphomen eine Rolle spielen könnte. Belege dafür fehlen jedoch.
Therapie: Die Therapie ist symptomatisch. Bei Fieber ist auf den Flüssigkeitsausgleich zu achten, evtl. sind auch fiebersenkende Medikamente angezeigt.
In ca. 10% der Fälle kommt es zu einer bakteriellen Superinfektion, die gegebenenfalls mit Antibiotika behandelt werden muss. Es ist zu beachten, dass einige Antibiotika wie Ampicillin und Amoxicillin bei einer akuten EBV-Infektion Arzneimittelexantheme oder selten sogar ein lebensbedrohliches Lyell-Syndrom hervorrufen können.
Postinfektiöse Immunität: Die infektiöse Mononukleose hinterläßt eine lebenslange Immunität. Bisweilen ist aber eine erneute Infektion mit anderen EBV-Subtypen möglich.
Vorbeugung: Meidung des Kontaktes zu erkrankten Personen. Einen Impfstoff gibt es bisher nicht.
Weblinks:
Rhadinoviren: Humanes Herpesvirus 8 (HHV-8)
| Humanes Herpesvirus 8 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
HHV-8 ist bei HIV-Infektion mit der Entstehung des Kaposi-Sarkoms assoziiert. Weiterhin kann HHV-8 an der Genese bestimmter Lymphome beteiligt sein.
Das Kaposi-Sarkom: Das Kaposi-Sarkom ist eine, vor allem im Zusammenhang mit AIDS auftretende Neoplasie, deren Ursache auf das Humane Herpesvirus Typ 8 (HHV-8) in Verbindung mit Kofaktoren zurückzuführen ist.
Es wurde 1872 durch Moritz Kaposi (1837-1902), einem Dermatologen aus Wien benannt. Früh entdeckt wurde eine leichtere Variante dieser Krankheit, die ihre Verbreitung hauptsächlich bei südlich der Sahara lebenden Männern jenseits des 50. Lebensjahres hat.
Die besonders unter Immunsuppression auftretende Krankheit äußert sich durch das Auftreten von braun, bläulichen Tumorknoten vor allem im Bereich von Schleimhäuten und im Darm. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Bei der mit AIDS assozierten Form treten braun, bläulichen Flecken multifokal meist auch auf der Haut von Beinen und Armen auf.
Die Diagnose wird klinisch und ggf. histopathologisch gestellt.


Der Verlauf ist häufig chronisch. Eine Metastasen-Bildung in Lymphknoten und anderen Organen ist möglich. Ebenfalls möglich ist bei nicht vorhandener HIV-Assoziation ein seltener, direkter Befall der Lymphgefäße mit anschließender Ausbreitung auf innere Organe.
Bei Transplantationen besteht ein erhöhtes Erkrankungsrisiko durch die Immunsuppression. Die Erkrankung manifestiert sich hier häufig direkt an den inneren Organen.
Therapie: Verbesserung des Immunstatus, z.B. durch Anpassung der antiretroviralen Kombinationstherapie bei AIDS bzw. der immunsuppressiven Therapie bei Transplantation.
Weitere Therapieansätze:
- Lokaltherapien: Exzision, Lasertherapie, Strahlentherapie, Physikalische Therapie.
- Chemotherapien: Liposomal verkapseltes Doxorubicin bzw. Daunorubicin.
- Experimentell: Antiangiogenese-Therapie (SU5416), Interferon-Alpha.
Literatur und Weblinks:
Adenoviridae
Humane Adenoviren
| Humanes Adenovirus C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenoviren befallen Säuger (Mastadenoviren) und Vögel (Aviadenoviren). Erstmals wurden sie aus menschlichen Rachenmandeln (Adenoide) isoliert, denen die Viren-Familie ihren Namen zu verdanken hat.
Morphologie und Eigenschaften: Adenoviren haben eine Polyederform aus zwanzig Flächen (Ikosaeder), die sich aus 252 Kapsomeren zusammensetzen (240 Hexons und 12 Pentons), von den Pentons stehen lange Fibern ab. Die Viren sind ca. 80-110 nm groß, besitzen keine Hüllmembran und enthalten eine nicht-segmentierte, doppelsträngige, lineare DNA mit einer Länge von von 30-38kb. Man unterscheidet bisher 49 immunologisch unterschiedliche humanpathogene Subtypen (A-F). Adenoviren zeichnen sich durch eine ungewöhnliche Stabilität gegenüber chemischen und physikalischen Einwirkungen aus und tolerieren widrigste pH-Werte, was ihnen eine vergleichsweise lange Überlebenszeit außerhalb des Wirtes ermöglicht.
Pathogenese: Die Viren infizieren Epithelzellen z.B. der Atemwege, der Konjunktiven oder im Magen-Darm-Trakt, die im Zuge der Virusvermehrung zugrunde gehen (CPE ohne Fusionen). Daraufhin wandern Entzündungszellen (Makrophagen, Lymphozyten) in das Gewebe ein. Eine Virämie ist nur bei Immunsuppression zu beobachten. In manchen Fällen persistieren die Viren länger in den betroffenen lymphatischen Organen (Tonsillen, Peyer-Plaques).
Bei Nagetieren wurden Zelltransformationen beobachtet.
Klinik: 50% der Infektionen verlaufen asymptomatisch. Adenoviren verursachen hauptsächlich respiratorische Infekte (5% der Atemwegsinfekte bei Kindern). Abhängig vom jeweiligen Serotyp können allerdings auch eine Reihe anderer Erkrankungen hervorgerufen werden wie Gastroenteritis (10% der infektiösen Gastroenteritiden), Konjunktivitis und Zystitis. Die Symptome der Atemwegserkrankung durch Adenoviren reichen von der einfachen Erkältung über die Bronchitis bis zur Pneumonie. Bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem besteht eine besondere Anfälligkeit für ernsthafte Komplikationen der Adenoviren-Infektionen, wie zum Beispiel das ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome).
Spätkomplikationen: Diskutiert werden verschiedene Krankheitsbilder, die sich als Spätfolgen einer Adenoviren-Infektion einstellen können, wie beispielsweise die persistierende Bronchiolitis, die dilatative Kardiomyopathie, Typ-I-Diabetes oder Hörsturz.
Epidemiologie: Adenoviren werden durch direkten Kontakt, fäkal-oral und gelegentlich durch Wasser weitergegeben. Einige Arten verursachen persistente, asymptomatische Infektionen von Hals- und Rachenmandeln oder Magen-Darm-Trakt des Wirtes; eine Ausbreitung kann über Monate oder Jahre erfolgen. Wenige Adenoviren (beispielsweise die Serotypen Ad1, 2, 5 und 6) sind nachgewiesenermaßen in einigen Zonen der Welt endemisch, die Infektion erfolgt hier in der Regel bereits in der Kindheit. Andere Arten verursachen bei ansonsten sporadischen Infektionen gelegentliche Ausbrüche. So wird zum Beispiel die epidemische Keratokonjunktivitis durch die Serotypen Ad8, 19 und 37 ausgelöst. Epidemisch auftretende fieberhafte Erkrankungen mit Konjunktivitis sind oftmals mit Adenoviren assoziiert und treten im Allgemeinen im Umfeld unzureichend chlorierter Schwimmbecken und kleiner Seen auf. Gastroenteritiden werden, insbesondere bei Kindern, durch die Serotypen Ad40 und 41 ausgelöst. Bei einigen Serotypen variiert das klinische Spektrum der infektionsassoziierten Erkrankungen abhängig von der Eintrittspforte. So geht beispielsweise eine Infektion mit Adenovirus Ad 4 und 7 durch Inhalation mit schwerwiegenden Erkrankungen der unteren Atemwege einher, während eine orale Übertragung des Virus keine beziehungsweise nur eine milde Infektion verursacht.
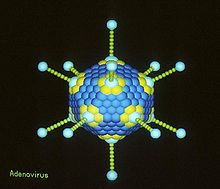
Diagnose: Antigen-Detektion (ELISA), PCR-Assay, Virusisolation (CPE) und serologischer Antikörpernachweis (ELISA, KBR) können zum Nachweis von Adenovirus-Infektion genutzt werden. Die Typbestimmung wird in der Regel durch Hämagglutinationshemmungsreaktion oder Neutralisation mit typspezifischen Antisera vorgenommen. Da Adenoviren über einen längeren Zeitraum ausgeschieden werden können, bedeutet der Nachweis des Virus nicht unbedingt auch den Nachweis einer Erkrankung.
Therapie: Die meisten Infektionen verlaufen mild und erfordern keine Therapie beziehungsweise eine symptomatische Behandlung. Bei Immunschwäche Ribavirin.
Prävention: Trinkwasserhygiene. Für die Serotypen 4 und 7 wurde ein anttenuierter Lebendimpfstoff entwickelt, der allerdings wegen dem nicht auszuschließenden onkogenen Potential nur zur Prävention schwerer Atemwegsinfektionen bei Rekruten der US-Streitkräfte verfügbar ist. Für die effektive Beschränkung der Ausbreitung Adenovirus-assoziierter Erkrankungen, wie zum Beispiel die epidemische Keratokonjunktivitis, die 2004 die vorübergehende Schließung mehrerer Bundeswehr-Stützpunkte bedingte, ist eine sorgfältige Infektionskontrolle notwendig. Patienten im Krankenhaus mit Verdacht oder Nachweis einer (hochinfektiösen) Keratokonjunktivitis epidemica müssen isoliert werden, besser noch werden sie zuhause behandelt.
Therapeutische Anwendung von Adenoviren in der Medizin: Adenoviren finden vermehrt Einsatz in der medizinischen Forschung, so zum Beispiel als Dystrophinträger in der Gentherapie der Duchenne-Muskeldystrophie, als genmanipulierte Vakzine beispielsweise gegen Ebola-Infektionen oder in der Krebstherapie zur Hemmung von Tumorwachstum.
Weblinks:
Polyomaviridae
Polyoma-Viren
| Polyoma-Viren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
Polyomaviren sind kleine DNA-Viren, die Tiere (die aviären Polyomaviren lösen bei Vögeln die Französische Mauser aus) und Menschen infizieren können.
Das Polyomavirus BK ist bei Nierentransplantatempfängern mit Ureterstenose und interstitieller Nephritis assoziiert und kann zum Transplantatverlust führen. Knochenmarkempfänger können durch Polyomavirus BK eine hämorrhagische Zystitis erleiden. Das Virus persistiert in der Niere, die Durchseuchung beträgt 100%.
Das JC-Virus (JCV) oder JC-Polyomavirus ist genetisch dem BK-Virus und dem SV40 ähnlich. Es wurde 1971 entdeckt und nach den Initialen eines Patienten mit progressiver multifokaler Leukoenzephalopathie (PML) benannt, aus dem es erstmals isoliert wurde. Pathogen ist das Virus nur bei zellulärer Immundefizienz (z.B. AIDS St. C3). Die Durchseuchung beträgt 70-90%, wobei das Virus in der Niere persistiert, die Infektion erfolgt meist schon in der Kindheit.
SV40 ist die Abkürzung für Simian vacuolating virus 40 bzw. Simian virus 40. Das Polyomavirus wird bei Affen und Menschen gefunden. Zuerst entdeckte man es 1960 in Rhesusaffen-Nierenzellkulturen, die zur Herstellung von Poliomyelitis-Vaccinen verwendet wurden.
Bau und Genom: Das Kapsid besteht aus 360 Untereinheiten. Die doppelsträngige 5243 Nucleotide lange DNA enthält eine Regulatorregion und kodiert das T-Antigen sowie die drei Kapsidproteine VP1, VP2 und VP3 mit überlappenden Leserahmen (reading frames). Das T-Antigen ist ein Multifunktionsprotein und besteht aus drei Bauteilen. Das ringförmige Hexamer nimmt die Virus-DNA auf, die zweite Domäne erkennt und bindet mit einem kleinen Patch die Regulatorregion, die dritte Domäne rekrutiert zelluläre Proteine.
Die Infektion ist meist latent und kann bei Affen unter Immunsuppression zur Nieren- und Demyelinisierungserkrankungen ähnlich PML führen. In anderen Spezies, z.B. Hamstern kann SV40 diverse Tumore z.B. Sarkome hervorrufen. Der Krankheitswert beim Menschen ist noch unklar.
Literatur und Weblinks:
- Nierenratgeber - Polyomavirus Infektion (BK-Virus)
- CDC - Simian Virus 40 (SV40), Polio Vaccine, and Cancer
Papillomaviridae
Humane Papilloma-Viren (HPV)
| Humane Papilloma-Viren | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||||||||
Humane Papilloma-Viren stellen eine Gruppe von mehr als 150 verschiedenen DNA-Viren dar, denen zur Unterscheidung eine Zahl nachgestellt wird. Es handelt sich um unbehüllte, doppelsträngige DNA-Viren (dsDNA). Da sie durch sexuelle Kontakte übertragen werden können, zählen die durch sie verursachten Erkrankungen zu den sexuell übertragbaren Krankheiten (STD).
HPV verursachen v.a. Warzen. Einige Arten infizieren die Schleimhäute im Genitalbereich und können, ohne sich zuvor durch eine Warzenbildung bemerkbar gemacht zu haben, nach länger dauernder Infektion Karzinome auslösen. Das Zervixkarzinom, sowie vermutlich auch ein erheblicher Teil der Vulva-, Penis- und Analkarzinome sind Folge solcher Infektionen. Die Gen-Produkte dieser Viren, vor allem die des E6- und E7-Gens, verhindern die Apoptose. Die durch Papilloma-Viren verursachten Hautveränderungen sind häufig nicht mit bloßem Auge zu erkennen.
Virusgruppen: 83 HPV-Typen sind bisher vollständig beschrieben. Etwa 30 davon infizieren fast ausschließlich Haut und Schleimhaut im Anogenitalbereich. Die genitalen HPV-Typen lassen sich generell in 2 Gruppen einteilen, die low risk- und die high risk-Typen. Die Hochrisiko-Typen sind bei über 99% aller Fälle von Zervixkarzinomen identifiziert worden. Die Mehrheit der Zervixkarzinome (ca.70%) wird durch die Hochrisiko-Typen HPV 16 und 18 hervorgerufen.
Niedrigrisiko-HPV-Typen werden praktisch nie bei Karzinomen nachgewiesen. Die Typen 6 und 11 sind Hauptverursacher genitaler Warzen.
Typen sind:
- 1. "low-risk"-Viren: Zu dieser Gruppe werden HPV 6 und 11 gezählt, weil sie als Verursacher von Warzen in Genitalbereich (Condyloma acuminatum, auch Feigwarzen) keine potentiell lebensgefährlichen Erreger sind. Weitere low-risk Typen sind HPV 42, 43 und 44.
- 2. "high-risk"-Viren: Zur zweiten Gruppe gehören v.a. HPV 16, 18, 31 und 33, aber auch 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 und 68. Bei beinahe jedem Auftreten eines Zervixkarzinoms ist mindestens eine der high-risk HPV-Gruppen im HPV-Screening nachweisbar. Auch einige Krebserkrankungen im Bereich des Afters sowie des Mundes gelten als HPV-assoziiert.
Die gefährlichen Virus-Untergruppen werden auch bei Krebserkrankungen des Penis, der Vulva, des Anus und des Mundes beobachtet.
Übertragung: Die Infektion erfolgt hauptsächlich über Hautkontakt, bei bestimmten Virentypen primär durch ungeschützten Sexualverkehr. Die HPV-Infektion ist daher eine der häufigsten durch Geschlechtsverkehr übertragenen Infektionen, oft bleibt die Ansteckung jedoch unbemerkt. Kondome können das Übertragungsrisiko reduzieren, wenn sie den Kontakt mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder erregerhaltigen Körperflüssigkeiten verhindern. Seltener erfolgt die Übertragung auch durch gemeinsam benutzte Handtücher, Trinkgläser oder Zahnbürsten.
 |
 |
 |
Epidemiologie: Bei Frauen unter 30 Jahren liegt die Infektionsrate bei bis zu 25%. Bei über 30-jährigen beträgt sie immer noch bis 8%. Die HPV-Infektion heilt häufig innerhalb von Monaten bis hin zu 1½ Jahren ab. Die Immunitätslage spielt hierbei eine wichtige Rolle. Allgemeine Zahlen zu den Infektionsraten bei Männern gibt es nicht (keine reguläre Vorsorgeuntersuchungen). Bei bis zu 70% der männlichen Partner einer Frau, die im HPV-Screening positiv getestet wurde, besteht ebenfalls eine (unbemerkte) Infektion, die oft nur kleinste Läsionen am Penis verursacht.
Krankheitsfolgen: Nach einer Infektion können Papilloma Viren oft jahrelang inaktiv bleiben, bevor sie Symptome verursachen. Dies gilt sowohl für die low-risk- als auch für die high-risk-Viren.
Die häufigsten Krankheitsfolgen sind Warzen (z.B. die Verruca vulgaris), besonders Feigwarzen (Condylomata acuminata) und bei Frauen das Zervixkarzinom.
Männer und HPV: Mehrere Studien zeigen, dass etwa 64-70% der männlichen Beziehungspartner von Frauen, die unter einer zervikalen HPV-Erkrankung leiden, ihrerseits HPV-assoziierte Läsionen am Penis aufweisen.[3] Die Infektion kann lange unerkannt präsent bleiben. In seltenen Fällen können bösartige Veränderungen, auch Karzinome am Penis auftreten. Da das Peniskarzinom bei beschnittenen Männern extrem selten ist, werden Smegmaretention und wiederholte Entzündungen der Vorhaut und der Eichel (chronische Balanitiden) bei unbeschnittenen Männern als entscheidende Faktoren der in zeitlicher wie auch ursächlicher Hinsicht Karzinogenese angesehen.[4].
Mehrere Studien deuten auf HPV-Infektionen als Verursacher von Oralkarzinomen hin. Unter anderem eine französische Studie diagnostizierte bei einer hohen Anzahl solcher Patienten auch HPV. Als Übertragungsweg gilt hier Oralverkehr. Einen sicheren Schutz gibt es nicht. Jedoch mindert die stringente Verwendung von Kondomen vermutlich das Übertragungsrisiko.
Diagnose: Die Tatsache, dass in ungefähr 90% der Zervixkarzinome High-risk-Typen vorkommen (HPV16 50%, HPV18 20%) unterstreicht die Bedeutung der HPV-Infektion bei diesem Karzinom, welches weltweit die zweithäufigste Krebstodesursache bei Frauen ist. Für beide Erreger gilt, dass der rasche, praktikable und sichere Nachweis in der Routinediagnostik heute noch problematisch, schwierig und teuer ist. Insbesondere bei niedrigen Keimkonzentrationen treten falsch negative Ergebnisse auf.
Derzeit laufen Studien, die Auskunft darüber geben sollen, ob ein routinemäßiges Screening nach diesen Viren die Entwicklung von Krebserkrankungen reduzieren kann, indem Träger fragwürdiger Zellbefunde in ausgewählten Fällen einer vorzeitigen Behandlung unterzogen werden. Tests, Screenings und Heilmethoden müssen derzeit noch vom Patienten selbst bezahlt werden, da die Krankenkassen die Ergebnisse der vorgenannten Studien abwarten.
Therapie: Eine spezifische Papillomvirus-Therapie gibt es gegenwärtig nicht. Bei vorliegenden Läsionen kommen im wesentlichen chirurgische Eingriffe, Laser- und Kryotherapie in Frage sowie lokale Behandlungen mit Ätzlösungen (Trichloressigsäure) oder dem Immunmodulator Imiquimod. Rezidive sind häufig.
Vorbeugung: Kondome. Gardasil®, ein Impfstoff gegen HPV wurde im Frühsommer 2006 von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassen. Ein zweiter Impfstoff (Cervarix®) folgte 2008.[5]
Literatur und Weblinks:
- RKI - Papillomaviren
- DermIS - Verruca vulgaris, DermIS - Condyloma acuminatum, DermIS - Buschke-Loewenstein-Tumor
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 . “Begründung der STIKO für eine allgemeine Varizellenimpfung”. ', 2.6. 2004.
- ↑ CDC - Varicella
- ↑ http://www.cervical-cancer.de/faqhpv.html
- ↑ http://www.tumorzentrum-tuebingen.de/pdfinhal/penis.pdf
- ↑ http://www.glaxosmithkline.de/produkte/cervarix.php
Parvoviridae
Humanes Parvovirus B19
| Humanes Parvovirus B 19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||||
Erreger: Das Parvovirus B 19 ist der Erreger der Ringelröteln (Syn.: Erythema infectiosum, Fünfte Krankheit) und das kleinste humanpathogene Virus überhaupt. Es enthält einen einzelnen Strang DNA und besitzt keine Hülle. Es werden heute mindestens drei Genotypen (1, 2 und 3) mit verschiedenen Subtypen unterschieden. Es bestehen geographische Korrelationen zwischen der Verbreitung der verschiedenen Genotypen, wobei Genotyp 1 in Europa am häufigsten verbreitet ist. Das Virus benutzt zur Vermehrung bevorzugt erythroide Vorläuferzellen im Knochenmark, dabei verhindert es deren Ausreifung da es sie während seines lytischen Infektionszyklus zerstört, um die Zellen zu verlassen.
Geschichte: Den Namen „fünfte Krankheit“ oder „fifth-disease“ im englischen Schrifttum erhielten die Ringelröteln durch die historische Angewohnheit der Ärzte, seit dem 17. Jahrhundert die Kinderkrankheiten mit Hautausschlag (Exanthem) voneinander abzugrenzen und in Unkenntnis der Ursachen einfach durchzunummerieren. Masern und Scharlach waren die beiden ersten. 1881 wurden die Röteln allgemein als dritte Kinderkrankheit mit Hautausschlag akzeptiert. Später wurde von verschiedenen Autoren eine Unterform der Röteln als eigene Erkrankung beschrieben und seit 1900 vierte Krankheit genannt. In den letzten 50 Jahren ist es allerdings umstritten, ob es diese wirklich als eigenständige Krankheitseinheit gibt. Seit 1905 ist die fünfte Krankheit als Bezeichnung für eine weitere exanthematöse Kinderkrankheit anerkannt gewesen, für die der Erreger lange Zeit unbekannt blieb. 1974 fiel der Virologin Yvonne Cossart, die in London das Blut von gesunden Blutspendern auf das Vorhandensein von Oberflächenbestandteilen des Hepatitis B Virus untersuchte, bei einer Probe mit der Nummer 19 des Panels B eine ungewöhnliche Reaktion auf. Beim Erforschen der Ursache wurde ein Virus entdeckt, das in der Elektronenmikroskopie den Parvoviren glich und später den Namen Parvovirus B19 erhielt. Die große Familie der Parvoviren (Parvoviridae) schließt viele tierpathogene Viren ein. Erst 1981 konnte mit dem Nachweis einer Parvovirus-B19-Infektion bei Patienten mit Sichelzellenanämie und dem vorübergehenden Erliegen der Blutbildung (aplastische Krise) ein Zusammenhang zu einer Erkrankung hergestellt werden. Zwei Jahre später konnten Infektionen durch Parvovirus B19 als Ursache der Ringelröteln identifiziert werden.
Epidemiologie: Einzige Infektionsquelle ist der Mensch. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion bei direktem Kontakt, durch infizierte Blutprodukte sowie transplazental von der Mutter auf den Fetus. Die Kontagiösität ist in den ersten vier bis zehn Tagen nach Infektion am größten. Das heißt, dass Kinder im Stadium mit Hautausschlag praktisch nicht mehr ansteckend sind. Vermutlich hinterlässt die Infektion eine lebenslange Immunität. Die Durchseuchungsrate liegt im Vorschulalter bei etwa 5-10%, im Erwachsenenalter bei 60-70%. Zahlen über mütterliche Infektionen in der Schwangerschaft liegen nicht vor, sie scheinen aber selten zu sein. Bei einer gesicherten Infektion der Mutter liegt das Erkrankungsrisiko für das ungeborene Kind etwa bei 5-10% und ist am größten bei Infektion zwischen der 13. und 20. Schwangerschaftswoche.
Die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der ersten Symptome (Inkubationszeit) beträgt in der Regel 4 bis 14 Tage (maximal 3 Wochen).


Symptome:In der Mehrzahl der Fälle verläuft die Infektion symptomlos und es findet eine stille Feiung statt (Immunisierung ohne vorherige Impfung bei einer Infektion ohne Krankheitsanzeichen). In anderen Fällen finden sich grippeähnliche Symptome ohne Exanthem. Der typische Ausschlag wird nur bei 15-20% der Infizierten beobachtet. Er beginnt an den Wangen mit großen roten Flecken, die zusammenfließen. Meist ist die Mundpartie ausgespart (slapped-cheek exanthem). An den folgenden Tagen treten von oben nach unten an Schultern, Oberarmen, Oberschenkeln und Gesäß teilweise leicht erhabene Flecken auf, die dazu neigen zusammenzufließen und in der Mitte abblassen. Dadurch entstehen charakteristische girlandenartige Muster. Die Hauterscheinungen können wechselhaft und flüchtig sein oder bis zu sieben Wochen andauern. Das Allgemeinbefinden ist dabei nur wenig beeinträchtigt. Bei jungen Erwachsenen wurden auch vaskulitische Hauterscheinungen mit strenger Begrenzung auf Hände und Füße beschrieben.
Komplikationen: Gelegentlich kommt es zur Gelenkbeteiligung mit Gelenkschmerzen und Gelenkentzündungen bevorzugt der kleinen Gelenke, insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen. Die Beschwerden dauern zwei Wochen bis mehrere Monate an und lassen auch ohne spezifische Behandlung von alleine wieder nach.
Bei Patienten mit chronischer hämolytischer Anämie kann es zur aplastischen Krise kommen. Eine solche durch Parvovirus B 19 ausgelöste aplastische Krise ist oft sogar das erste Anzeichen einer Kugelzellenanämie. Ein Hautausschlag fehlt bei diesen Patienten fast immer.
Bei Patienten mit angeborenen oder erworbenen Defekten des Abwehrsystems oder unter Immunsuppression ist die Elimination des Virus gestört. Dadurch kann es zu einer chronischen Myelosuppression mit rezidivierenden Anämien kommen. Typischerweise sind bei diesen Patienten keine spezifischen Antikörper gegen Parvovirus B 19 nachweisbar.
Schwangerschaft: Während der Schwangerschaft wird das Parvovirus B 19 in etwa einem Drittel der Fälle diaplazentar auf das Ungeborene übertragen. Es befällt besonders die blutbildenden Zellen in Leber und Knochenmark mit der möglichen Folge einer schweren Anämie beim Ungeborenen (ca. 10%). Häufige Begleiterscheinungen sind der Hydrops fetalis (ca. 10%), Aszites, kardiale Dekompensation und im schlimmsten Fall Fehl- bzw. Totgeburt (ca. 9%, besonders hohes Risiko bei Infektion im Zeitraum der 10.-22. Schwangerschaftswoche).
- Pränatale Diagnostik: Schwierig. Das Virus kann vorgeburtlich evtl. im kindlichen Blut oder im Fruchtwasser nachgewiesen werden, dies gelingt jedoch nicht immer. Gleiches gilt für den Nachweis von Antikörpern und selbst ein Nachweis ist zum Teil bei Ungeborenen nicht aussagekräftig. Die Kontrolle der Kindesentwicklung mittels Ultraschalluntersuchungen in relativ kurzen Abständen ist daher das Mittel der Wahl zur Dokumentation des Infektionsverlaufes. Insbesondere auf die Ausbildung eines Hydrops fetalis ist hier zu achten und ggf. sind andere Ursachen wie z.B. die Rhesus-Unverträglichkeit abzuklären.
- Therapie: Bei fetaler Anämie intrauterine Gabe von Erythrozytenkonzentraten über die Nabelschnur oder intrauterine Bluttransfusion.
- Prg.: Verläuft die Infektion ohne Komplikationen, ist in der Regel nicht mit Spätschäden für das Kind zu rechnen (Alles-oder-Nichts-Prinzip). Die Parvovirus-B-19-Infektion in der Schwangerschaft ist daher auch keine Indikation für eine Interruptio.
Diagnose: Bei typischem Exanthem kann die Diagnose klinisch gestellt werden. In unklaren Fällen können virusspezifische Antikörper im Serum nachgewiesen werden. In besonderen Fällen kann auch die Virus-DNA in Blut, Knochenmark oder Fruchtwasser nachgewiesen werden. Bei Infektionen des ungeborenen Kindes während der Schwangerschaft sind die spezifischen IgM-Antikörper bei Geburt häufig (noch) nicht im Blut nachweisbar.
Differentialdiagnose: Die Ringelröteln sollten vor allem gegen die anderen mit einem Hautausschlag einhergehenden Infektionskrankheiten abgegrenzt werden, z.B. Scharlach, Masern, Windpocken, Röteln, Drei-Tage-Fieber.
Therapie: Eine spezifische Therapie gibt es nicht. Eine symptomatische Therapie ist zumeist nicht nötig. Bei Patienten mit Immundefekt, chronischer Anämie und Virus-Persistenz können Immunglobuline eingesetzt werden. Bei frischer Infektion in der Schwangerschaft sind wöchentliche Ultraschallkontrollen angezeigt. Zeigen sich hier Zeichen eines Hydrops fetalis, sollte mit intrauterinen Bluttransfusionen behandelt werden.
Prophylaxe: Eine Impfung existiert nicht. Schwangere sollten den Kontakt zu erkrankten Kindern meiden.
Literatur und Weblinks:
- E. Weir: Parvovirus B 19 infection: fifth disease and more. Canadian Medical Association Journal, 2005, 172:743, ISSN 0008-4409
- N.S. Young, K.E. Brown: Parvovirus B 19. New England Journal of Medicine, 2004, 350:586-97, ISSN 1533-4406
- E.D. Heegaard, K.E. Brown: Human Parvovirus B19. Clinical Microbiology Reviews, 2002, 15:485-505, ISSN 1098-6618 (Volltext)
- DermIS - Erythema infectiosum
- CDC - Parvovirus B19 (Fifth Disease)
Hepadnaviridae
Hepadnaviridae sind eine Familie hepatotroper DNA-Viren mit einer zirkulären, teilweise doppelsträngigen DNA. Der Hauptvertreter dieser Familie ist das Hepatitis-B-Virus (HBV).
Die Hepadnaviren werden zu den Pararetroviren gezählt, da sie wie die Retroviren ihr Genom über eine prä-genomische RNA (pgRNA) mittels einer Reversen Transkriptase in DNA umschreiben. Die Virionen enthalten, im Gegensatz zu den Retroviren, keine RNA sondern DNA. Grundsätzlich werden die heute bekannten Hepadnaviren in zwei Genera unterschieden.
Orthohepadnaviren
Außer dem Hepatitis B Virus (HBV) des Menschen werden die Viren der Erdhörnchen (Ground squirrel; GSHV), der Waldmurmeltiere (Woodchuck; WHV), der Orang-Utans (Orang-Utan Hepatitis B Virus; OHV) und der Wollaffen (Woolly monkey; WMHBV) dem Genus der Orthohepadnaviridae, der Hepadnaviren der Säugetiere, zugeordnet.
Hepatitis-B-Virus (HBV)
| Hepatitis-B-Virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||
Mit etwa 350 Millionen chronisch infizierter Menschen gehört die Hepatitis B neben der Tuberkulose und HIV zu den häufigsten Infektionskrankheiten der Welt.
Erreger: Das Hepatitis-B-Virus (HBV) ist ein etwa 42nm großes, partiell doppelsträngiges DNA-Virus mit einer Lipoproteinhülle, die das Hepatitis-B-Oberflächen-Antigen HBsAg (hepatitis-B-surface-antigen) enthält. Mittlerweile sind einige klinisch bedeutsamen Virusvarianten und -mutanten entdeckt worden, wie beispielsweise die sogenannte Prä-Core-Mutante ("HBe-minus"-Mutante). Diese Virus ist nicht mehr in der Lage, das HBeAg zu bilden, das als diagnostischer Marker eine Rolle spielt. Die betroffenen Patienten weisen daher trotz oft hoher Virusvermehrung (Replikation) kein HBeAg auf. Das HBV enthält weiterhin das HBc-Antigen (c für core).
Vorkommen: Das HBV kommt endemisch in Südostasien und im tropischen Afrika vor. Dank der seit einigen Jahren durchgeführten Impfkampagnen ist das Vorkommen in Nord- und Westeuropa, USA, Kanada, Mexiko und südlichen Regionen Südamerikas auf unter 0,1% der chronischen Virusträger gefallen.
Übertragung: Eine Übertragung ist durch Blut, bluthaltigen Speichel, Samenflüssigkeit und Scheidensekret möglich. Die Eintrittspforten sind kleinste Verletzungen der Haut oder Schleimhaut. Risikofaktoren sind ungeschützter Geschlechtsverkehr, intravenöser Drogenkonsum, berufliche Tätigkeit im Gesundheitswesen, Erhalt von Blutprodukten ohne vorherige HBV-Testung, weiterhin zahnärztliche und invasive medizinische oder kosmetische Maßnahmen (Tätowierung, Piercing). Unter Kleinkindern kann die Infektion etwa durch Kratzen oder Beißen weitergegeben werden. Auch die Gegenstände des täglichen Lebens, wie zum Beispiel Rasierapparate oder Nagelscheren können eine Übertragung ermöglichen. Häufigster Übertragungsweg ist aber der Geschlechtsverkehr und die vertikale Infektion unter der Geburt von der zumeist chronisch infizierten (HbsAg-positiven) Mutter auf das Kind. HBV-positive Mütter können ihre Kinder gefahrlos stillen, wenn diese simultan geimpft wurden.
Jedes Spenderblut wird in der Regel auf Hepatitisviren getestet, deshalb sind Ansteckungen durch Transfusionen nahezu ausgeschlossen.
Das Risiko der Infektion durch einer Nadelstichverletzung bei bekannt positiver HBV-Infektion liegt bei etwa 30% und ist damit drastisch höher als z.B. bei HIV.

Verlauf: Die Inkubationszeit beträgt 40 bis 160 Tage. Der Verlauf wird vor allem von der Immunantwort bestimmt. Definitionsgemäß spricht man von einer chronischen Hepatitis B, wenn die Symptome einer durch HBV verursachten Leberentzündung sowie entsprechende viralen Marker länger als 6 Monate persistieren, was in 5 bis 10% der Fälle der Fall ist. Die Chronifizierung kann sich entweder im Anschluss an eine akute Hepatitis B oder auch primär entwickeln. Mit sinkendem Alter nimmt die Chronifizierungsrate stetig zu und ist bei Neugeborenen am höchsten. Diese werden bei einer Infektion in über 90% der Fälle zu chronischen Virusträgern. Noch bei vierjährigen Kindern verläuft die Hälfte aller Infektionen chronisch. Bei etwa einem Viertel aller chronischen Hepatitis-B-Erkrankungen ist ein progredienter Verlauf zu beobachten, Leberkarzinome oder Leberzirrhose können folgen. Bis zu 25% der Erkrankten sterben an den Folgekrankheiten der Hepatitis B (Leberzirrhose, Leberzellkarzinom). Etwa 5% der HBV-Infizierten sind zusätzlich an Hepatitis D erkrankt, wobei die sekundäre HDV-Infektion schwerer verläuft (second-hit) als die simultane HBV-HDV-Infektion.
Bei einer Hepatitis B-Infektion in der Schwangerschaft hat die Schwangerschaft keinen Einfluss auf den Krankheitsverlauf bei der Mutter und auch das Kind wird nicht infiziert. Erst mit der Geburt droht eine vertikale Transmission.
Symptome: Die Krankheit kann sich in Gelbsucht (weniger als 50%), Fieber, Abgeschlagenheit, Bauchschmerzen und Verdauungsbeschwerden äußern. In vielen Fällen verläuft die Infektion auch subklinisch.
Diagnose: Die Sicherung der Diagnose und Differenzierung der Krankheitsausprägung erfolgt mit dem serologischen Antigen- (HBs, HBe) und Antikörpernachweis (Anti-HBc, Anti-HBs, Anti-HBe), evtl. strebt man auch einen Nachweis viraler DNA an.
Antigene: Der Nachweis von Virus-Antigenen (HBs-Ag, HBe-Ag) spricht für eine virale Aktivität, das Virus repliziert sich und man muß von einer akuten oder chronischen Hepatitis B ausgehen. Patienten mit HBe-Ag im Blut sind hoch ansteckend aber auch bei alleinigem HBs-Ag im Blut besteht Ansteckungsgefahr (wegen der möglichen HBe-Minus-Variante muß ein negatives HBe auch nichts heißen).
Antikörper: Anti-HBs sind Zeichen einer Ausheilung, da sie meßbar auftreten, nachdem das HBs-Antigen eliminiert wurde (HBs-Serokonversion). Man findet sie auch nach erfolgreicher Hepatitis B Impfung. Anti-HBs zeigt also eine Immunität gegen das HBV an. Anti-HBc-IgM spricht für das Vorliegen einer akuten Hepatitis. Anti-HBcIgG findet man sowohl im späteren akuten Stadium, bei der chronischen Infektion wie auch nach einer Ausheilung. Anti-HBe können in der Heilungsphase einer akuten Hepatitis auftreten, nachdem das HBe eliminiert wurde (HBe-Serokonversion). Ihr Auftreten bei chronischer Hepatitis zeigt eine Verbesserung und eine verminderte Ansteckungsgefahr an.
Serokonversion: Beim akuten Verlauf eliminieren die erscheinenden Antikörper das Antigen, d.h. im Test fällt das Antigen ab, die Antikörper werden positiv. Bei HBe ist das etwa 3 Wochen nach Krankheitsbeginn der Fall. HBs fällt nach sechs Wochen ab, wobei oft erst weitere 3 bis 6 Monate später das anti-HBs nachweisbar wird. Die HBs-Serokonversion unterbleibt (d.h. HBs persistiert) in etwa 10 bis 20% der Fälle, was man als chronische Infektion deutet. Zum HBe: Leider gibt es auch HBe-Minus-Mutanten, so dass negative HBe- oder anti-HBe-Werte keine Aussage liefern.
Siehe zur Tabelle auch die Serologie-Kurven unter Wong's Virology - Hepatitis B oder Infekt.ch.
HBV-Serologie - Typische Konstellationen
| Transaminasen | anti-HBc-IgM | anti-HBc-IgG | HBs | Anti-HBs | HBe | anti-HBe | Diagnose: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leberzell-
schädigung |
Frische Infektion | Infektion hat stattgefunden | Virus-
vermehrung |
Abgelaufene Infektion (oder Z.n. Impfung) | Virus-
vermehrung |
? | |
| n | - | - | - | - | - | - | kein Erregerkontakt |
| n | - | - | - | + | - | - | Z.n. HBV-Impfung |
| n | - | - | + | - | - | - | unspezifische Reaktion -> Nachkontrolle |
| n oder + | - | - | + | - | + | - | Akute HBV-Infektion ohne Immunantwort (vor Serokonversion, Immunsuppression, neonatale Infektion), unspez. Reaktion |
| n oder + | + | + | + | - | + | - | Frische Infektion oder chronischer Schub. |
| n oder + | + | + | + | - | - | + | Frische Infektion mit HBe-Serokonversion (günstiger). |
| n oder + | + | + | - | - | - | +/- | Kürzlich abgelaufene Infektion (Diagn. Fenster HBs -> anti-HBs), Chronifizierung ohne Anti-HBs noch nicht sicher auszuschließen. |
| n | + | + | - | + | - | + | Kürzlich abgelaufene Infektion |
| n | - | + | - | + | - | +/- | Ausgeheilte, länger zurückliegende Infektion |
| n oder + | - | + | + | - | + | - | Chronische Infektion |
| n oder + | - | + | + | - | - | + | Chronische Infektion mit HBe-Serokonversion |
| n oder + | - | + | - | - | - | +/- | Infektion hat kürzlich stattgefunden (diagn. Fenster HBs-Serokonversion) oder sehr alt. Auch HBV-Infektion mit low level HBs-Ag oder Prä-S-Mutante möglich. |
| Transaminasen | anti-HBc-IgM | anti-HBc-IgG | HBs | Anti-HBs | HBe | anti-HBe | Diagnose |
Quelle: Fachaerzte.com - Hepatitis-Serologie
DNA: Früher hat man die DNA-Messung bei Hepatitis B zur Diagnose unklarer Fälle oder zur Abschätzung der Ansteckungsgefahr eingesetzt. Heute ist die Messung auch für die Diagnose und Beobachtung der chronischen Hepatitis wichtig. Wenig Virus-DNA im Blut spricht für eine ruhende Infektion, viel DNA für eine aktive chronische Hepatitis.
Nach den Mutterschaftsrichtlinien erfolgt eine Bestimmung von HBsAg in der 32-36. SSW (möglichst kurz vor der Entbindung).
Therapie: Im Akutstadium (d.h. in den ersten Monaten nach der Infektion) wird eine Hepatitis B gewöhnlich nur symptomatisch therapiert, da die Erkrankung in 90-95% der Fälle von selbst ausheilt.
Für eine chronische Hepatitis B stehen inzwischen mehrere Medikamente zur Verfügung, die allerdings i.d.R. keine Heilung versprechen, sondern nur den Verlauf verbessern können: Interferon-alpha und pegyliertes Interferon (das Interferon wird mit einem verzweigten Polyethylen-Glykol-(PEG)-Molekül versehen, so dass es als Depotpräparat nur einmal pro Woche verabreicht werden muss), Lamivudin und Adefovirdipivoxil. Weitere Wirkstoffe werden zur Zeit in Studien geprüft.
Selten (bis zu 3%) kann unter der Interferon-Therapie auch das HBsAg aus dem Blut verschwinden, was einer Heilung gleichkommt. Welcher Patient wann therapiert werden muss und mit welchem Medikament, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Bei sehr mildem Verlauf wird eine chronische Hepatitis B meist nur beobachtet.
Vorbeugung: Eine Impfung (aktive Immunisierung) ist möglich, wird bei allen Kindern und Jugendlichen empfohlen und ist als Bestandteil in den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (StIKo) der Bundesrepublik Deutschland im Impfkalender enthalten. Vor allem Personen in Heil- und Pflegeberufen, Dialysepatienten, Promiskuitive, Drogenabhängige, nach HBV-Exposition (Stichverletzung) und Reisende in Risikogebiete sollten nicht auf den Impfschutz verzichten.
Zur Vorbeugung der beschriebenen hohen perinatalen Infektionsgefahr bei infizierter Mutter (aufgrund des Schwangeren-Screenings sollte eine mütterliche Infektion bekannt sein) sollte das Kind innerhalb von 12 Stunden nach der Geburt eine Simultanimpfung (aktiv und passiv) bekommen. Dieser Impfschutz muss einen Monat nach der 1. Impfung durch eine 2. und abschließend 6 Monate nach 1. Impfung durch eine 3. Impfung mit dem Hepatitis-B-Impfstoff wiederum in kindgemäßer Dosierung.
Weblinks:
Retroviridae
Retroviridae
Das Retrovirus stellt eine besondere Klasse der Viren dar, welche in der Regel nur teilungsaktive, eukaryotische Zellen infizieren. Es ist ein behülltes Einzel(+)-Strang-RNA-Virus, (ss(+)RNA), dessen Erbinformation als RNA vorliegt, aber als DNA in das Genom der Wirtszelle eingebaut wird.
Taxonomie: Historisch wurden die Retroviren zunächst nach ihrem elektronenmikroskopischen Erscheinungsbild in Typ A, B, C oder D-Retroviren eingeteilt. Später folgte eine Klassifikation, die auch biochemische Eigenschaften und den Zelltropismus (d.h. den jeweils infizierten Zelltyp) berücksichtigte. Die Klassifikation unterschied Onkornaviren, Spumaviren und die Lentiviren. Die aktuellste und zur Zeit verbindliche Klassifikation durch das International Committee on Classification of Viruses unterteilt die Retroviren vor allem aufgrund ihrer genetischen Verwandtschaftsverhältnisse wie folgt:
Familie: Retroviren (Retroviridae)
- Unterfamilie: Orthoretroviren (Orthoretrovirinae)
- Gattung (Genus):
- Alpharetrovirus
- Betaretrovirus
- Gammaretrovirus
- Deltaretrovirus
- Epsilonretrovirus
- Lentivirus
- Gattung (Genus):
- Unterfamilie: Spumaretroviren (Spumavirinae)
- Gattung (Genus): Spumavirus
Beim Menschen sind bisher 4 RNA-Retroviren bekannt:
- HTLV-I (humanes T-Zell-lymphotropes Virus Typ I, ein Deltaretrovirus)
- HTLV-II (humanes T-Zell-lymphotropes Virus Typ II, ein Deltaretrovirus)
- HIV-I (humanes Immundefizienz-Virus Typ I, ein Lentivirus)
- HIV-II (humanes Immundefizienz-Virus Typ II, ein Lentivirus)
Die menschlichen Retroviren sind den Retroviren anderer Primaten so eng verwandt, daß häufig beide Gruppen unter der Bezeichnung Primaten-Retroviren zusammengefasst werden. Tatsächlich geht man auch heutzutage davon aus, daß die entsprechenden menschlichen Retroviren durch Übertragung von Affenretroviren auf den Menschen entstanden sind. Bei HTLV-I und HTLV-II hat diese Übertragung wohl schon vor Jahrtausenden stattgefunden, für HIV-I und HIV-II wahrscheinlich im 20. Jahrhundert.
Retroviren bestehen aus einer äußeren proteinbe- bzw. durchsetzten Lipid-Hüllmembran und einer inneren Proteinhülle, sowie einem "Kern" aus weiteren Proteinen und einem Ribonuklein-Komplex.
Besonderheiten: Retroviren
- sind die einzigen RNA-Viren, die diploid angelegt sind (d.h. jedes Retrovirus hat 2 Kopien seines Genoms)
- werden nur von den wirtseigenen Transkriptions-Enzymen übersetzt und neusynthetisiert
- benötigen eine spezifische zelluläre RNA (tRNA)
- sind die einzigen einsträngig-plusstrangorientierten RNA-Viren, bei denen das Genom nicht sofort als Matrize (mRNA) bei der Infektion benutzt werden kann.
Wenn das Virus diese RNA in die zu befallende Zelle eingebracht hat, muss die RNA in doppelsträngige DNA Desoxyribonukleinsäure (DNA), überführt werden. Dieser Vorgang wird reverse Transkription genannt. Dazu bringt das Virus das Enzym Reverse Transkriptase mit. Diese "schreibt" die RNA des Virus in DNA um, welche dann in das Genom der Wirtszelle integriert.
Normalerweise verläuft die Transkription an der DNA als Matrize, wobei ein komplementärer RNA-Strang synthetisiert wird; eine Ausnahme stellen die Retroviren und die Retroelemente (auch Klasse-I-Transposons genannt) dar. Das Retro bezieht sich auf die Umkehrung dieses Grundsatzes. Deshalb verursachen Retroviren oft latente Infektionen. Man nimmt an, dass das menschliche Genom im Laufe der Evolution mit unzähligen Retroviren durchsetzt wurde, die größtenteils längst nicht mehr infektiös sind. Sie erklären aber vielleicht die Existenz von "springenden Genen".
Da dieser Prozess durch die fehlende Korrekturlese-Fähigkeit der Reversen Transkriptase relativ ungenau ist, erfolgen häufige Mutationen des Virus. Diese ermöglichen eine schnelle Anpassung des Virus an antivirale Medikamente und damit eine Ausbildung von Resistenzen.
Medizinische Bedeutung: Zu den Retroviren gehören die Onkoviren, z.B. HTLV-I, -II, die Lentiviren, darunter der bekannteste Vertreter HIV, sowie die Spuma- oder Foamyviren, die in der Natur bei verschiedenen Tieren vorkommen und die keine Erkrankungen hervorrufen. Das Maedi-Visna-Virus infiziert beispielsweise Schafe.
Vermehrung: Die Vermehrung der integrierten Virus-DNA, auch Pro-Virus genannt, erfolgt entweder bei der Zellteilung mit der Verdopplung der Wirts-DNA oder intrazellulär durch die sogenannte Retrotransposition: Dabei wird der Pro-Virus aus der DNA wieder herausgeschnitten, vermehrt und an verschiedenen Stellen des Genoms wieder integriert.
Genom:
Das provirale Genom eines einfachen Retrovirus enthält in der Regel drei Gene und zwei LTRs (long terminal repeats), die sich am Anfang und am Ende befinden:
- Die LTRs enthalten Steuersequenzen zur Genexpression.
- gag codiert die Proteine der inneren Kapsel (gruppenspezifische Antigene)
- pol codiert die virale Protease, reverse Transkriptase(mit RNaseH) und Integrase
- env codiert die Proteine der Hülle
- ψ ist eine Sequenz für das Verpacken der RNA in die Virenhülle
Komplexe Retroviren, wie z.B. das HI-Virus enthalten noch weitere, regulatorische Gene. Bei HIV sind dies tat, rev, vif, nef, vpu und vpr, deren Genprodukte die Replikation kontrollieren.

Horizontaler Gentransfer:
Im Genom der Primaten befinden sich die Genome von zwei Retro-Viren (HERV-H und HERV-K, wobei "HERV" für "humanes endogenes Retrovirus" steht), die zu unterschiedlichen Zeiten integriert und vermehrt wurden. Ihre Evolution lässt sich auf Grund der Unterschiede in der Basensequenz rekonstruieren.
Erfolgt die Integration eines Retrovirus in eine Keimzelle, wird das Pro-Virus zum endogenen Retrovirus (ERV), es wird an die nächste Generation weitergegeben.
Evolutionärer Vorteil der Retroviren-Sequenzen (siehe Genom):
- Wenn die Retrovirensequenzen in vielfachen Kopien vorliegen, erleichtern sie wie andere repetitive Sequenzen den Stückaustausch zwischen den homologen Chromosomen während der Meiose (crossing over).
- Virale Sequenzen können funktionale Bestandteile von Wirtsgenen werden. So ist das Gen für das virale Hüllprotein env des HERV-W identisch mit dem Enzym Syncytin, das für den Aufbau der Plazenta benötigt wird. Möglicherweise unterdrückt das Protein die Abstoßung des Keimes durch das Immunsystem der Mutter. Ein HERV-Element, das in Nachbarschaft eines Amylase-Gens integriert wurde, steuert dessen Aktivität in den Speicheldrüsen.
- Besondere Bedeutung haben aber die LTR-Sequenzen (long terminal repeats) der HERVs. Sie befinden sich am Anfang und am Ende eines viralen Genoms und steuern seine Expression. Da die beiden LTR-Sequenzen miteinander rekombinieren können, ist im Laufe der Evolution ein Großteil der viralen Gensequenzen verloren gegangen. Übriggeblieben sind einzelne LTRs, die 8,5 % des Gesamtgenoms ausmachen. Vollständige virale Sequenzen machen nur 0,5 % aus. Mindestens 60 % dieser LTRs sind im menschlichen Genom noch aktiv und steuern Wirtsgene. Dabei lässt sich eine gewebespezifische Aktivität bestimmter HERVs feststellen: HERV-L in den Keratozyten der Haut, HERV-H in Lungen-Fibroblasten und Astrozyten.
Weblinks: VU-Wien - Retroviren
Lentivirus
Lentiviren sind behüllte Einzel(+)-Strang-RNA-Viren, (ss(+)RNA), mit Besonderheiten und bilden eine Gattung innerhalb der Familie der Retroviren. Sie können im Gegensatz zu den anderen Retroviren auch nicht teilungsaktive, eukaryotische Zellen infizieren.
Die Bezeichnung Lentiviren leitet sich von lat.: lentus = langsam ab, da diese Viren langsam fortschreitende, chronisch degenerative Krankheiten auslösen. Die am längsten bekannte Krankheit ist die Maedi-Visna-Erkrankung bei Schafen, die in den 1930ern und 1940ern erstmals in Island beobachtet wurde. Das auslösende Virus wurde in den 1950ern als das Maedi-Visna-Virus, abgekürzt MVV, beschrieben.
Zu den Lentiviren werden gezählt:
- das Humane Immundefizienz-Virus HIV mit den beiden Arten HIV-1 und HIV-2
- das Maedi-Visna-Virus der Schafe
- das Feline Immundefizienz-Virus der Haus- und Großkatzen
- das CAE Virus der Ziegen
- das BIV (Bovines Immundefizienz-Virus) der Rinder
- das Jembrana disease virus (Rind)
- das EIA Virus der Equiden (Pferde, Esel)
EIA und Jembrana gehören zu den Lentiviren, sie können jedoch im Gegensatz zu den anderen Viren eine akute Erkrankung hervorrufen.
HIV
| Humanes Immundefizienz-Virus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||||||
HIV (Humanes Immundefizienz-Virus, Menschliches Immunschwäche-Virus, engl.human immunodeficiency virus) ist die Bezeichnung für ein Virus, das die Krankheit Aids (Erworbenes Immundefektsyndrom, engl. acquired immunodeficiency syndrome) verursacht. Es gehört zur Klasse der Retroviren. Eine vollständige Entfernung des HI-Virus aus dem menschlichen Körper ist nicht möglich, da Retroviren in der Lage sind, ihren genetischen Code in das Erbgut des Wirts einzubauen. Eine Ansteckung führt nach einer unterschiedlich langen, meist mehrjährigen Inkubationsphase zu Aids, einer unheilbaren Immunschwächekrankheit. Bei einer Minderheit (< 5 %) – den sogenannten Long Term Non-Progressors – bricht die Krankheit erst nach Jahrzehnten oder möglicherweise nie aus.
HI-Viren werden unterteilt in den weltweit vorkommenden Stamm HIV-1 mit den Subtypen A bis I sowie O, und den Stamm HIV-2. Während HIV-1 inzwischen weltweit verbreitet ist, kommt HIV-2 hauptsächlich in Westafrika vor. Beide Typen ähneln sich hinsichtlich des klinischen Infektionsverlaufs und der krankmachenden Eigenschaften und sehen unter dem Elektronenmikroskop gleich aus. Sie unterscheiden sich jedoch im Molekulargewicht der Proteine und in der Anordnung der Gene.
In Deutschland leben rund 45.000 Menschen mit HIV, darunter etwa 34.000 Männer, rund 10.500 Frauen und zirka 400 Kinder. Jedes Jahr kommt es gegenwärtig zu durchschnittlich 2.400 Neuinfektionen. In Österreich infizierten sich im Jahr 2005 insgesamt 453 Menschen mit HIV.
Dieser Artikel beschreibt das HIV und seine Eigenschaften. Ausführliches zum Aids (Symptome, Untersuchung, Verlauf, Therapie, Vorbeugung etc.) ist im Artikel Aids zu finden.
Struktur und Aufbau des HI-Virus: Das HIV ist ein kugelförmiges Retrovirus und gehört zur Familie der Lentiviren. Infektionen mit Lentiviren verlaufen meist chronisch, mit langer klinischer Latenzzeit und unter Beteiligung des Nervensystems.
Das Viruspartikel hat einen Durchmesser von etwa 100 nm und ist von einer Lipoproteinhülle umgeben. Eingebettet in diese Hülle sind 72 etwa 10 nm große env-Glykoproteinkomplexe, die aus einem externen Anteil (gp120) und einem Transmembranprotein (gp41) bestehen. Gp120 ist für die Bindung des Virus an die CD4-Rezeptoren der Zielzellen von entscheidender Bedeutung. Da die Hülle des HI-Virus aus der Membran der Wirtszelle entsteht, befinden sich in ihr ebenfalls verschiedene Proteine der Wirtszelle, z. B. HLA Klasse I und II Moleküle sowie Adhäsionsproteine. Die HIV-RNA liegt in zwei Kopien im Viruskapsid vor. Hier befinden sich die für die Vermehrung notwendigen Enzyme reverse Transkriptase (RT), Integrase und Protease.
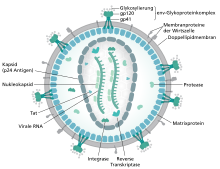

Das Genom des HI-Virus ist deutlich komplexer als das anderer Retroviren. Neben den drei üblichen retroviralen Genen (gag, pol, env) besitzt das HI-Virus sechs zusätzliche (akzessorische) Gene (vif, vpu, vpr, tat, rev, nef), die hauptsächlich regulatorische Funktionen besitzen.
Übertragung: Das HI-Virus wird mit den Körperflüssigkeiten Blut, Sperma, Vaginalsekret, Liquor und Muttermilch übertragen. Potentielle Eintrittspforten sind frische, noch blutende Wunden in Schleimhäuten (Bindehaut, Mund-, Nasen-, Vaginal- und Analschleimhaut) bzw. nicht ausreichend verhornte, leicht verletzliche Stellen der Außenhaut (Eichel, Innenseite der Vorhaut). Als häufigste Infektionswege sind zu nennen der Vaginal- oder Analverkehr ohne Verwendung von Kondomen, dann auch der Oralverkehr und die Benutzung unsteriler Spritzen beim intravenösen Drogenkonsum. Insbesondere homosexuelle Männer gelten als Risikogruppe, da häufige Partnerwechsel und Analverkehr in der Szene weit verbreitet sind. Wie hoch das Risiko beim Geschlechtsverkehr ist, hängt vor allem von der Viruslast in der Samenflüssigkeit, im Scheidensekret und im Blut ab. Diese ist unmittelbar nach der Infektion, bevor sich Antikörper gebildet haben, besonders hoch, nimmt dann aber zunächst ab und steigt in späten Stadien der Erkrankung wieder an.
Bluttransfusionen sind ebenfalls eine mögliche Infektionsquelle, die allerdings heute in Deutschland durch die 1985 eingeführten Routine-Untersuchungen der Blutspender kaum noch Bedeutung hat. Aber auch hier ist ein Risiko vorhanden, da zwischen Ansteckung des Spenders und der Nachweisbarkeit im HIV-Test bis zu drei Monate verstreichen können.
Das Risiko einer Infektion eines Kindes durch eine HIV-infizierte Mutter während der Schwangerschaft oder während der Geburt wird auf 15 bis 30 Prozent geschätzt. Bei bekannter HIV-Infektion der Mutter kann das Risiko einer Übertragung auf das Kind durch die Gabe antiretroviraler Medikamente und die Geburt durch Kaiserschnitt auf ca. 2 % vermindert werden. Eine Übertragung des Virus beim Stillen ist ebenfalls möglich.
Die sogenannte CHAT-Survey-Studie[1] des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheitswesen (BAG) - eine Nachbefragung von Menschen, die im Verlauf eines Jahres positive HIV-Tests erhielten - ergab, dass 49% aller Neuinfizierten die Infektion von ihrem festen Sexualpartner erhielten; 38% wurden von einem zwar bekannten, aber nicht festen Gelegenheitspartner infiziert. Die große Mehrheit der neuinfizierten Leute wusste schon vorher, dass ihr Partner HIV-positiv sei. Nur 13 Prozent der Heterosexuellen steckten sich bei anonymen sexuellen Begegnungen an. Bei Homosexuellen spielen bei Infektionen die festen Partner eine kleinere Rolle; anonyme Sexualkontakte machten 26% der Infektionen aus.[2]
Das Risiko, sich durch Zungenküsse anzustecken, kann ausgeschlossen werden, sofern keine blutenden Wunden, so beispielsweise Verletzungen des Zahnfleisches, im Mund vorhanden sind. Die HIV-Konzentration in Tränen, Schweiß und Speichel reicht für eine Ansteckung nach heutigem Erkenntnisstand ebenfalls nicht aus. Außerdem lässt die Aids-Epidemiologie eine Infektion durch Insektenstiche oder durch Tröpfcheninfektion äußerst unwahrscheinlich erscheinen.
Menschen, die einer akuten Ansteckungsgefahr ausgesetzt waren, sollten möglichst bald (idealerweise innerhalb von zwei Stunden!) einen Arzt aufsuchen, um sich beraten zu lassen und gegebenenfalls eine Postexpositionelle Prophylaxe (PEP) durchzuführen. Nach Ablauf von 72 Stunden wird eine medikamentöse PEP nicht mehr als sinnvoll erachtet.
Hinsichtlich der Infektionswahrscheinlichkeiten siehe ausführlich unter AIDS
Vermehrungszyklus des HIV: Zur Vermehrung benötigt das Virus Wirtszellen, die den CD4-Rezeptor auf der Oberfläche tragen. Dies sind vor allem die CD4-tragenden T-Lymphozyten (T4-Zellen), die beim Menschen für die so genannte zelluläre Immunabwehr zuständig sind und die Antikörperbildung unterstützen. Neben T-Lymphozyten besitzen auch Monozyten, Makrophagen und dendritische Zellen CD4-Rezeptoren.
Fusion mit der Wirtszelle
Um mit der Wirtszelle verschmelzen zu können, binden die Oberflächenproteine GP120 an die CD4-Rezeptoren. Durch die Bindung kommt es zu einer Konformationsänderung im Transmembranprotein GP41, ein Mechanismus, der einer „Schnappfeder“ oder einer „Mausefalle“ ähnelt. Der neu entwickelte Wirkstoff T20 ist ein Peptid, das die Konformationsänderung blockiert und somit die Anheftung des Virus erschwert (siehe unten).
Neben den CD4-Rezeptoren sind weitere Co-Rezeptoren an der Bindung des HI-Virus an die Zelle beteiligt. Der Chemokin-Rezeptor CCR5 an monozytären Zellen und CXCR4 Rezeptoren an T-Zellen ist an der Bindung beteiligt. Die unterschiedliche Ausprägung dieser Rezeptoren beeinflusst den Verlauf der HI-Infektion und die Ansteckungswahrscheinlichkeit. Moleküle, die die CCR5 Rezeptoren blockieren sollen, werden zurzeit getestet. Da die Bedeutung dieser Rezeptoren für den Organismus jedoch noch nicht genau geklärt ist, ist es bis zur Marktreife noch ein weiter Weg. Wichtig ist zu erwähnen, dass das HI-Virus innerhalb der ersten Monate nach der Infektion in der Regel (nach einer kurzen Anfangsphase mit CXCR4-Tropismus) eine außerordentliche Bevorzugung von Zellen mit dem CCR5-Korezeptor zeigt. Dies führt zu einer überwiegenden Infektion von Zellen des monozytären/makrophagozytären Systems und weniger der sog. T-Helferzellen. Mit Hilfe der monozytären Zellen gelangt das Virus in für die antiretrovirale Therapie später schwer zugängliche Kompartimente des Körpers, wie z.B. die Hoden und das Gehirn. Bedeutsam wird das auch hinsichtlich der schweren Hirnschäden, die das Virus bei einem Teil der Infizierten schon früh verursachen kann.
PMID 8649511 PMID 8674120 PMID 8649512 PMID 8629022 PMID 9108481 PMID 8791690 PMID 9430590 PMID 9334379 PMID 9334378 PMID 9634238
Einbau des HI-Virus-Genoms in die Wirtszelle
Das HIV baut zur Vermehrung sein RNA-Genom nach der so genannten reversen Transkription in doppelsträngige DNA in das Genom der Wirtszelle ein. Die Umwandlung von viraler RNA in provirale DNA im Cytoplasma der Wirtszelle durch das Enzym Reverse Transkriptase ist ein entscheidender Schritt im Reproduktionszyklus der Retroviren. Dieser Vorgang kommt ansonsten nicht in menschlichen Zellen vor. Daher ist das Enzym Reverse Transkriptase ein wichtiges Ziel therapeutischer Intervention und Ansatzpunkt zweier pharmakologischer Wirkstoffklassen. Nach reverser Transkription schließt sich die Integration des Virus-Genoms in das menschliche Erbgut durch ein weiteres virales Enzym, die Integrase, an. In neueren Arbeiten wurde gezeigt, dass die virale DNA schon vor der Integration abgelesen wird und virale Proteine gebildet werden. Demnach liegt die HIV-DNA als integrierte und nicht-integrierte Form vor. Auch existieren zirkuläre Formen von HIV-DNA. Als erste virale Proteine wurden der virale Transaktivator Tat und das Nef-Protein nachgewiesen. Nef ist essentiell, um T-Zellen produktiv infizieren zu können, während Tat die virale Transkription reguliert. Die Synthese viraler Proteine wird durch alternatives Spleißen und die virale Kontrolle des RNA-Exports durch das Rev-Protein moduliert.
Das Virus in infizierten und ruhenden CD4-positiven T-Zellen entzieht sich dem Angriff durch antivirale Medikamente und dem Immunsystem. Zu einer Aktivierung dieser Immunzellen kommt es nach Antigenkontakt, zum Beispiel im Rahmen gewöhnlicher oder einer opportunistischen Infektion. Während die Zelle gegen einen anderen Krankheitserreger vorgehen will, beginnt sie Virusproteine zu produzieren und neue Viren freizusetzen. Diese infizieren dann wiederum andere Zellen.
Was das HI-Virus so außergewöhnlich überlebensfähig macht, ist seine Wandlungsfähigkeit oder, besser gesagt, seine schnelle Evolutionsrate. Von den Influenza-Viren (Grippe) zum Beispiel entwickeln sich in derselben Zeit auf der ganzen Welt nicht einmal halb so viele neue Unterarten wie vom HI-Virus in einem einzelnen Infizierten.
Die lange Inkubationszeit von zehn Jahren ist ein Problem, da viele Infizierte unter Umständen noch jahrelang andere Personen infizieren, bevor ihre Infektion erkannt oder von ihnen selbst bemerkt wird.

Verlauf der HIV-Infektion
Eine unbehandelte HIV-Infektion verläuft in der Regel in mehreren Stadien. 3 bis 6 Wochen nach der Ansteckung kommt es meist zu einer akuten HIV-Infektion. Diese ist durch Fieber, Abgeschlagenheit, Hautausschläge, orale Ulzerationen, oder Arthralgie gekennzeichnet. Wegen der Ähnlichkeit mit grippalen Infektionen bleibt die akute HIV-Infektion meistens unerkannt. Eine frühe Diagnose ist jedoch wichtig. Durch sie können nicht nur weitere Infektionen von Sexualpartnern verhindert werden. Erste Studien an Patienten, die während der akuten HIV-Infektion antiviral behandelt wurden und nach einiger Zeit die Therapie absetzten, zeigten, dass die HIV-spezifische Immunantwort der Patienten gestärkt werden konnte. Die akute Infektion dauert selten mehr als 4 Wochen an.[3] PMID 11029005 PMID 11148221
In der folgenden, meist mehrjährigen Latenzphase treten keine körperlichen Symptome auf. Danach kommt es vielfach zu ersten Erkrankungen, die auf ein mittelschwer geschwächtes Immunsystem zurückzuführen sind, jedoch noch nicht als Aids-definierend gelten (CDC Klassifikation B, siehe Aids). Im Median nach 8 bis 10 Jahren nach der Erstinfektion kommt es zu einem schweren Immundefekt (< 200 CD4-Zellen/Mikroliter). Dieser führt in der Regel zu Aids-definierenden Erkrankungen (CDC Klassifikation C, siehe Aids). Zu diesen zählen opportunistische Infektionen, die durch Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten bedingt sind, sowie andere Erkrankungen, wie Kaposi-Sarkom, malignes Lymphom, HIV-Enzephalopathie und das Wasting-Syndrom. Nach individuell unterschiedlicher Zeit führen diese unbehandelt meist zum Tod. Ein schwerer Immundefekt bedeutet jedoch nicht, dass sofort Aids auftritt. Je länger ein schwerer Immundefekt vorliegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, Aids zu bekommen.



HIV-Enzephalopathie: Unter HIV-Enzephalopathie (kurz HIVE) versteht man eine durch das HIV hervorgerufene Gehirnschädigung. Sie tritt nur bei einem Teil der Aids-Kranken auf. Das HIV befällt dabei die im Gehirn befindlichen Fresszellen. Obwohl die Nervenzellen nicht direkt vom HIV befallen sind, kommt es trotzdem zu Nervenzellschäden. Man erklärt sich diese indirekte Schädigung durch den Einfluss der infizierten Fresszellen der Umgebung. Das Auftreten der HIVE bei Aids-Kranken ist seit Einführung der HAART (siehe Therapie) deutlich rückläufig.
Symptome der HIVE:
- Denkstörungen (Gedächtnis-, Konzentrations-, Sprachstörungen)
- Störungen der Bewegungskontrolle (Verlangsamung, Koordinationsstörungen, Gangunsicherheit)
- Verhaltensänderung (Apathie, Libidoverlust, sozialer Rückzug)
Bei schweren Verläufen kann sich eine Demenz entwickeln.
Von der HIVE abzugrenzen sind Gehirnschäden, die als Folge von Medikamentennebenwirkungen, Infektionen oder Lymphomen auftreten.
Genetische Faktoren: Die Tatsache, dass Individuen trotz gleicher Infektionsquelle oft sehr unterschiedliche Krankheitsverläufe haben, deutet auf einen starken Einfluss von Wirtsfaktoren auf den Verlauf der Infektion hin. Neben der Ausbildung des Immunsystems scheinen auch einige genetische Faktoren eine Rolle zu spielen. So sind homozygote Individuen mit einem genetischen Defekt am CCR5-Rezeptor (CCR5delta32) weitgehend resistent gegen HIV-Infektionen. Dieser Rezeptor dient als Co-Rezeptor bei der Fusion des Virus mit der Wirtszelle. Es wurden nur wenige Individuen gefunden, die eine Infektion trotz Rezeptordefektes haben. Sie infizierten sich mit HI-Viren, die andere Co-Rezeptoren benutzen, wie den CXCR4 Rezeptoren an T-Zellen. Homozygote Genträger dieser Deletion machen ca. 1 % der Bevölkerung aus, heterozygote Genträger etwa 20 %. Heterozygote haben deutlich weniger CCR5 Rezeptoren und scheinen nach Infektion kaum eine längere mittlere Überlebenszeit zu haben.
Der Aids-Forscher J.J. Bouyao hat in Nairobi (Kenia) 600 Prostituierte untersucht und dabei festgestellt, dass 24 von ihnen offenbar gegen das HI-Virus immun sind. Der Grund dafür scheint nach Ansicht von Forschern genetisch bedingt zu sein. Offenbar ist eine Gen-Anomalie dafür verantwortlich, der das Virus daran hindert, in die Zellen einzudringen und sich zu verbreiten.
Geschichte: HIV ist die vom International Committee on Taxonomy of Viruses 1986 empfohlene Bezeichnung, die frühere Benennungen wie Lymphadenopathie-assoziiertes Virus (LAV), humanes T-Zell-Leukämie-Virus III (HTLV III) oder Aids-assoziiertes Retrovirus (ARV) ersetzt. HIV Typ 1 wurde 1983 zum ersten Mal von Robert Gallo, dem Leiter des Tumorvirus-Labors am NIH und Luc Montagnier, dem Direktor des Institut Pasteur in Paris beschrieben. Da beide die Erstentdeckung für sich beanspruchen, folgte ein jahrelanger Rechtsstreit, bei dem es auch um das Patent für den neu entwickelten HIV-Test ging. HIV-2 wurde 1986 entdeckt. Die älteste gesicherte HIV-Infektion stammt aus Zaire 1959.
Im Mai 2005 gelang der Nachweis, dass der Aidserreger HIV von wilden Schimpansen im frühen 20. Jahrhundert in Kamerun (Afrika), auf den Menschen übertragen wurde. Das internationale Forscherteam hatte dazu in der Wildnis Kameruns 446 Kotproben freilebender Schimpansen gesammelt. Etliche enthielten SIV-Antikörper, die Schimpansenversion des HI-Virus, wie sie im US-Fachjournal "Science" veröffentlichten. Ursprüngliche Quelle des HI-Virus sind die Schimpansen jedoch nicht. Sie sollen sich im westlichen Zentralafrika mit SIV oder einem Vorläufer dieses Virus infiziert haben. Damit hat der Aidserreger bereits mindestens zweimal die Artengrenze übersprungen, nämlich vom Affen zum Menschenaffen und anschließend zum Menschen.
HIV-Infektion und AIDS
Die Abkürzung Aids (auch AIDS) steht für Acquired Immune Deficiency Syndrome (englisch für erworbenes Immundefektsyndrom). Aids ist eine Immunschwächekrankheit und die Folge einer Infektion mit dem HI-Virus(HIV), das eine allmähliche Zerstörung des Immunsystems bewirkt. Die Folge sind Sekundärinfektionen (auch opportunistische Infektionen genannt) und Tumore, die in bestimmter Kombination das Syndrom Aids definieren. Trotz Behandlung führen diese Folgeerkrankungen früher oder später zum Tod. Zur Diagnose werden Antikörper oder Virusbestandteile im Blut gesucht. Bereits vor dem Eintreten von Symptomen kommen virenhemmende Medikamente zum Einsatz, die zusammen mit der Behandlung der Sekundärinfektionen die Lebenserwartung verlängern und die Lebensqualität steigern.
Ansteckung: Das HI-Virus wird mit den Körperflüssigkeiten Blut, Sperma, Vaginalsekret, Liquor und Muttermilch übertragen. Potentielle Eintrittspforten sind frische, noch blutende Wunden in Schleimhäuten (Bindehaut, Mund-, Nasen-, Vaginal- und Analschleimhaut) bzw. nicht ausreichend verhornte, leicht verletzliche Stellen der Außenhaut (Eichel, Innenseite der Vorhaut). Als häufigste Infektionswege sind zu nennen der Vaginal- oder Analverkehr ohne Verwendung von Kondomen, dann auch der aufnehmende Oralverkehr (Schleimhautkontakt mit Sperma bzw. Menstruationsblut; bei unverletzter Mundschleimhaut stellt der Kontakt mit Präejakulat oder Vaginalsekret ein vernachlässigbares Infektionsrisiko dar, ebenso der passive Oralverkehr) und die Benutzung (ausgeliehener) kontaminierter Spritzen beim intravenösen Drogenkonsum. Homosexuelle Männer gelten als Risikogruppe, da häufige Partnerwechsel und Analverkehr in der Szene weit verbreitet sind. Wie hoch das Risiko beim Geschlechtsverkehr ist, hängt vor allem von der Viruslast in der Samenflüssigkeit, im Scheidensekret und im Blut ab. Diese ist unmittelbar nach der Infektion, bevor sich Antikörper gebildet haben, besonders hoch, nimmt dann aber zunächst ab und steigt in späten Stadien der Erkrankung wieder an.
Bluttransfusionen sind ebenfalls eine mögliche Infektionsquelle, die allerdings heute in Deutschland durch die 1985 eingeführten Routine-Untersuchungen der Blutspender kaum noch Bedeutung hat. Aber auch hier ist ein Restrisiko vorhanden, da zwischen Ansteckung des Spenders und der Nachweisbarkeit im HIV-Test bis zu drei Monate verstreichen können.
Das Risiko einer Infektion eines Kindes durch eine HIV-infizierte Mutter während der Schwangerschaft oder während der Geburt wird auf 15% bis 30% geschätzt. Bei bekannter HIV-Infektion der Mutter kann das Risiko einer Übertragung auf das Kind durch die Gabe antiretroviraler Medikamente und die Geburt durch Kaiserschnitt auf ca. 2% vermindert werden. Eine Übertragung des Virus beim Stillen ist ebenfalls möglich.
Das Risiko, sich durch Zungenküsse anzustecken, kann ausgeschlossen werden, sofern keine blutenden Wunden, so beispielsweise Verletzungen des Zahnfleisches, im Mund vorhanden sind. Die HIV-Konzentration in Tränen, Schweiß und Speichel reicht für eine Ansteckung nach heutigem Erkenntnisstand ebenfalls nicht aus. Außerdem lässt die Aids-Epidemiologie eine Infektion durch Insektenstiche oder durch Tröpfcheninfektion äußerst unwahrscheinlich erscheinen. Menschen, die einer akuten Ansteckungsgefahr ausgesetzt waren, sollten möglichst bald (idealerweise innerhalb von zwei Stunden) einen Arzt aufsuchen, um sich beraten zu lassen und gegebenenfalls eine Postexpositionelle Prophylaxe (PEP) durchzuführen. Nach Ablauf von 48 Stunden wird eine medikamentöse PEP nicht mehr als sinnvoll erachtet.
PMID 6132270 PMID 6133990 PMID 7491134
Ansteckungswahrscheinlichkeit: Die Infektionswahrscheinlichkeit liegt bei den meisten Übertragungswegen zwischen 1:100 und 1:1000. Wichtigste Ausnahme ist die Übertragung von der Mutter auf das Kind während der Geburt mit einer Infektionswahrscheinlichkeit von ca. 15 % und durch eine verseuchte Bluttransfusion, wo das Infektionsrisiko 95 % beträgt.
Die folgenden Häufigkeiten sind Durchschnittswerte, die durch Partnerstudien und epidemiologische Studien ermittelt wurden. Das individuelle Risiko kann sehr viel höher sein. So erhöht eine gleichzeitig vorliegende andere Geschlechtserkrankung das Infektionsrisiko um das 5- bis 10-fache, eine hohe Viruslast des Überträgers sogar um das 10- bis 30-fache. Geschlechtsverkehr während der Regelblutung der Frau ist mit einem erhöhten Infektionsrisiko für beide Partner verbunden, beschnittene Männer haben ein geringeres Infektionsrisiko. Insgesamt scheint das Infektionsrisiko nicht konstant über die Anzahl der Kontakte zu sein, so dass das Risiko einzelner Kontakte womöglich erheblich zu niedrig angegeben ist. Mit besseren Medikamenten sinkt möglicherweise das Übertragungsrisiko.
- Ungeschützter vaginaler Geschlechtsverkehr mit einem HIV-positiven Partner ist mit einem Risiko einer HIV-Infektion von ca. 0,05 - 0,15 % für die Frau, und zwischen 0,03 - 5,6 % für Männer verbunden, tendenziell jedoch für Männer etwas geringer als für Frauen.
- Das Infektionsrisiko für Oralverkehr beim Mann (Fellatio), bei dem Sperma in den Mund aufgenommen wird, ist geringer, eine Infektion ist jedoch nicht ausgeschlossen. Eine Infektion durch Vorflüssigkeit ("Lusttropfen") ist sehr unwahrscheinlich. Bei Oralverkehr bei der Frau (Cunnilingus) wird das Risiko ebenfalls als geringer als beim vaginalen Geschlechtsverkehr angesehen. Auch das Risiko beim sogenannten Rimming wird als äußerst gering eingeschätzt.
- Bei Analverkehr treten häufig kleine Risse an der Schleimhaut auf. Dementsprechend liegt das Risiko für den passiven Teilnehmer beim Analverkehr um 0,8 % und um 0,3 % für den aktiven Teilnehmer.
- Andere Sexualpraktiken, bei denen kein Kontakt zu Schleimhäuten, Blut, Sperma oder Vaginalsekret besteht, haben ein extrem geringes Infektionsrisiko.
- Das Infektionsrisiko durch Nadelstiche hängt sehr von der Situation ab. Das Infektionsrisiko wird durchschnittlich mit 0,3 % angegeben und steigt mit folgenden Faktoren: sehr tiefe Verletzungen (16-fach erhöht), sichtbare Blutspuren auf der Nadel oder Nadel war vorher in einer Vene oder Arterie des Überträgers (jeweils 5-fach erhöht), bei hoher Viruslast des Überträgers (6-fach erhöht). Das Risiko bei Hohlnadeln ist höher als bei geschlossenen Nadeln.
- Das Risiko, sich bei gemeinsamer Benutzung einer Kanüle, meist beim Spritzen von Heroin, zu infizieren, liegt um 0,7 % und sinkt mit dem zeitlichen Abstand zwischen den Injektionen, allerdings nur langsam, da in der Kanüle eingeschlossene Viren lange infektiös bleiben können, teilweise auch noch nach Tagen. Ein Auskochen der Nadeln ist zwar generell möglich, wenn es lange genug durchgeführt wird, allerdings sind handelsübliche Nadeln nicht dafür geeignet, weil die verwendeten Kunststoffe nicht entsprechend hitzefest sind. Eine chemische Desinfektion (Alkohol oder andere Desinfektionsmittel) ist nicht ausreichend, weil nicht gewährleistet ist, dass die Substanzen ganz in die Kanüle eindringen.
Teilweise besteht die Möglichkeit einer Postexpositionsprophylaxe. Diese besteht aus allgemeinen Maßnahmen (Waschen des Penis nach dem Verkehr, Ausdrücken der Stichwunden und Behandlung mit Desinfektionsmittel) und spezifischen Maßnahmen wie der Gabe von antiretroviralen Medikamenten. Nach einem Ansteckungsverdacht sollte immer sofort ein Arzt aufgesucht werden, der über mögliche Maßnahmen informiert und sie auch einleiten kann.
PMID 1403641, PMID 10430236, PMID 8601226, PMID 15090833, PMID 9091805
HIV-Test: Der Begriff HIV-Test steht für den HIV-Antikörper-Test, der die An- oder Abwesenheit von Antikörpern gegen HIV-Proteine, nicht jedoch das HI-Virus selbst nachweist. Wie gegen andere als "körperfremd" erkannte Eiweißmoleküle bildet das Immunsystem Antikörper, um sich vor eingedrungenen HI-Viren zu schützen. Sind Antikörper vorhanden, ist der Test "HIV-positiv", d. h. es hat ein Kontakt mit dem HI-Virus stattgefunden. Werden keine Antikörper nachgewiesen, lautet das Resultat des Testes "HIV-negativ". Ein Problem beim HIV-Antikörper-Test ist die diagnostische Lücke: In der Zeit, die der Körper braucht, um die ersten Antikörper zu bilden, können solche auch nicht nachgewiesen werden und führen somit zu einem "falsch-negativen" Ergebnis.
Die heute üblichen Tests können in der Regel zwölf Wochen nach der Ansteckung zuverlässig Antikörper nachweisen; 99 % der Infizierten weisen dann bereits Antikörper auf. In den meisten Fällen ist ein Kontakt mit HI-Viren bereits nach drei bis sechs Wochen feststellbar. In seltenen Fällen können aber noch Monate später falsche, auch negative Ergebnisse entstehen. Grundsätzlich gilt: Je länger der Zeitraum zwischen möglicher Ansteckung und Test, um so größer ist seine Aussagekraft.
In Deutschland wird die Diagnose "HIV-positiv" durch zwei Tests gestellt: einen Suchtest und einen Bestätigungstest.
Als Suchtest wird meist ein kostengünstiger HIV-Elisa-Test durchgeführt. Dieser weist Antikörper gegen HIV-1, HIV-2 und HIV-1 Subtyp 0 im Blut nach. Für diesen Test werden von kommerziellen Herstellern Virusproteine in so genannten Elisa-Testplatten vertrieben. Eine Testplatte besteht aus bis zu 96 kleinen Näpfen, in denen die HIV-Proteine auf dem Trägermaterial fixiert wurden.
Von der zu testenden Blutprobe werden die Blutzellen abgetrennt und die verbleibende gelblich-klare Flüssigkeit, das so genannte Serum, in eines der Näpfchen der Testplatte gegeben. Wenn Antikörper im Serum vorliegen, die vom Immunsystem eines HIV-Infizierten gebildet wurden, heften diese sich an die HIV-Proteine. Nach weiteren Arbeitsschritten verbleibt in den Näpfen von HIV-negativen Personen eine glasklare Flüssigkeit und bei HIV-infizierten Menschen eine gefärbte Flüssigkeit. Der Test wird maschinell und immer im Vergleich zu HIV-positiven und HIV-negativen standardisierten Seren abgelesen.
Der HIV-Suchtest ist auch in großen klinisch-chemischen Laborautomaten durchführbar. Es wird dann ein etwas abweichendes Verfahren eingesetzt, der Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA). Aussagekraft und Beschränkungen sind aber dem ELISA vergleichbar.
Die Empfindlichkeit des Suchtests ist sehr hoch eingestellt, damit auch 'grenzwertig-positive' Seren entdeckt werden. Jedes im Suchtest als positiv oder grenzwertig aufgefallene Serum muss in einem Bestätigungstest überprüft werden.
Als routinemäßiger Bestätigungstest dient die aufwändigere Western-Blot-Methode (syn: Immunoblot), ebenfalls ein Antikörpertest. Hierzu wird eine Reihe unterschiedlicher HIV-Proteine auf einen Teststreifen als Trägermaterial nebeneinander aufgebracht. Der Streifen wird in eine weitere Serumprobe eingelegt. Wenn Antikörper gegen HIV vorhanden sind, heften sich diese an die Virusproteine. Nach weiteren Arbeitsschritten werden dunkle Striche auf dem Teststreifen sichtbar. Sie zeigen an, gegen welche Virusproteine der Mensch Antikörper gebildet hat. Nach WHO-Empfehlung wird die Diagnose 'HIV-positiv' auf Grund von Antikörpern gegen zwei verschiedene Virusproteine gestellt. Auf diese Weise wird der zuvor positive oder grenzwertige Suchtest widerlegt oder bestätigt.
Die Sensitivität des HIV-Test wird mit 99,9 % angegeben. Dies bedeutet, dass von 1000 HIV-positiven Patienten 999 als solche erkannt werden und einer ein falsch-negatives Ergebnis erhält. Die Spezifität beträgt 99,8 %. Dies bedeutet, dass von 1000 nicht HIV-Positiven 998 ein negatives Ergebnis erhalten und 2 ein falsch-positives Ergebnis . Der positive prädiktive Wert, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit positivem Test wirklich infiiziert ist, hängt von der Prävalenz in der getesteten Gruppe ab und kann somit nicht allgemein angegeben werden. Bei niedriger Prävalenz, wie z. B. bei Personen ohne Risikofaktoren liegt er deutlich unter der Spezifität, bei unter 50%. Liegen hingegen Risikofaktoren vor, steigt der Wert schnell an und erreicht Werte nahe der Spezifität. (zur Bewertung eines Testergebnisses siehe auch: Beurteilung eines Klassifikators).
Direkt nachgewiesen werden HI-Viren bzw. die Virus-RNA durch das vergleichsweise kostenintensive RT-PCR-Verfahren. Diese Methode wird meist nach gestellter Diagnose zur Bestimmung der Viruslast angewandt.
Bei Neugeborenen hat ein Antikörper-Test keine Aussagekraft, da die Antikörper der Mutter durch die Plazenta in das Blut des Kindes gehen, und daher ein falsch positives Testergebnis entsteht. Daher ist die gängige Untersuchungsmethode bei Neugeborenen und Säuglingen die RT-PCR.
Zur Diagnostik einer akuten HIV Infektion dient ein positiver HIV-RNA Test durch eine RT-PCR und ein negativer oder "grenzwertiger" Bestätigungstest.
Der umgangssprachlich sogenannte "Aidstest" meint den HIV-Antikörper-Test. Dies ist ein kostengünstiger Suchtest, basierend auf einem Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) oder Elektrochemiluminiszenz-Immunoassay (ECLIA), und eignet sich daher für regelmäßige Untersuchung gefährdeter Personen. Dieser Test weist nicht das Virus selbst, sondern nur die Antikörper im Blut nach und ist frühestens zwölf Wochen nach einem eventuellen Risikoereignis sinnvoll, weil der Organismus bis zu zwölf Wochen braucht um Antikörper in einer Menge zu bilden, die einen sicheren Nachweis erlaubt; 0,01 % der Menschen, die den HI-Virus tragen, benötigen bis zu 6 Monate zur Bildung der ausreichenden Menge Antikörper. Der Test hat eine hohe Sensitivität, d. h. sollten Antikörper vorhanden sein, werden diese auch erkannt. Allerdings sind mit keinem dieser Tests die erkannten Antikörper eindeutig einer HIV-Infektion zuzuweisen. Nach einem "reaktiven" Testergebnis ist grundsätzlich ein so genannter Bestätigungstest durchzuführen.
Zur Sicherung der Diagnose und genaueren Untersuchung der vorhandenen Virusstämme dienen umfassende weiterführende Tests, die nicht nur HIV-Antikörper, sondern das HI Virus selbst nachweisen können. So dient ein Nachweis proviraler HIV-DNA der Sicherung der Diagnose, während sich anhand der HIV-RNA die Virus-"Menge" messen lässt. Mittlerweile werden zunehmend auch solche Nachweismethoden zum diagnostischen Standard, welche Resistenzen in den Virusstämmen gegen antiretrovirale Therapien anzeigen.
Schwierigkeiten bereitet die Diagnose bei Neugeborenen, da die nachgewiesenen Anti-HIV-Antikörper der Klasse IgG üblicherweise von der infizierten Mutter stammen. Kommerziell erhältliche Tests zum Nachweis von IgM- oder IgA-Antikörpern, welche vom Kind gebildet werden, sind noch nicht vorhanden. Somit lässt sich bei positiver Antikörper-Suchreaktion aber negativem Test auf HIV-DNA oder -RNA kein klarer Status erschließen.
Meldepflicht: In Deutschland wird dem feststellenden Arzt im Rahmen der Laborberichtspflicht empfohlen, eine HIV-Infektion anonymisiert dem Robert-Koch-Institut in Berlin zu melden. Eine HIV-Infektion ist in Österreich, im Gegensatz zur Aidserkrankung, nicht meldepflichtig. Diese erfolgt an das Ministerium in anonymisierter Form.
Definition und Klassifikation des AIDS: HIV-Erkrankungen werden in der Regel nach der CDC-Klassifikation eingeteilt, die von den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention erstellt und zuletzt 1993 überarbeitet wurde. Die Einteilung basiert auf drei verschiedenen Kategorien, die sich aus dem klinischen Bild ergeben (A-C) und der Einteilung des CD4-T-Helferzellstatus (1-3).
Kategorie A bezeichnet eine asymptomatische HIV-Infektion.
Unter Kategorie B werden Krankheiten zusammengefasst, die nicht als Aids definierend gelten, aber im Zusammenhang mit einem Immundefizit zu stehen scheinen. Zu diesen gehören:
- bazilläre Angiomatosen,
- Entzündungen des kleinen Beckens, besonders bei Komplikationen eines Tuben- oder Ovarialabszesses,
- ausgedehnter oder rezidivierender Herpes zoster,
- thrombozytopene Purpura,
- lang anhaltendes Fieber oder Diarrhoen, die länger als einen Monat anhalten,
- Listeriose,
- orale Haarleukoplakie,
- oropharyngeale Candidosen,
- chronische oder schwer zu therapierende vaginale Candidosen,
- zervikale Dysplasien,
- Carcinoma in situ und
- periphere Neuropathie.
Kategorie C umfasst die Aids definierenden Erkrankungen. Es handelt sich um meist opportunistische oder maligne Erkrankungen, die bei einem gesunden Immunsystem nicht oder nicht in der beschriebenen Weise auftreten. Zu ihnen gehören:
- Candidosen der Atemwege oder der Speiseröhre,
- Cytomegalievirus-Infektionen (außer Leber, Milz und Lymphknoten),
- CMV-Retinitis (mit Einschränkung der Sehschärfe),
- HIV-bedingte Enzephalopathie,
- Herpes simplex mit chronischen Ulzera (>1 Monat) oder durch Herpes simplex bedingte Bronchitis,
- Pneumonie oder Ösophagitis,
- Histoplasmose, chronisch,
- intestinale Isosporiasis,
- Kaposi-Sarkom,
- disseminierte oder extrapulmonale Kokzidiomykose,
- extrapulmonale Kryptokokkose,
- chronisch intestinale Kryptosporidiose,
- immunoblastisches, primär zerebrales oder Burkitt Lymphom,
- extrapulmonale Mykobakterien,
- Pneumocystis-Pneumonie,
- rezidivierende bakterielle Pneumonien (länger als 1/Jahr),
- progressive multifokale Leukenzephalopathie,
- rezidivierende Salmonellen-Septikämie,
- Tuberkulose,
- zerebrale Toxoplasmose,
- Wasting-Syndrom,
- invasives Zervixkarzinom
Die CDC-Klassifikation der Laborkategorien beschreibt die noch vorhandene Anzahl von CD4-Zellen. Kategorie 1 entspricht mehr als 500 CD4-Zellen/pl, Kategorie 2 200 bis 400 und Kategorie 3 unter 200 CD4 Zellen/pl.
Zur Einstufung werden beide Werte herangezogen. Die Erkrankung eines Patienten mit einer oropharyngealen Candidose und mit einem CD4 Zellwert von 300 wird also mit B2 beschrieben. Eine Rückstufung bei Besserung des klinischen Bildes oder des CD4 Zellwertes wird nicht vorgenommen.
In Deutschland wird die Diagnose Aids anhand des klinischen Bildes getroffen, wohingegen in den USA bei einem CD4-Zellwert von unter 200 ebenfalls von Aids gesprochen wird, auch ohne klinische Symptomatik.
Die CDC Klassifikation ist die derzeit gebräuchlichste und wahrscheinlich beste Einteilung der HIV-Erkrankung. Trotzdem weist sie einige Schwächen auf. Zum einen ist sie zuletzt 1993 neu bearbeitet worden, was eine ganze Epoche an neueren HIV-Therapiemöglichkeiten und den damit verbundenen Änderungen des klinischen Bildes nicht mit berücksichtigt. Zum anderen ist sie geprägt durch ihren Entstehungsort (USA). Einige opportunistische Erreger, die in anderen Teilen der Welt eine große Rolle spielen, wie Penicillosen in Asien, tauchen in der Klassifikation nicht auf.
Krankheitsverlauf: Eine HIV-Infektion verläuft in vier Phasen:
1. Akute Phase (4-6 Wochen): 2-6 Wochen nach einer Infektion können grippeähnliche Symptome wie Fieber, Nachtschweiß, geschwollene Lymphknoten, Übelkeit usw. auftreten. Manche Patienten bemerken diese Symptome jedoch nicht oder sie haben keine.
2. Latenzphase (meist mehrjährig): In dieser Zeit vermehrt sich das Virus im Körper. Betroffene, sofern sie von ihrer Infektion wissen, leiden allenfalls psychisch darunter, körperliche Symptome treten hingegen keine auf.
3. (A)ids (R)elated (C)omplex: Es treten die gleichen Beschwerden wie in der Akuten Phase auf. Sie gehen jedoch nicht mehr zurück.
4. Krankheitsphase: Die Diagnose "Aids" wird gestellt, wenn bei einem HIV-Positiven bestimmte Infektionen, die sogenannten Aids definierenden Erkrankungen, festgestellt werden. Diese Infektionen nennt man opportunistische Infektionen. Oft sind die Erreger solcher Infektionen für den gesunden Menschen bzw. ein gesundes Immunsystem harmlos. Durch das geschwächte bzw. vernichtete Immunsystem eines HIV-Positiven kann sich der Organismus jedoch nicht mehr gegen selbst harmlose Erreger wehren und es treten die o. g. Infektionen auf. Als Maß für die Zerstörung des Immunsystems dient die T-Helfer-Zellen-Zahl im Blut eines HIV-Infizierten. Der Standard-Grenzwert ist erreicht, wenn das T-Zell-Niveau eines Patienten unter 200–400 / µl Blut fällt. Die Unterschreitung dieser Grenze stellt eine Behandlungsindikation dar. Es existiert die Theorie, dass nicht jeder, der mit dem HI-Virus infiziert wurde, zwangsläufig Aids entwickelt. Hierzu gibt es jedoch keine gesicherten Erkenntnisse.
Therapie: Durch die Einnahme von HIV-unterdrückenden Medikamenten (sog. antiretrovirale Therapie) und die Behandlung der Sekundärinfektionen kann der Krankheitsverlauf verlangsamt werden. Eine Heilung ist jedoch derzeit nicht möglich.
Die Behandlung einer HIV-Infektion wird unter dem Begriff Antiretrovirale Therapie (ART) zusammengefasst. Da das Virus schnell gegen einzelne Medikamente Resistenzen entwickelt, hat sich die Therapie mit mehreren Medikamenten gleichzeitig durchgesetzt. Hierfür wurde der wenig medizinische Begriff der Highly Active Antiretroviral Treatment (HAART) gewählt. HAART kann das Leben HI-Infizierter deutlich verlängern. Doch es bewirkt keine Wunder: Eine vollständige Elimination (Eradikation) aller Viren und damit eine Heilung ist bisher nicht möglich. Zudem können schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten. Wenn einmal eine HAART begonnen wurde, so sollte sie nicht mehr abgesetzt werden, da dies zur Resistenzbildung führen kann. Aus dem selben Grund ist eine regelmäßige Tabletteneinnahme unumgänglich (siehe Adherence). Daraus ergibt sich eine hohe Belastung für den Patienten.
Zur Zeit werden drei Wirkstoffklassen angewendet: Nukleosid- und Nukleotidanaloga (NRTI), Nichtnukleosidische Reverse Transkriptase Inhibitoren (NNRTI) und Protease-Inhibitoren (PI). Zudem gibt es mit der Substanz T-20 eine neue Wirkstoffklasse der Fusionsinhibitoren.
Nukleosidanaloga
Nukleosidanaloga, auch Nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NRTI, umgangssprachlich "Nukes") genannt, haben ihren Ansatzpunkt am HIV-Enzym Reverse Transkriptase. Das Enzym "übersetzt" das virale RNA-Genom in doppelsträngige DNA, bevor diese von einem weiteren viralen Enzym, der Integrase, in die DNA der Wirtzelle eingebaut wird. Als alternatives Substrat konkurriert die NRTI mit den physiologischen Nukleosiden, von denen sie sich durch Modifikationen am Zuckermolekül unterscheiden. Durch ihren Einbau kommt es zum Kettenabbruch der DNA, da die NRTI die Struktur der Doppelstrangbindung behindert. Die Wirkstoffe Zidovudin (Azidothymidin, AZT) und Lamivudin (d4T) sind Thymidin-Analoga, Zalcitabin (DDC) und Lamivudin (3TC) sind Cytidin-Analoga, während Didanosin (DDI) ein Inosin und Abacavir ein Guanosin-Analogon ist. Eine Kombination von AZT und d4T bzw. DDC und 3TC ergibt wenig Sinn, da sie den selben Ansatzpunkt haben.
Zahlreiche Nebenwirkungen können bei der Therapie mit NRTI auftreten. Häufig sind Kopfschmerzen, gastrointestinale Beschwerden, Völlegefühl oder Übelkeit, Erbrechen und Diarrhoeen, sowie allgemeine Müdigkeit. Als Folge längerer Anwendung kann es zur Laktatazidose, Myelotoxizität, Polyneuropathie und Pankreatiden kommen. Auch die bei der Therapie mit Protease-Inhibitoren berüchtigte Lipodystrophie kann bei längerer Einnahme von NRTI auftreten.
Viele dieser Nebenwirkungen werden durch die "mitochondrale Toxizität" erklärt: Mitochondrien, die lebenswichtigen Kraftwerke der Zellen, benötigen ebenfalls Nukleoside. Durch den Einbau von NRTI statt Nukleosiden kommt es zu Stoffwechselstörungen und zur Degeneration der Mitochondrien. Bei der Toxizität der einzelnen Substraten gibt es erhebliche Unterschiede.
NRTI werden unverändert in die Zelle aufgenommen und dort durch Phosphorylierung aktiviert. Sie werden überwiegend renal eliminiert und haben daher wenig Wechselwirkung mit Medikamenten, die in der Leber verstoffwechselt werden.
Nicht-Nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTIs)
Während NRTIs als "falsche" Bausteine das Enzym Reverse Transkriptase hemmen, binden NNRTIs direkt an das Enzym, nahe der Substratbindungsstelle für Nukleoside. Zurzeit gibt es drei NNRTis auf dem Markt: Neverapin, Delavirdin und Efavirenz. Während Nevirapin und Efavirenz etwa gleich effektiv sind, spielt Delaviridin in der Therapie kaum eine Rolle und ist in Deutschland (noch) nicht zugelassen.
Als Einzelsubstanz zeigen NNRTIs nur eine begrenzte Wirkung, in Kombinationstherapie mit 2 NRTIs sind sie aus immunologisch-virologischer Sicht mit Proteaseinhibitoren gleichwertig. Jedoch gibt es bisher keine Studie, die den klinischen Effekt der NNRTIs - längeres und gesünderes Leben bei höherer Lebensqualität - nachweist. Zur Zulassung wurden ausschließlich Studien zu verbesserten CD4+ Zellzahlen und zur niedrigeren Viruslast benutzt (Surrogatmarker-Studien). Durch ihre gute Verträglichkeit und die geringere Pillenzahl werden sie häufig den Proteaseinhibitoren vorgezogen. NNRTIs sind recht empfindlich: Schon eine Punktmutation genügt, um eine Resistenz des Virus gegen den Wirkstoff zu bekommen. Zudem bestehen Kreuzresistenzen: Zeigt ein Virus Resistenzen gegen einen NNRTI, so sind meist alle NNRTIs wirkungslos. NNRTIs werden in der Leber verstoffwechselt (Cytochrom P450-System).
Die Nebenwirkungsprofile der einzelnen Wirkstoffe unterscheiden sich erheblich. Bei der Therapie mit Nevirapin stehen vor allem allergische Reaktionen und Lebertoxizität im Vordergrund. Ein Exanthem tritt bei bis zu 20% der Patienten auf und führt bei 7 % zum Abbruch der Nevirapineinnahme. Um die Gefahr von Allergien zu mindern, sollte Nevirapin eingeschlichen werden (mit niedriger Dosierung beginnen). Lebertoxizität ist eine seltene, aber unter Umständen lebensbedrohliche Nebenwirkung von Nevirapin. Daher sollten zur Beginn der Therapie die Leberwerte (vor allem Transaminase) engmaschig kontrolliert werden.
Efavirenz hat vor allem Nebenwirkungen, die das zentrale Nervensystem betreffen. Diese treten meist zur Beginn der Therapie auf und nehmen danach ab. In der ersten vier Wochen traten in einer Studie bei 2/3 der Patienten über Schwindel, nahezu die Hälfte über Albträume und etwa 1/3 über Benommenheit und Schlafstörungen. Diese nahmen aber meist nach einiger Zeit ab. Während Nevirapin zur Vorbeugung einer Mutter-zu-Kind-Übertragung (PMTCT = Prevention of Mother to Child Transmission) eingesetzt wird, ist Efivarenz in der Schwangerschaft kontraindiziert. Auch ist angesichts der ZNS-Nebenwirkung die Verkehrstauglichkeit fraglich. Ein Vorteil von Efavirenz gegenüber Nevirapin ist die geringere Lebertoxizität.
Delavirdin ist wegen der hohen Pillenzahl und der dreimal täglichen Einnahme den anderen Wirkstoffen unterlegen. Zudem ist es zurzeit nicht auf dem deutschen Markt zugelassen.
Proteaseinhibitoren
Ohne die Spaltung des viralen Makromoleküls gag-pol-Polyprotein durch das Enzym HIV-Protease werden Viruspartikel produziert, die nicht infektiös sind. Proteaseinhibitoren wurden mit dem Wissen über die molekulare Struktur des Enzyms so modelliert, dass sie direkt im aktiven Zentrum der Protease binden können. Die gute Wirksamkeit von Proteaseinhibitoren wurde anhand von klinischen Endpunkten nachgewiesen. Sie haben zu einer deutlichen Verbesserung der Therapie beigetragen. Jedoch wurde der anfängliche Optimismus, den die Einführung der Proteaseinhibitoren in die Therapie auslöste, deutlich gebremst. Bei der Langzeitbehandlung zeigen sich einige Probleme. Sie führen zu Störungen im Fettstoffwechsel und können Lipodystrophie und Dyslipidämie auslösen. Der Grund hier für liegt wahrscheinlich in der "Mitochondrialen Toxizität". Proteaseinhibitoren scheinen ähnlich wie Nukleosidanaloga die Mitochondrien, also die "Kraftwerke" der Zellen, zu schädigen. Weitere Nebenwirkungen sind gastrointestinale Beschwerden.
Proteaseinhibitoren habe recht kurze Halbwertszeit im Blut-Plasma. Schon nach 8 Stunden ist die minimale Hemmkonzentration erreicht. Daher müssen die meisten Proteaseinhibitoren 3-mal täglich eingenommen werden.
Der Abbau der Proteaseinhibitoren geschieht in der Leber durch das Cytochrom-P450-Enzymsystem. Der Proteaseinhibitor Ritonavir hemmt dieses System. Man ging daher dazu über, andere Proteaseinhibitoren zusammen mit Ritonavir zu verabreichen, um den Abbau zu verlangsamen und die Plasma-Halbwertszeit zu verlängern. Dies bezeichnet man als "Booster". Mittlerweile gibt es den Proteaseinhibitor Lopinavir kombiniert mit einer Boosterdosis Ritonavir (Kaletra). Dies führt zu einer fast 100-fach größeren Plasma-Konzentration von Lopinavir und zu einer größeren Barriere gegen Resistenzen. Daher wird Lopinavir/Ritonavir (Kaletra) zumeist nach Therapieversagen anderer Medikamente benutzt ("Salvage-Bereich").
PMID 10860901 PMID 9287227 PMID 10202827 PMID 10509516 PMID 9835517
Fusionsinhibitoren
Mit Spannung verfolgten viele Betroffene und Therapeuten die Markteinführung des ersten Fusionsinhibitors T-20 Anfang 2003. T-20 bindet an das für die Fusion des Virus mit der Zellmembran der T-Helferzellen wichtige Transmembranprotein gp41 und blockiert so den Eintritt des Virus in die Zelle. Besonders interessant wird die Substanz dadurch, dass sie keine mitochondrale Toxizität und damit kein Lipodystrophiesyndrom auslöst.
Leider ist T-20 mit seinen 36 Aminosäuren zu groß für eine orale Einnahme. In seiner jetzigen Form muss T-20 täglich subkutan gespritzt oder über eine "Insulinpumpe" verabreicht werden. Ein schwieriger Einnahmemodus, zumal Hautirritationen an der Einstichstelle eine häufige Nebenwirkung zu sein scheinen.
Erste Studien ergaben, dass die eine bloße Hinzugabe von T-20 zu einer klassischen antiretroviralen Therapie nur einen begrenzten Erfolg mit sich bringt. [4] Zwei große Studien, die T-20 zu einer optimierten HAART gegen eine optimierte HAART ohne T-20 verglichen, zeigte jedoch signifikant bessere Werte im T-20 Arm der Studie. Das lässt darauf schließen, dass besonders die Patienten von T-20 profitieren, die gleichzeitig auch noch andere medikamentöse Optionen haben.[5]
Auch für T-20 gilt: Kein Medikament ohne Nebenwirkung! Es scheint zu Interaktionen mit Granulozyten zu kommen, die bei einigen Patienten zu vermehrten Infektionen führten.
Eine rasche Resistenzbildung des Virus ist zudem auch recht wahrscheinlich. Jedoch scheint die virale Fitness der resistenten Stämme vermindert zu sein.
Nichtsdestotrotz ermöglicht T-20 den Patienten eine interessante Option, die auf Grund von Nebenwirkungen oder Resistenzen ihre Therapie umstellen müssen. Erste Wahl zu Therapiebeginn ist T-20 derzeit jedoch nicht, und das nicht nur auf Grund der Studienlage. T-20 ist nach Aussage der Herstellerfirma Hoffmann-La Roche einer der am aufwändigsten zu produzierenden Substanzen der Firmengeschichte. Dies macht sich im Preis deutlich (mehr als €24.000 pro Jahr), der höher ist als einige Dreifachkombinationen herkömmlicher antiretroviraler Medikamente. So dürfte T-20 nicht zum Favoriten der Krankenkassen werden. Andere Firmen werden bald mit neuen Fusionsinhibitoren auf den Markt kommen, und an einer "T-20- einmal-wöchentlich-Spritze" wird intensiv geforscht.
Eine Sammlung mit übersichtlichen Beschreibungen aller zur Zeit angewandten antiretroviralen Therapeutika sowie einiger gängiger Medikamente zur Behandlungen opportunistischer Infektionen findet sich unter HIV.NET.
Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART)
Mit "highly active antiretroviral therapy" wird die Kombinationstherapie aus mehreren antiretroviralen Medikamenten bezeichnet. Ziel der Therapie ist es, die Viruslast unter die Nachweisgrenze zu drücken und die CD4-Zellwerte zu erhöhen, um so das Immunsystem gegen opportunistische Infektionen und andere Aids-definierende Erkrankungen zu stärken. In der Regel besteht eine HAART aus 2 verschiedenen Nukleosianaloga (auch als Nuke-Backbone der Therapie bezeichnet) plus entweder einem Nicht-nukleosidischen Reverse Transkriptase Hemmer (NNRTI), einem Proteaseinhibitor (PI) oder einem dritten Nukleosidanalogon. Welche Kombination die beste ist, lässt sich pauschal nicht beantworten, und sollte für jeden Patienten individuell entschieden werden. Denn alle drei Kombinationen haben Vor- und Nachteile:
Die Kombination aus 2 Nukes und einem PI wurde am umfangreichsten getestet und es liegen Daten aus Langzeitstudien zum klinischen Effekt vor. Auch weist diese Kombination eine hohe Barriere gegen Resistenzen auf. Jedoch ist die hohe Pillenzahl eine Belastung für den Patienten und wirkt sich negativ auf seine Adherence aus. Auch ist eine Langzeittoxizität zu befürchten.
2 Nukes plus eine NNRTI scheinen den PIs gleichwertige Virus-Suppression zu haben, allerdings ist der klinische Effekt nicht durch Studien belegt (nur der Effekt auf Laborparameter). Die geringe Pillenzahl (ein mal am Tag für den NNRTI, zweimal am Tag die Nukes, eventuell bald "once daily" für beide) ist ein deutlicher Pluspunkt. Leider sind Allergien zu Beginn der Therapie mit Nevirapin keine Seltenheit. NNRTI sind resistenzanfälliger, und durch Kreuzresistenzen fällt eine ganze Wirkstoffklasse weg.
3 Nukes haben die geringste Pillenzahl und die einfachste Dosierung. AZT + 3TC + Abacavir gibt es in einer Tablette (Trizivir), die 2-mal täglich eingenommen wird. Dass es nur diese Kombination in einer Tablette gibt, liegt nicht an der Machbarkeit, sondern an der Tatsache, dass die Patente zumeist bei verschiedenen Firmen liegen und keiner mit der Konkurrenz teilen will. In Indien, Südafrika, Brasilien und Kenia werden auch 2 Nukes + NNRTI in einer Tablette als Generikum produziert. Es scheint wenige Interaktionen mit anderen Medikamenten zu geben, und sollte es zur Unverträglichkeit oder Resistenzen kommen, so stehen noch 2 andere Wirkstoffklassen zu Verfügung. Es liegen jedoch keine Langzeitdaten mit klinischen Endpunkten vor und die Kombination scheint auch etwas weniger wirksam in der Virusunterdrückung zu sein.
Wann mit HAART beginnen: Wann mit einer Therapie begonnen werden sollte, wird kontrovers diskutiert. Es gilt das Risiko, an Aids zu erkranken, mit den Risiken der Langzeittoxizität und Resistenzbildung abzuwägen. Als Mitte der 1990er Jahre entdeckt wurde, mit welcher Geschwindigkeit das Virus mutieren kann, und als man noch davon ausging, dass es durch eine längere Therapie zur Vernichtung aller Viren kommt (Eradikation), wurde das Behandlungsdogma "Hit hard and early!" ausgerufen. Dieses wurde schon zwei Jahre später durch die Entdeckung der mitochondralen Toxizität hinfällig. Heute sind Therapeuten deutlich zurückhaltender, und mit der HAART wird zumeist erst dann begonnen, wenn das Immunsystem deutlich geschwächt ist.
Die Deutsch-Österreichische Empfehlung zum Therapiebeginn berücksichtigt drei Faktoren: Das klinische Bild des Patienten, seinen CD4-Wert und die Viruslast.
Patienten, die bereits Aids-definierende Erkrankungen haben (CDC C), wird eine HAART dringend empfohlen. Auch beim Auftreten von Erkrankungen, die auf ein geschwächtes Immunsystem hindeuten, jedoch nicht Aids-definierend sind (CDC B), wird eine HAART empfohlen. Dies gilt auch für Patienten, die symptomfrei sind, aber einen CD4+ Wert von kleiner 200 haben, da es dann meist eine Frage der Zeit ist, bis Aids auftritt. Als im Allgemeinen ratsam wird eine Therapie bei Patienten angesehen, die einen CD4+ Wert zwischen 200 und 350 haben. Ebenso angeraten ist der Beginn der HAART laut der Empfehlung bei Patienten mit einem CD4+ Wert zwischen 350 und 500, wenn eine hohe Viruslast vorliegt (>100.000).
Doch gilt hier mehr denn je die Weisheit: Man behandelt nicht die Krankheit oder den Laborwert, sondern den Patienten. So sollte die Entscheidung, wann mit der Therapie begonnen wird, individuell gemeinsam von Therapeut und Patient gefällt werden. Der Beginn der Therapie bedeutet in der Regel eine Entscheidung, die für den Rest des Lebens eine Konsequenz hat. Daher muss der Patient genau über Therapieziele, mögliche Nebenwirkungen und Risiken der HAART Therapie aufgeklärt sein. Dies lässt sich nur schwer in einer Therapiesitzung gewährleisten. Daher sollte, wenn irgend möglich, der Patient Zeit haben, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, mit der Therapie zu beginnen. Letztlich hat die regelmäßige Medikamenteneinnahme eine höhere prognostische Aussagekraft, als der CD4+ Wert zu Beginn der Therapie (siehe Adherence).
Vorbeugung: Prävention ist die effektivste Maßnahme gegen HIV. Durch den Gebrauch von Kondomen, sterilen Nadeln bei der Einnahme von Drogen und bei Impfungen sowie Blutspenden kann man einer Infektion sehr sicher entgehen. Sexuelle Enthaltsamkeit bzw. Treue zu einem einzigen Sexualpartner und ein drogenfreier Lebensstil sind noch wirksamere Präventionsmaßnahmen, die so gut wie alle Neuinfektionen verhindern können. Nach einem Ereignis mit Ansteckungsrisiko kann die Ansteckung verhindert werden, wenn eine sog. Postexpositionsprophylaxe stattfindet.
Eine HIV-Impfung gibt es nicht!
An der hohen Mutationsrate des HI-Virus scheiterten bisher die langjährigen Forschungen um Impfstoffe, die die Bildung von schützenden Antikörpern gegen das Oberflächenprotein gp120 fördern sollten. Als das Mittel endlich gegen das sehr ähnliche SIV (SI-Virus, simian Immunodeficiency virus) der Affen erfolgreich getestet war, hatte das HI-Virus in Freiheit die Struktur seines gp120 Oberflächenproteins verändert.
Nach jahrzehntelangen vergeblichen Versuchen, einen Impfstoff gegen das HI-Virus herzustellen, begann Ende Februar 2004 zum ersten Mal eine klinische Studie an gesunden Probanden. Die Studie wird von den Universitätskliniken Bonn und Hamburg-Eppendorf durchgeführt. Mit ersten Ergebnissen ist Anfang 2005 zu rechnen. Falls diese Ergebnisse überzeugen, wird es mindestens weitere sieben Jahre dauern, bis der Impfstoff industriell gefertigt werden kann. Als Grundlage für die neue Impfung nahmen die Forscher den Subtyp HIV-1, Subtyp C, der vor allem in Afrika vorkommt. Denn hier soll das Hauptanwendungsgebiet liegen. Aus diesem Grund wird die Studie von gemeinnützigen Organisationen wie der International Aids Vaccine Initiative (IAVA) gefördert.
Entstehungstheorien: HIV ist eng mit Viren verwandt, die aidsähnliche Symptome in Primaten auslösen, und es ist allgemein akzeptiert, dass einer dieser Virustypen Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Menschen übertragen wurde, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass dies in isolierten Fällen bereits früher geschah.
Genaue Angaben über Zeit, Ort, Wirtstier, Art und Anzahl der Übertragungen sind nicht bekannt.
Ein Virus, das fast identisch mit dem menschlichen HI-Virus ist und SIV genannt wird, wurde in Schimpansen gefunden. Nach jüngsten Untersuchungen von Virologen der Universität Birmingham/Alabama löst HIV-1, das von dem im Schimpansen gefundenen SI-Virus abstammt, vermutlich die Immunschwächekrankheit aus. Durch eine genetische Analyse konnten die Wissenschaftler zeigen, dass das SI-Virus eine Kombination aus zwei Virusstämmen ist, die in bestimmten Meerkatzen vorkommen. Da Meerkatzen von Schimpansen gejagt und gefressen werden, müssen sich die Schimpansen mit den zwei Virusstämmen infiziert haben, aus denen sich dann in ihrem Körper das SI-Virus gebildet hat. Die Übertragung dieses SI-Virus auf den Menschen erfolgte nach Ansicht der Forscher wohl bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts durch den Verzehr von Schimpansenfleisch.
Weitere wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass das HI-Virus zuerst in West-Afrika auftrat, aber es ist nicht mit letzter Sicherheit geklärt, ob es nicht mehrere Virusherde gab. Neue sogenannte phylogenetische Untersuchungen, das heißt Verwandtschaftsvergleiche zwischen den unterschiedlichen Subtypen von HIV und zwischen HIV und SIV, lassen vermuten, dass mehrere unabhängige Übertragungen vom Schimpansen auf den Menschen in Kamerun und/oder dessen Nachbarländern stattfanden.
Die erste Blutprobe, die nachgewiesenermaßen HIV-Antikörper enthält, wurde 1959 im Kongo von einem erwachsenen Menschen genommen. Weitere Proben stammen von einem US-Amerikaner (1969) und einem norwegischen Matrosen (1976).
2006 wurde in Science[6] ein Bericht veröffentlicht, der beweist, dass der Schimpanse Pan troglodytes troglodytes der natürliche Wirt der Zoonose ist. Der erste Mensch hat sich vermutlich durch den Verzehr von Affenfleisch infiziert.[7]
Geschichte: 1981 wurde von Michael Gottlieb erstmals eine Häufung seltener und oft tödlich verlaufender Infektionen bei zuvor gesunden homosexuellen Männern in den USA beschrieben. Besonders auffällig war die Kombination von Pneumocystis carinii-Infektionen und Kaposi-Sarkomen, beides Erkrankungen, die zumeist bei deutlich geschwächten Patienten auftrat. Schon recht früh wurde eine erworbene Immunschwächeerkrankung für die wahrscheinlichste Ursache in Betracht gezogen. Epidemiologische Untersuchungen in den USA zeigten, dass neben Homosexuellen vorwiegend Drogenabhängige, Empfänger von Blut (z. B. durch Bluttransfusionen) und Blutprodukten (Hämophile) und Kleinkinder von infizierten Müttern an Aids erkrankten. Dies führte 1982 zu der Vermutung, dass der Auslöser der neuen Erkrankung ein sexuell und parenteral übertragbarer Erreger sei. In Frankfurt am Main wurde die Krankheit 1982 zum ersten Mal bei einem Patienten diagnostiziert. 1983 isolierte eine französische Forschergruppe um Luc Montagnier das Lymphadenopathie-Virus (LAV), bei dem sie die Ursache für Aids vermuteten. Eine kausale Beziehung zwischen dem Virus und der Immunschwächeerkrankung wurde kurze Zeit später behauptet. Im selben Jahr wurde in Berlin die AIDS-Hilfe gegründet. 1984 wurde im US-Krebsinstitut ein bei Aids-Patienten entdecktes Virus HTLV-III genannt. Bald stellte sich heraus, dass LAV und HTLV-III identisch sind. 1985 erhielt Robert Gallo das US-Patent für den ersten ELISA-Antikörper-Test, der von der US-Zulassungsbehörde zugelassen wurde. Im gleichen Jahr findet in Atlanta (USA) die erste Welt-Aids-Konferenz statt.
Im Jahr 1986 wurde für den Virus der Name Humanes Immundefizit Virus (HIV) etabliert. Ein Jahr später, 1987, wurde mit AZT (Retrovir) das erste Therapeutikum zugelassen. In einer Studie hatte es die Sterberate unter HIV stark reduziert. Im Jahr 1988 wurde von der WHO der 1. Dezember zum Welt-Aids-Tag erklärt. 1989 wurde bei HIV-Patienten die Pentamidin-Inhalation zur Prophylaxe der Pneumocystis-carinii-Pneumonie eingeführt.
Im Jahr 1990 wurde aus Protest gegen die Diskriminierung von HIV-Infizierten auf der Aids-Konferenz in San Francisco das Red Ribbon, ein rotes Armband etabliert. Ein Jahr später wurde die Rote Schleife international zum Symbol für den Kampf gegen Aids. 1992 wurde aufgrund der US-Einreisebestimmungen der Welt-Aids-Kongress von Boston nach Amsterdam verlegt. Außerdem wurde im Gedenken an Freddie Mercury von den verbleibenden Queen-Mitgliedern die Stiftung Mercury Phoenix Trust gegründet.
In der frühen Therapie HIV-Infizierter ergab sich 1993 in einer Studie kein Überlebensvorteil mit der AZT-Therapie. 1994 wurde HIV-PCR als wichtiger Marker für die Therapiekontrolle des Infektionsverlaufes etabliert. Im folgenden Jahr, 1995, kam der erste Protease-Hemmer, Saquinavir, in den USA auf den Markt. Im folgenden Jahr wurde Nevirapin als erster nicht-nukleosidischer Reverse-Transkriptase-Hemmer zugelassen. Durch die intensive Kombitherapie nahm die Sterberate in den USA 1997 drastisch ab. 2003 wurde mit Enfuvirtid (Fuzeon) der erste Fusionshemmer in den USA zugelassen. 2004 wurde von der WHO die Initiative 3 by 5 gestartet: 3 Millionen Infizierte sollten im Jahr 2005 mit Medikamenten versorgt werden.
Zu Anfang galt die Erkrankung in der öffentlichen Wahrnehmung als Problem von Randgruppen wie Homosexuellen und Drogenabhängigen, daher war sie in den USA bis 1982 auch unter den Namen GRID (Gay-Related Immune Deficiency) oder GIDS (Gay People's Immuno Defiency Syndrome) bekannt. Dies änderte sich jedoch auf dramatische Weise durch das Aufkommen von HIV-Tests. Denn auch Menschen ohne klinische Symptome hatten Antikörper, was auf eine Inkubationszeit von mehreren Jahren hindeutete, in der das Virus möglicherweise auch weitergegeben wurde. 1984 ergaben Untersuchungen, dass Aids in Kinshasa bei Männern und Frauen gleich häufig auftrat, unabhängig von Drogenkonsum und Bluttransfusionen.
In den USA wurde 1985 berichtet, dass bei untersuchten Hämophiliekranken ("Blutern"), die sich durch Blutkonserven infiziert hatten, die Ansteckungsrate der Ehefrauen bei 70 % lag. Die Erkenntnis, dass die Ansteckungsgefahr bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr deutlich höher zu sein schien als zunächst angenommen, führte zu einem großen öffentlichen Interesse. Die Kombination aus den nun bekannten Ansteckungswegen und langer Inkubationszeit ließen epidemiologische Hochrechnungen ein apokalyptisches Bild zeichnen. Eine geschichtlich einmalige Massenhysterie breitete sich aus: Aids schien zu einer Bedrohung der Menschheit geworden zu sein.
Die jährliche Verdopplung von Neuerkrankungen hielt in Deutschland nur von 1984 bis 1987 an, danach verlief der Anstieg der Zahl von Erkrankten weniger steil, bis sich die Zahlen im Jahre 1993 auf ca. 2000 einpendelte. Dadurch änderte sich auch schnell wieder das öffentliche Interesse an Aids. 2003 steckten sich weltweit ungefähr 4,8 Millionen Menschen neu mit dem Virus an, im selben Jahr starben circa 2,9 Millionen Menschen daran.
Verbreitung des HI-Virus:
Allgemein
Aus epidemiologischer Sicht ist das weltweite Verteilungsmuster von HIV interessant: Während sich die meisten Viren gleichmäßig schnell ausbreiten, war dies bei HIV anders. Während die HIV-Epidemie in den USA bereits vor 20 Jahren begann, gab es einige Länder, die von HIV verschont zu sein schienen, dann aber mit großer Geschwindigkeit vom Virus erobert wurden. So geschah es vor allem in Osteuropa und Asien Mitte der 1990er Jahre. In anderen Ländern, zum Beispiel Kamerun, blieb die Prävalenz von HIV Jahre lang stabil, um dann sprunghaft anzusteigen. Auch eine Obergrenze in der HIV-Prävalenz scheint es nicht zu geben. So stieg die Quote der schwangeren Frauen mit HIV in städtischen Zentren in Botswana nach 1997 in vier Jahren von 38,5 % auf 55,6 %.
Dass HIV erfolgreich zu bekämpfen ist, zeigt das Beispiel Uganda. 1992 lag die Prävalenz von HIV bei schwangeren Frauen bei nahezu 30 % und konnte auf 10 % im Jahre 2000 gesenkt werden. Grundlagen dieses Erfolges waren die landesweite Einführung von Sexualkundeunterricht, flächendeckende Kampagnen zur Steigerung der Akzeptanz von Kondomen, HIV-Tests, deren Ergebnisse noch am selben Tag bekannt gegeben wurden und Selbsthilfe-Kits für sexuell übertragbare Krankheiten. Diese Erfolge sind jedoch nur mit finanziellen Mitteln durchführbar, die viele der Hochendemie-Länder in Afrika nicht allein aufbringen können. Unabdingbar ist ferner ebenso ein politischer Wille, diese Seuche aktiv zu bekämpfen.
Weltweit
| Mit HIV/Aids lebende Personen | Neuinfektionen | Todesfälle | Todesfälle aufsummiert | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | (~ 2.000.000)1 | - | - | - |
| 1993 | (12.900.000)1 | - | - | (2.500.000)1 |
| 1999 | - | 4.000.000 | - | - |
| 2000 | - | 3.800.000 | - | - |
| 2001 | 34.900.000 (40.000.000)1 | 3.400.000 | 2.500.000 | 20 - 22 Mio |
| 2002 | - (42.000.000)1 | 3.500.000 | 3.100.000 | ~ 21.1 Mio |
| 2003 | 37.800.000 | 4.800.000 | 2.900.000 | ~ 24.0 Mio |
| 2004 | 39.400.000 | 4.900.000 | 3.100.000 | ~ 27.1 Mio |
| 2005 | 40.300.000 | 4.900.000 | 3.100.000 | > 25 Mio |
Die Daten für das Jahr 2005 stammen aus "Aids epidemic update December 2005 (UNAIDS)". Für die weiteren Daten sind keine Quellen angegeben.
1Bei der Berechnung der Gesamtzahl aller Infektionen wandte UNAIDS ab 2004 eine neue Methodik an, die eine relative Korrektur der Zahlen nach unten nach sich zog. Nach alter Methodik ermittelte Zahlen sind zur Unterscheidung kursiv gesetzt, für 2001 finden sich zum Vergleich beide Werte angegeben, ein korrigierter Wert für 2002 ist nicht bekannt.
| Globale Verteilung | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subsahara-Afrika | 23,8 Mio. | 24,4 Mio. | 25,0 Mio. | 25,4 Mio. | 25,8 Mio. |
| Süd- & Südostasien | 5,9 Mio. | 6,4 Mio. | 6,5 Mio. | 7,1 Mio. | 7,4 Mio. |
| Latein-Amerika | 1,4 Mio. | 1,5 Mio. | 1,6 Mio. | 1,7 Mio. | 1,8 Mio. |
| Osteuropa & Zentralasien | 890.000 | 1,0 Mio. | 1,3 Mio. | 1,4 Mio. | 1,6 Mio. |
| Ostasien | 680.000 | 760.000 | 900.000 | 1,1 Mio. | 870.000 |
| Nordamerika | 950.000 | 970.000 | 1 Mio. | 1 Mio. | 1,2 Mio. |
| West- und Zentraleuropa | 540.000 | 600.000 | 580.000 | 610.000 | 720.000 |
| Nordafrika und Naher Osten | 340.000 | 430.000 | 480.000 | 540.000 | 510.000 |
| Karibik | 400.000 | 420.000 | 430.000 | 440.000 | 300.000 |
| Ozeanien | 24.000 | 28.000 | 32.000 | 35.000 | 74.000 |
Alle Zahlen von UNAIDS.
Im südlichen Afrika ist die Rate am höchsten. Die Rate der schwangeren HIV-Infizierten unter 20 Jahren ist in Südafrika auf 15,4 % gesunken (1998: 21 %); dies bedeutet, dass Aufklärungsprogramme langsam Erfolge zeigen. Jedoch sind die Aids-Raten bei älteren Frauen immer noch sehr hoch. 32 % der Frauen zwischen 24 und 29 Jahren sind derzeitig mit der Krankheit infiziert. Insgesamt sind 20 % der Bevölkerung Südafrikas mit HIV infiziert. Das Land mit der weltweit höchsten Aids-Rate ist das benachbarte Swasiland (seit 2018 Eswatini), wo 2005 42 % der Bevölkerung infiziert waren.
Deutschland: Die Zahl der Neuinfektionen lag einige Jahre relativ konstant bei knapp 2.000 pro Jahr. 2005 betrug die Zahl der Neuinfizierten in Deutschland ca. 2.490. Ende 2005 lebten ca. 49.000 HIV-infizierte Menschen in der Bundesrepublik, davon 39.500 Männer und 9.500 Frauen, sowie ca. 300 Kinder. 8.000 von ihnen zeigten das Vollbild Aids.
Von den 2.490 Neuinfizierten waren ca. 85 % Männer, 70 % Männer, die Sex mit Männern hatten, 20 % waren Übertragungen durch heterosexuellen Sex, 9% Infektionen durch infizierte Spritzen bei Drogenmissbrauch und 1% Übertragungen von der Mutter auf das Kind, meist während der Geburt.
Die Zahl der neu an Aids Erkrankten liegt bei ca. 850 pro Jahr und ist ebenfalls relativ konstant. Etwa 750 Menschen sind 2005 an den Folgen einer HIV-Infektion beziehungsweise an Aids verstorben. Von Anfang der 1980er Jahre bis 2005 haben sich in der Bundesrepublik Deutschland etwa 75.000 Menschen mit HIV infiziert, etwa 31.500 Menschen sind an Aids erkrankt und etwa 26.000 sind an den Folgen der HIV-Infektion gestorben.
Manche befürchten einen Anstieg der Infizierungsrate, weil zum einen die Aufklärungswelle der 1990er-Jahre verebbt sei und sich zum anderen gerade bei Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren eine erstaunliche Unkenntnis in Bezug auf die latente Ansteckungsgefahr beim ungeschützten Sexualakt zeigt. So behauptet erschreckenderweise jeder fünfte Jugendliche, dass man einem HIV-Positiven „die Krankheit ansehen könne“. Hinzu kommt eine Verharmlosung und gelegentliche Faszination von Gefahren, die bei manchen zu bewusst risikoreicherem Verhalten (Barebacking) führt.
Grund zur Besorgnis gibt weiterhin der kontinuierliche Anstieg von anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Nicht nur, dass sich damit das Risiko einer Ansteckung erhöht, es zeigt auch, dass die Akzeptanz von Kondomen rückläufig zu sein scheint. Diese Befürchtungen werden bestärkt durch die Tatsache, dass sich laut des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) in den ersten acht Monaten des Jahres 2005 zwanzig Prozent mehr Menschen mit HIV angesteckt haben als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.
Mehr als 80 Prozent sind Männer und nahezu 70 Prozent der Gesamtzahl sind Männer, die gleichgeschlechtliche Kontakte hatten. Das Infektionsrisiko für diese Männer ist damit doppelt so groß wie vor vier Jahren - und so hoch wie seit zwölf Jahren nicht mehr.
Österreich: Ende 2004 lebten etwa 9.400 HIV-Infizierte in Österreich, mehr als die Hälfte davon in Wien. Die Zahl der Neuinfizierungen beträgt seit 2003 etwa 450 pro Jahr. Die niedrigste Rate war 1997 mit 297, die höchste 1993 mit 561 Neuinfektionen. Der Anstieg der Neuinfektionen kann durch das Ende der Aufklärungswelle der 1990er-Jahre erklärt werden.
Zwischen 1983 und 1. Dezember 2005 sind in Österreich 2.463 Menschen an Aids erkrankt und 1.418 gestorben. Von 2003 mit 50 neuen Erkrankungen, stiegen sie im Jahr 2004 auf 65 an.
Im Vergleich der ersten drei Quartale, stiegen die HIV-Neuinfektionen von 317 im Jahr 2003 auf 364 in den Jahren 2004 und 2005 an.
Schweiz: In der Schweiz wurden im Jahr 2005 702 positive HIV-Tests gemeldet. Seit 2002 hat die Anzahl der Neuansteckungen von 791 leicht abgenommen. Besonders stark betroffen sind die Kantone Zürich, Waadt und Genf.
Infektionen: Bei den Männern sind 2005 die meisten Ansteckungen mit 49,1 % nach homosexuellem Geschlechtsverkehr zu verzeichnen. Seit 2003 zeigt sich in dieser Gruppe eine Zunahme von 13,9 % und bewegt sich damit über dem Höchststand von 1994. Die Anzahl der Ansteckungen nach heterosexuellem Kontakt folgt mit 38,1 %. Diese Gruppe stieg nach 2002 wieder an, konnte sich aber 2005 wieder senken und scheint sich auf gleich bleibend hohem Niveau zu halten. Die Ansteckungen nach Drogenkonsum sinken seit 2003 weiter auf 9,7 %.
Bei den Frauen ist das Ansteckungsrisiko bei heterosexuellem Kontakt mit 80,6 % am grössten und stieg seit 2002 um 10,7 %. Die Infizierungen nach Drogenkonsum bleiben mit 11,1 % auf konstantem Niveau.
Bei Ansteckungen nach homosexuellen Kontakten sind hauptsächlich Bürger aus der Schweiz mit etwa 72 % betroffen, gefolgt mit 15 % von Personen aus der EU. Das Verhältnis bewegt sich bei Ansteckungen nach Drogenkonsum etwa im gleichen Verhältnis (63 % aus der Schweiz und 20,4 % EU). Bei den heterosexuellen Beziehungen zeigt sich jedoch ein stark grösserer Anteil an ausländischen Personen. Besonders stark betroffen sind Personen aus der Subsahara mit 41 %.
Aids in Afrika:
Ausbreitung
Die Aids-Pandemie hat ihre schlimmsten Ausmaße südlich der Sahara. Hier leben 26 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion. In einigen Ländern hat sich durch die Immunschwächeerkrankung die Lebenserwartung um mehr als zehn Jahre gesenkt. Warum sich die Erkrankung hier so viel schneller verbreitet, ist nicht ganz geklärt.
Es scheint einige Faktoren zu geben, die die Ausbreitung des HI-Virus begünstigen: während in Europa und Nordamerika schon kurz nach der Entdeckung des HI-Virus die Massenmedien große Teile der Bevölkerung mit Informationskampagnen über die tödlichen Gefahren einer HIV-Infektion und Prävention informierten, blieb Aids in vielen Teilen Afrikas ein Tabuthema. So hatte das HI-Virus fast zwanzig Jahre mehr Zeit, sich ungehindert auszubreiten.
Sozialethische Beurteilung: Das Krankheitssyndrom Aids hat sich weltweit zu einer ernsten Herausforderung für direkt Betroffene, für die medizinische Wissenschaft, aber auch für all jene, die derartige Patienten zu betreuen haben oder mit ihnen zusammenleben müssen, entwickelt.
Fernab von jeder Stigmatisierung aidskranker Patienten gilt es, Mittel und Wege zu finden, ihnen besser wirksam zu helfen: Sei es durch immer noch nicht ausreichend verfügbare therapeutische Maßnahmen, sei es im Sinn der symptomatischen Therapie und palliativen Medizin. Geboten ist zudem umfassende und wirksame Prävention.
Die Suche nach einer ethisch vertretbaren Aids-Bekämpfungsstrategie führt zu teils gegenteiligen Ergebnissen: Die einen betonen die unbedingte Notwendigkeit eines ausschließlich oder doch primär „technischen“ Schutzes gegen die Ausbreitung der Krankheit. Andere sehen diese Antwort als nicht ausreichend an bzw. lehnen diese aus Gründen einer religiösen Ethik ab. Sie betonen den Wert der dauerhaften ehelichen Treue neu bzw. fordern im konkreten Fall auch zeitweise oder völlige Enthaltsamkeit ein. Die Propagierung von Kondomen als Schutz gegen Aids sei vom religiös-christlichen Standpunkt aus bedenklich. Man argumentiert, auf diese Weise werde ein mit Promiskuität und gewissen sexuellen Praktiken assoziierter verantwortungsloser Lebensstil gefördert, der die eigene Person sowie andere Menschen einer todbringenden Gefahr aussetze.
Im Oktober 2003 deckte die BBC in einer Reportage auf, dass Priester, Nonnen und katholische Sozialarbeiter auf direkte Weisung des Vatikans überall in der dritten Welt die Unwahrheit verbreiten, Kondome böten keinen Schutz vor Aids. Das Virus könne jederzeit durch das Latex schlüpfen, weil es 450-mal kleiner sei als ein Spermatozoon und damit auch deutlich kleiner als Poren im Material. So macht etwa der Erzbischof von Nairobi, Raphael Ndingi Nzeki, in Kenia, wo nach offiziellen Schätzungen bereits 20 % der Bevölkerung mit HIV infiziert sind, die Verfügbarkeit von Kondomen für die rasche Ausbreitung der Epidemie verantwortlich. Nach Aussage von Gesundheitsarbeitern erzählen manche Priester sogar, dass die Kondome selbst mit dem Virus beschichtet seien.[8]
Viele Gesundheitsorganisationen betrachten die religiös motivierte und sachlich irreführende Anti-Kondom-Propaganda zahlreicher Kirchen als ein großes Hindernis für ihre Präventionsarbeit. Sie sei in hohem Maße unethisch, weil sie die Wahrung einer restriktiven Sexualmoral für wichtiger als oder ausreichend für die mögliche Eindämmung der Aids-Epidemie halte.
Literatur und Weblinks:
Deltaretrovirus
Humanes T-lymphotropes Virus
| Humanes T-lymphotropes Virus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||||||
Das humane T-Zell-lymphotrope Virus Typ I (HTLV-I) (früher auch: humanes T-Zell-Leukämie-Virus Typ I) ist ein Retrovirus, das Menschen und andere verwandte Primaten infizieren kann. Es infiziert primär CD4-positive T-Lymphozyten und kann bei einer kleinen Minderheit der Infizierten eine T-Zell-Leukämie oder neurologische Erkrankungen verursachen.
Historisches: HTLV-I wurde 1979/1980 als erstes humanpathogenes Retrovirus durch die Arbeitsgruppe um Robert Gallo am NIH entdeckt. Dem vorangegangen war eine jahrzehntelange Suche nach menschlichen Retroviren, nachdem man Retroviren aus dem Tierreich schon seit vielen Jahrzehnten kannte. Die Entdeckung war dementsprechend eine wissenschaftliche Sensation. Kurz danach wurde ein zweites, mit HTLV-I eng verwandtes humanes Retrovirus entdeckt, das dementsprechend dann als HTLV-II bezeichnet wurde. Die ersten HTLV-I-Virusisolate stammten von Patienten mit T-Zell-Leukämien. Der Name "HTLV" stand daher zunächst für "humanes T-Zell-Leukämievirus". Später entdeckte man, dass HTLV-I auch andere nicht-maligne Erkrankungen verursachen kann und der Name wurde in "T-Zell-lymphotropes Virus" abgeändert. In den folgenden Jahren entdeckte man bei Primaten verschiedene, mit HTLV-I und HTLV-II eng verwandte Retroviren, die dann analog als simian T-cell lymphotropic viruses oder primate T-cell lymphotropic viruses (T-Zell lymphotrope Viren von Affen bzw. Primaten) bezeichnet wurden. Heute geht man davon aus, dass die humanen Viren HTLV-I und HTLV-II durch Übertragung von Affenretroviren vor etlichen Tausend Jahren auf den Menschen entstanden sind.
Taxonomie: Taxonomisch wird HTLV-I zu den Deltaretroviren gezählt und aufgrund der engen genetischen Verwandtschaft mit den Deltaretroviren der Primaten in eine Untergattung "Primaten-Deltaretroviren" eingeteilt.
Epidemiologie: Weltweit schätzt man ca. 15-20 Millionen HTLV-I-Infizierte (zum Vergleich: HIV: ca. 40 Millionen 2006). Im Gegensatz zu HIV hat sich die Zahl der Infizierten in den letzten Jahrzehnten wohl nicht wesentlich verändert (nach Schätzungen, genaue Zahlen existieren für die meisten Länder nicht). Im Gegensatz zu HIV, das sich seit Anfang der 80er Jahre vor allem im Afrika südlich der Sahara geradezu explosionsartig ausgebreitet hat und zur Pandemie geworden ist, sind die HTLV-I-Infektionen weitgehend auf bestimmte Endemiegebiete beschränkt geblieben. Die Ursachen liegen wohl in der wesentlich weniger effizienten Übertragung von HTLV-I im Gegensatz zu HIV. Bekannte Endemiegebiete sind:
- Japan, insbesondere die südlichen Inseln Kyushu, Shikoku und Okinawa
- die Karibik und Anrainergebiete, z. B. Mittelamerika
- bestimmte Gebiete von Äquatorialafrika
- bestimmte Gebiete von Südamerika
- die Region um die Stadt Mashhad im Nordosten Irans
- die USA (hier insbesondere bestimmte Bevölkerungsgruppen)
Für viele Länder existieren jedoch keine verlässlichen Zahlen. In Europa kommt HTLV-I fast nicht vor (eine Ausnahme sind Einwanderer aus Endemiegebieten wie z.B. karibische Einwanderer in Großbritannien). Im Gegensatz zu den USA werden in Deutschland Blutspender wegen der Seltenheit nicht routinemäßig auf HTLV-I getestet).
Genetik: Das HTLV-I-Genom besteht aus RNA und umfasst ca. 8500 Basen (zum Vergleich: menschliches Genom ca. 6.000.000.000 Basenpaare). Es besteht an den Enden aus zwei identischen flankierenden Sequenzen (den sogenannten long terminal repeats). Dazwischen liegen die für alle Retroviren typischen 3 Genregionen gag (Genregion für die Virusstrukturproteine, aus denen die innere Virushülle aufgebaut ist), pol (Virusenzyme, die für die Umschreibung des Virusgenoms in DNA und die Integration in das zelluläre Genom wichtig sind) und env (Virusproteine, die in die äußere Virushülle eingebaut sind und entscheidend dafür sind, welche Zellen das Virus infizieren kann).
Zusätzlich besitzt HTLV-I allerdings noch weitere Gene, die für Proteine kodieren, die die Expression von Virusgenen und auch zellulären Genen beeinflussen. Zumindest eines dieser Gene - tax - scheint entscheidend an der malignen Transformation der infizierten Zelle und der Entstehung der T-Zell-Leukämie beteiligt zu sein.
Infektionswege: Drei wesentliche Infektionswege sind bekannt:
- perinatale Infektion des Säuglings durch die Muttermilch infizierter Mütter
- durch Transfusion infizierter Blutprodukte
- durch Sexualkontakt.
Assoziierte Erkrankungen: HTLV-I verursacht hauptsächlich zwei Erkrankungen:
- die adulte T-Zell-Leukämie, eine Sonderform der T-Zell-Leukämie (manchmal abgekürzt ATL)
- die tropische spastische Paraparese bzw. HTLV-I-assoziierte Myelopathie (manchmal abgekürzt TSP/HAM).
Diese Erkrankungen treten nur bei einem kleinen Teil der HTLV-I-Infizierten auf. Beispielsweise gab es in Japan in den 90er Jahren mehr als eine Million HTLV-I-Infizierte, aber es wurden nur zwischen 500 und 1000 Fälle von ATL jährlich beobachtet. Man schätzt, dass das lebenslange Risiko für diese Erkrankungen bei Infektion bei jeweils ca. 1-2% liegt. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur HIV-Infektion, bei der praktisch 100% der Infizierten, sofern sie nicht behandelt werden, früher oder später AIDS entwickeln.
In Japan erfolgte die Infektion früher hauptsächlich perinatal über die Muttermilch infizierter Mütter. Seitdem dieser Übertragungsweg bekannt ist, gibt es Programme, die diesen Müttern den Verzicht auf das Stillen nahelegen. Dadurch ist es in Japan tatsächlich zu einer signifikanten Senkung der Rate an Neuinfektionen gekommen. Interessant ist, dass die ATL meist im höheren Lebensalter auftritt (das Durchschnittsalter der Erkrankten beträgt >60 Jahre). Bei einer vorwiegend perinatalen Infektion muss man also von einer enorm langen Latenzzeit des Virus ausgehen (60 Jahre und mehr). Auch das ist ein wesentlicher Unterschied zu HIV, wo die Zeit zwischen Infektion und Entwicklung von AIDS meist weniger als 10 Jahre beträgt, wenn keine Behandlung erfolgt. Auch muss betont werden, dass es sich bei der adulten T-Zell-Leukämie um eine ganz spezielle Sonderform der T-Zell-Leukämie handelt, die nur in HTLV-I-Endemiegebieten auftritt. In Europa, wo HTLV-I kaum vorkommt, gibt es durchaus auch T-Zell-Leukämien, diese haben aber ursächlich nichts mit HTLV-I zu tun.
Therapie: Eine wirksame Therapie der HTLV-I-Infektion ist nicht bekannt. Bei einer Infektion persistiert das Virus lebenslang im Organismus und kann in der Regel durch das Immunsystem nicht mehr eliminiert werden (das Virusgenom wird bei der Infektion in das Genom der infizierten Zelle eingebaut). Es ist also ein Fehlschluss, anzunehmen, dass jemand, bei dem Antikörper gegen HTLV-I im Blut nachweisbar sind, gegen dieses Virus immun ist. Die Antikörper zeigen im Gegenteil an, dass der Betroffene mit dem Virus Kontakt hatte und dauerhaft infiziert ist (genauso wie bei HIV). Eine wirksame Impfung gegen das Virus existiert bisher nicht.
Die durch HTLV-I ausgelösten Erkrankungen ATL und TSP/HAM müssen entsprechend behandelt werden. Die ATL wird beispielsweise wie eine Leukämie behandelt. Eine antivirale Therapie findet dabei nicht statt. Die Prognose der Erkrankungen ist im allgemeinen ungünstig.
Weblinks:
- Robert Gallo Die Jagd nach dem Virus - AIDS, Krebs und das menschliche Retrovirus. Die Geschichte seiner Entdeckung. S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 1991, ISBN 3-10-024404-4 (seine wissenschaftliche Autobiografie)
- Gallo RC The discovery of the first human retrovirus: HTLV-1 and HTLV-2. Retrovirology 2005, 2:17 (englischsprachiger Übersichtsartikel, frei zugänglich in BioMed Central: Volltext
- Poiesz BJ, Ruscetti FW, Gazdar AF, Bunn PA, Minna JD, Gallo RC. Detection and isolation of type C retrovirus particles from fresh and cultured lymphocytes of a patient with cutaneous T-cell lymphoma. Proc Natl Acad Sci USA 1980; 77: 7415–7419. (PubMed: 6261256, Erstbeschreibung)
Reoviridae
Rotavirus
Rotavirus A-E
| Rotaviren | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||||||||||
Rotaviren oder Rota-Viren gehören zur Familie der Reoviridae. Sie wurden 1973 in Dünndarmbiopsien von erkrankten Kindern entdeckt. Rotaviren sind die häufigste Ursache für schwere Diarrhoen. Bei klinisch relevanten Durchfallerkrankungen sind Rotaviren mit einem Anteil von 35-52% vertreten. In den Entwicklungsländern sterben insbesondere wegen der unzureichenden medizinischen Versorgung nach Schätzungen der WHO etwa 850.000 Kinder im Jahr an einer Rotavirus-induzierten Dehydratation. Rotaviren sind auch im Tierreich weit verbreitet, so haben z.B. Rotavirusinfektionen von Kälbern im veterinärmedizinischen Bereich eine große wirtschaftliche Bedeutung.
Eigenschaften: Rotaviren sind 76nm große RNA-Viren mit einem doppelschaligen Kapsid. Eine Hülle ist nicht vorhanden. Das Genom besteht aus 11 doppelsträngigen RNA-Segmenten von 0,6 bis 3,3kb Länge. Jedes dieser Segmente kodiert ein virales Protein. Durch die Segmentierung des Genoms besteht die Möglichkeit der Reassortantenbildung. Es existieren eine Reihe von Serotypen, Einteilung ist komplex und umfasst Gruppen, Subgruppen, G- und P-Typen.
Klinik: Die Infektion mit Rotaviren erfolgt meist klassisch fäkal-oral. Kontaminierte Lebensmittel oder in einigen Ländern kontaminiertes Trinkwasser spielen eine Rolle. Nach einer Inkubationszeit von 1-3 Tagen treten die klinischen Symptome, häufig Erbrechen, gefolgt von hohem Fieber und Durchfall auf. Bei schweren Krankheitsverläufen kann die Diarrhoe zur lebensbedrohlichen Exsikkose führen und zum Tod innerhalb weniger Stunden durch Dehydratation. Die übliche Erkrankungsdauer kann 6 bis 8 Tage betragen.
Epidemiologie: Rotaviren sind weltweit verbreitet. Bis zum Ende des dritten Lebensjahres haben die meisten Kinder (>90%) bereits eine Rotavirusinfektion durchgemacht. Im Laufe der ersten Lebensjahre werden infolge von Kontakten mit Rotaviren zunehmend Antikörper gebildet. Frühere Erkrankungen können bei einer späteren Reinfektion mit demselben bzw. anderen Rotaviren-Typen vor erneuter Erkrankung schützen. Im Erwachsenenalter treten Erkrankungen vor allem als Reisediarrhoe auf, wobei ca. 20% der Reisediarrhoen durch Rotaviren bedingt sein. Die schwersten Krankheitsverläufe sind in der Altersgruppe zwischen 6 Monaten und 2 Jahren zu finden. In den gemäßigten Klimazonen sind Rotavirusinfektionen hauptsächlich während der Wintermonate zu beobachten, da sich die Erreger im warmen, trockenen Klima der geheizten Wohnungen leichter verbreiten. Außer bei Kindern sind schwere Erkrankungen durch Rotavirusinfektion bei alten Menschen oder Immunsupprimierten zu verzeichnen.
Diagnose: Der Nachweis von Rotaviren erfolgt aus dem Stuhl meist mittels ELISA, Elektronenmikroskopie oder PCR. Virusisolierung, RNA-Elektrophorese und Nukleinsäurehybridisierungsreaktion sind nur in wenigen Laboratorien etabliert. Sofortdiagnostik ist heute mittels Schnelltests ebenfalls möglich.
Prophylaxe: Vorbeugend ist die Einhaltung allgemeiner Hygienestandards, wobei Desinfektionsmaßnahmen im Normalfall wenig Erfolg haben. Als Schutzwirkung ist das Vorhandensein von Antikörpern im Darm entscheidender. Eine Schluckimpfung gegen Rotaviren wurde 1998 in den USA in den normalen Impfplan aufgenommen, aufgrund des Verdachts auf Zunahme von Nebenwirkungen in Form von Darm-Invaginationen jedoch 1999 wieder zurückgezogen. Nach intentiven klinischen Studien sind seit dem 2. Quartal 2006 wieder Rotavirus-Impfungen für unter 3-Jährige in Europa und USA zugelassen, es stehen 2 Impfstoffe unterschiedlicher Hersteller zur Verfügung. Ohne Impfung erkrankt bis zum 5. Lebensjahr nahezu jedes Kind an Rotaviren. Eine spezielle Therapie existiert nicht.
Therapie: Die wichtigste Maßnahme bei einer Exsikkose <5% ist die orale Flüssigkeitszufuhr mit Glucosehaltiger Elektrolytlösung. Gelegentliches Erbrechen spricht nicht dagegen. Ggf. kann eine Magensonde gelegt werden. Wichtig ist es rechtzeitig zu erkennen, wann die Flüssigkeits- und Eletrolytzufuhr intravenös fortgesetzt werden muß. Indikationen für die i.v.-Gabe sind: Schock (bei >10% Exsikkose), die Unfähigkeit der ausreichenden oralen Flüssigkeitszufuhr, Säuglinge mit deutlich beeinträchtigtem Allgemeinzustand und schwere Malnutrition.
Von der Einnahme von Antidiarrhoika ist abzuraten, da diese die Ausscheidung des Erregers verzögern und den Krankheitsverlauf verlängern. Infizierte Kinder dürfen keine öffentlichen Gemeinschaftseinrichtigen, wie z.B. Kindertagesstätten, besuchen. Eine Infektion ist der Kindertagesstätte zu melden.
Weblinks: RKI - Rotaviren
Coltivirus
Colorado-Zeckenfieber-Virus
| Colorado-Zeckenfieber-Virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||
Rhabdoviridae
Rhabdoviridae
| Rhabdoviridae | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||

Viren der Familie Rhabdoviridae (griech. rhabdos = Stab) . All diese Viren sind behüllte Einzel(-)Strang-RNA-Viren mit meist stäbchen- oder geschossförmiger Gestalt.
Systematik: Zu den Rhabdoviren gehören die Gattungen Vesiculovirus, Lyssavirus, sowie Cytorhabdovirus, Ephemerovirus, Novirhabdovirus und Nucleorhabdovirus.
Zu den Vesiculoviren gehört das Vesicular-Stomatitis-Virus (VSV), welches bei Tieren die Stomatitis vesicularis (Mundschleimhautentzündung mit Bläschenbildung) auslöst und auch auf den Mensch übertragbar ist.
Lyssavirus
| Lyssavirus | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
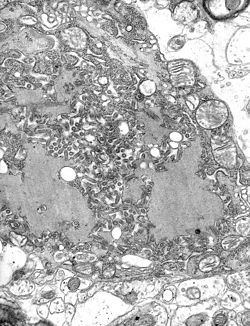 | ||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||||||||||||||
Zu den Lyssaviren gehört das bei Tier und Mensch die Tollwut verursachende Rabiesvirus, das australische Fledermaus-Lyssavirus, das Duvenhage-Virus, zwei europäische Fledermaus-Lyssaviren, das Lagos-Fledermausvirus, sowie das Mokola-Virus.
Tollwut ist eine seit Jahrtausenden bekannte Virusinfektion, die bei Tieren und Menschen eine akute lebensbedrohliche Enzephalitis (Gehirnentzündung) verursacht. Synonyme sind die Begriffe Lyssa, Rabies und Rage. Früher benutzte man auch das Synonym Hydrophobie (Wasserfurcht).
Das Virus kann die meisten warmblütigen Tiere betreffen, ist aber unter Nicht-Fleischfressern selten. Das stereotypische Bild eines infizierten („tollwütigen“) Tieres ist der „verrückte Hund“ mit Schaum vor dem Mund, aber auch Katzen, Frettchen, Füchse, Dachse, Waschbären, Backenhörnchen, Stinktiere und die Fledertiere - Vampire-Fledermaus (Desmodus rotundus bzw. Desmodus sp.); bei insektenfressenden Fledertieren meist Fledermäuse (Microchiroptera) und fruchtfressenden Fledertieren meist Flughunde (Megachiroptera sehr selten) - können tollwütig werden beziehungsweise die klassische Tollwut oder eine andere Form übertragen. Hauptüberträger ist der Fuchs. Eichhörnchen, andere Nagetiere und Kaninchen werden sehr selten infiziert. Vögel bekommen sehr selten Tollwut, da ihre Körpertemperatur höher liegt als es für eine optimale Vermehrung des Virus notwendig ist. Tollwut kann sich auch in einer so genannten „paralytischen“ Form zeigen, bei welcher sich das angesteckte Tier unnatürlich ruhig und zurückgezogen verhält.
Zwischen 40.000 und 70.000 Menschen sterben jährlich an Tollwut, die meisten in Osteuropa, Asien (80%) und Afrika, wo Tollwut endemisch ist. Die Hälfte der Todesfälle weltweit betrifft Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren.[9] Ungefähr 10 Millionen Menschen werden jährlich behandelt nach einem Verdacht, sich der Tollwut ausgesetzt zu haben.[10]
Erreger: Die Tollwut wird durch geschossförmige, behüllte Einzel(-)Strang-RNA-Viren, der Gattung Lyssaviren aus der Familie der Rhabdoviridae verursacht. Derzeit werden sieben Genotypen unterschieden:
- Genotyp 1: Rabiesvirus (RABV) = Tollwutvirus. Dieses Virus ist das klassische Tollwutvirus.
- Genotyp 2: Lagos-Fledermausvirus = Lagos bat virus (LBV)
- Genotyp 3: Mokola-Virus (MOKV)
- Genotyp 4: Duvenhage-Virus (DUVV)
- Genotypen 5 und 6: Europäisches Fledermaus-Lyssavirus = European bat lyssavirus (EBLV 1, 2)
- Genotyp 7: Australisches Fledermaus-Lyssavirus = Australian bat lyssavirus (ABLV)
Ausgenommen Genotyp 2 sind bei allen anderen oben aufgezählten Genotypen Tollwutfälle beim Menschen beschrieben.
Alle bekannten Tollwutviren werden durch Trockenheit, Sonnenlicht und bestimmte Desinfektionsmittel sehr schnell inaktiviert.

Übertragung: Das Virus ist im Speichel eines tollwütigen Tieres vorhanden, der Infektionsweg führt fast immer über Bissverletzungen. Aber auch kleinste Verletzungen der Haut und Schleimhäute können das Eindringen des Virus per Schmier- bzw. Kontaktinfektion ermöglichen. Außer bei der Organtransplantation (3 Fälle in den USA zu Beginn des Jahres 2004 und 3 Fälle in Deutschland Anfang 2005), ist die Übertragung von einer Person zur nächsten bislang nicht beobachtet worden.
Krankheitsverlauf und Symptome: Das Virus dringt im Wundgebiet in die peripheren Nerven ein und wandert Richtung ZNS. Sollte das Virus durch den Biss direkt in die Blutbahn gelangen, kann es das Zentralnervensystem auch sehr schnell erreichen. Nur während der mehr oder minder langen Frühphase, ist noch eine Impfung möglich. Sobald das Virus in die Nerven eingedrungen ist, ist eine Impfung nicht mehr wirksam.

Die Periode zwischen der Infektion und den ersten grippeartigen Symptomen (Inkubationszeit), kann bis zu zwei Jahre dauern, normalerweise sind es jedoch 3 bis 12 Wochen. Es wurden jedoch auch Inkubationszeiten von bis zu 10 Jahren glaubhaft dargelegt.
Das Virus verursacht eine Enzephalitis mit den typischen Symptomen. Eine Myelitis (Rückenmarksentzündung) ist ebenfalls möglich. Bei der Übertragung durch einen Biss in Arm oder Bein äußern sich häufig zuerst Schmerzen an der gebissenen Extremität. Sensibilitätsverlust entsprechend der Hautdermatome ist regelmäßig beobachtet worden. Daher werden viele, vor allem atypische Krankheitsverläufe, zunächst als Guillain-Barré-Syndrom falsch eingeschätzt. Bald danach steigern sich die zentralnervösen Symptome, wie Lähmungen, Angst, Verwirrtheit, Aufregung, weiter fortschreitend zum Delirium, zu anormalem Verhalten, Halluzinationen, und Schlaflosigkeit. Die Lähmung der hinteren Hirnnerven (Nervus glossopharyngeus, Nervus vagus) führt zu einer Rachenlähmung, verbunden mit einer Unfähigkeit zu sprechen (bei Hunden "heiseres Bellen") oder zu schlucken - dies ist während späterer Phasen der Krankheit typisch. Die Schluckstörung wird fälschlicherweise auch als "Hydrophobie" bezeichnet. Auch der produzierte Speichel kann nicht mehr abgeschluckt werden und bildet den Schaum vor Mund oder Maul.
Die Erkrankung kann auch in der "stummen" Form verlaufen, bei der ein Teil der genannten Symptome fehlt. Jedoch findet sich unabhängig von der Verlaufsform bei der Bildgebung mit dem Kernspintomographen eine Aufhellung in der Region des Hippocampus und am Nucleus Caudatus. Fast immer tritt 2 bis 10 Tage nach den ersten Symptomen der Tod ein.
Krankheitsverlauf beim Tier: Nach einer Inkubationszeit von meist 2 bis 8 Wochen treten die ersten Symptome auf und nach 1-7 Tagen tritt der Tod ein.
Erkrankte Haushunde können dabei besonders aggressiv und bissig werden, sind übererregt, zeigen einen gesteigerten Geschlechtstrieb und bellen unmotiviert („rasende Wut“). Später stellen sich Lähmungen ein, die zu heiserem Bellen, Schluckstörungen (starkes Speicheln, Schaum vor dem Maul), Heraushängen der Zunge führen und infolge Lähmung der Hinterbeine kommt es zum Festliegen. Die Phase der „rasenden Wut“ kann auch fehlen und die Tollwut gleich mit den Lähmungserscheinungen beginnen („stille Wut“). Es kommen auch atypische Verläufe vor, die zunächst einer Gastroenteritis gleichen.
Bei der Hauskatze gleicht das klinische Bild dem des Hundes. Häufig zieht sich eine erkrankte Katze zurück, miaut ständig und reagiert aggressiv. Im Endstadium kommt es zu Lähmungen.
Beim Hausrind zeigt sich eine Tollwut zumeist zunächst in Verdauungsstörungen, es kommt zu einer Atonie und Aufgasung des Pansens und Durchfall. Insbesondere bei Weidehaltung muss die Tollwut immer als mögliche Ursache für Verdauungsstörungen in Betracht gezogen werden. Später stellen sich Muskelzuckungen, Speicheln, ständiges Brüllen und Lähmungen der Hinterbeine ein. Bei kleinen Wiederkäuern wie Schafe und Ziegen dominiert die „stille Wut“, es können aber auch Unruhe, ständiges Blöken und ein gesteigerter Geschlechtstrieb auftreten.
Beim Hauspferd kann die Tollwut als „rasende Wut“ mit Rennen gegen Stallwände und Koliken oder als „stille Wut“ mit Apathie auftreten. Die „stille Wut“ kann mit einer Bornaschen Krankheit verwechselt werden.
Beim Hausschwein dominieren Aufregung, andauerndes heiseres Grunzen, Zwangsbewegungen und Beißwut.
Bei Vögeln ist die Krankheit sehr selten und äußert sich in ängstlichem Piepen, Bewegungsstörungen und Lähmungen.
Bei Wildtieren führt eine Tollwut häufig zum Verlust der natürlichen Scheu vor dem Menschen. Im Endstadium kommt es zu Lähmungen der Hinterbeine.
Therapie: Es gibt keine spezifische Therapie. Nach einer Infektion und Überschreitung der Frist für eine Nachimpfung wurde in letzter Zeit eine Behandlung mit antiviralen Medikamenten, Virustatika, und zeitgleichem künstlichem Koma zur Stoffwechselreduzierung versucht. Diese Therapieversuche waren jedoch bisher nicht erfolgreich, da nur einige wenige Patienten eine solche Behandlung mit schwersten Gehirnschäden überlebten. Als erster Mensch, der eine solche experimentelle Therapie nach einer Infektion weitestgehend ohne schwerwiegende Folgeschäden überstanden hat, gilt die US-Amerikanerin Jeanna Giese. Am 12. Mai 2006 starb ein Jugendlicher in Houston, Texas, an Tollwut als Folge eines Fledermausbisses, bei dem diese experimentelle Therapie ebenfalls angewendet wurde.
Vorbeugung: Die Erkrankung kann durch rechtzeitige Impfung verhindert werden. Louis Pasteur entwickelte 1885 die erste Tollwut-Impfung und rettete damit das Leben von Joseph Meister, der von einem tollwütigen Hund gebissen worden war. Heutige Impfstoffe sind relativ schmerzlos und werden in den Arm, ähnlich wie eine Grippe- oder Wundstarrkrampf-Impfung verabreicht. Sie bestehen aus inaktivierten Viren, welche in menschlichen (humanen) diploiden Zelllinien oder Hühnerfibroblasten angezüchtet werden.
Eine Impfung kann auch Stunden nach einem Biss noch erfolgreich sein. Für eine nachträgliche Impfung bleibt mehr Zeit, wenn die Wunde relativ weit vom Kopf entfernt ist und durch den Biss keine venösen Blutgefäße verletzt worden sind. Das Robert-Koch-Institut gibt folgende Richtlinie für die postexpositionelle Impfung vor:
| Grad der Exposition | Art der Exposition | Immunprophylaxe | |
|---|---|---|---|
| durch ein tollwutverdächtiges oder tollwütiges Wild- oder Haustier | durch einen Tollwut-Impfstoffköder | ||
| I | Berühren / Füttern von Tieren, Belecken der intakten Haut | Berühren von Impfstoffködern bei intakter Haut | keine Impfung |
| II | Knabbern an der unbedeckten Haut, oberflächliche, nicht blutende Kratzer durch ein Tier, Belecken der nicht intakten Haut | Kontakt mit der Impfflüssigkeit eines beschädigten Impfstoffköders mit nicht intakter Haut | Impfung |
| III | Jegliche Bissverletzung oder Kratzwunden, Kontamination von Schleimhäuten mit Speichel (z. B. durch Lecken, Spritzer) | Kontamination von Schleimhäuten und frischen Hautverletzungen mit der Impfflüssigkeit eines beschädigten Impfstoffköders | Impfung und einmalig simultan mit der ersten Impfung passive Immunisierung mit Tollwut-Immunglobulin (20 IE / kg Körpergewicht) |
Es sollte versucht werden, das tollwutverdächtige Tier zu fangen und zu isolieren (nicht töten!), da es in Quarantäne verbracht unter veterinärmedizinischer Kontrolle beobachtet werden kann. Tritt nach 10 bis 14 Tagen keine Tollwut auf, war das Tier nicht kontagiös. Falls das Tier erkrankt, kann eine Virusdiagnostik durchgeführt werden. Bei der infizierten Person kann erst nach Ausbruch der Krankheit eine Diagnose gestellt werden.
es besteht die Möglichkeit der aktiven Immunisierung mit einem Totimpfstoff. Dieser wird in mehreren Dosen im Abstand von einigen Tagen bis Wochen in den Oberarm injiziert. Der genaue Impfplan ist präparatabhängig. Die Impfung muss ein Jahr nach dem ersten Impfzyklus einmal wiederholt und danach alle 5 Jahre aufgefrischt werden.
Bei einer Verletzung durch ein tollwutverdächtiges Tier wird zunächst eine passive Immunisierung mit fertigen Antikörpern gespritzt. Gleichzeitig wird mit der aktiven Impfung begonnen. Außerdem muss der Tetanus-Schutz kontrolliert werden. Hilfreich ist auch ein gründliches Waschen der Wunde mit Wasser und Seife, um so viel infektiöses Material wie möglich zu entfernen.
Mythos und Geschichte: In früheren Zeiten war die Tollwut von Mythen, Aberglauben und Irrtümern umgeben und schürte, da die Krankheit fast unweigerlich zum Tod führte, die Ängste und die Phantasien der Menschen. Auch dass die Tollwut vermeintlich durch Wölfe übertragen wurde, trug zur Legendenbildung bei, der Ursprung des Werwolfsglaubens z.B. wurzelt in der Tollwuterkrankung der Menschen. Bereits in der Antike befassten sich Aristoteles und Euripides mit der Krankheit, in der griechischen Götterwelt waren Artemis, Hekate, Aktaion und Lykaon Verkünder, Verbreiter oder Opfer der Tollwut. Sirius, Hauptstern im Sternbild des Großen Hundes, verdankt seinen Namen der Legende, Wegbereiter der Seuche zu sein, im Hochsommer – an den Hundstagen (an denen Sirius in Sonnennähe steht; man nahm früher an, Sonne und Sirius würden in dieser Zeit zusammenwirken) – wurden Hunde, die man mit der Verbreitung der Tollwut in Verbindung brachte, malträtiert und geopfert. Im Mittelalter wurde, ausgehend von Augustinus, der Ursprung der Tollwut beim Teufel gesucht, der heilige Hubertus gilt seit dieser Zeit als Schutzpatron gegen die Tollwut.
Verbreitung und Bekämpfung: Das Tollwut-Virus überlebt in weiträumigen, abwechslungsreichen, ländlichen Tierwelt-Reservoiren. Die obligatorische Impfung von Tieren ist in ländlichen Gebieten weniger wirksam. Besonders in Entwicklungsländern ist es möglich, dass Tiere nicht in Privatbesitz sind; ihre Tötung kann unakzeptabel sein. Schluck-Impfstoffe können in Ködern sicher verteilt werden. Letzteres hat die Tollwut in ländlichen Gebieten Frankreichs, Ontarios, Texas, Floridas und anderswo erfolgreich zusammenschrumpfen lassen.
Um die Verbreitung der Krankheit zu bekämpfen, besteht für den grenzüberschreitenden Reiseverkehr mit kleinen Haus- und Heimtieren (Hunde, Katzen, Frettchen) eine allgemeine Impfpflicht gegen Tollwut. Die von Land zu Land sehr unterschiedlichen zusätzlichen Bestimmungen werden für die Verbringung von Tieren innerhalb der Europäischen Union mit der Einführung des EU-Heimtierausweises ab dem 4. Oktober 2004 vereinheitlicht.
Tollwut ist in vielen Teilen der Welt endemisch, und einer der Gründe für Quarantänezeiten im internationalen Tiertransport war der Versuch, die Krankheit aus unverseuchten Gebieten fernzuhalten. Inzwischen erlauben jedoch viele Industriestaaten, allen voran Schweden, Haustieren unbeschwertes Reisen zwischen den Territorien, sofern die Tiere durch eine entsprechende Abwehrreaktion vorweisen können, gegen Tollwut geimpft worden zu sein.
Deutschland: In Deutschland zeigt die Bekämpfung der Tollwut große Erfolge. Während noch im Jahr 1980 insgesamt 6.800 Fälle gemeldet wurden, waren es im Jahr 1991 noch 3.500, im Jahr 1995 nur 855, im Jahr 2001 noch 50 und 2004 noch 12 gemeldete Fälle. Mit 5 Fällen 2004 am stärksten von der Tollwut befallen ist der Fuchs. Zur Bekämpfung der Tollwut werden in den letzten Jahren so genannte Impfköder entweder von Jagdausübungsberechtigten ausgebracht oder, wie in einzelnen Bundesländern, großflächig aus Flugzeugen abgeworfen.
2004 wurden in Deutschland Tollwutfälle bei Tieren aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein gemeldet.
Am 4. Dezember 2005 wurde in Berlin bei einer von Kindern gefundenen, kranken und später verstorbenen Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) von Tierärzten des Instituts für Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen (ILAT) in Berlin die Tollwut festgestellt. Bei den bei Fledermäusen vorkommenden Tollwuterregern handelt es sich um eigenständige Virustypen. Sie werden als European Bat Lyssavirus (EBL) mit den Varianten 1 und 2 oder Europäisches Fledermaus-Tollwutvirus bezeichnet. Die Fledermaustollwut ist eine eigenständige Erkrankung, die von der Fuchstollwut abzugrenzen ist. Über die Medien erfolgte eine dringende Aufforderung an alle möglichen Kontaktpersonen, sich vorsorglich Impfen zu lassen.
Österreich: Das Österreichische Bundesland Tirol gilt als tollwutfrei (Juni 2005).
Schweiz: Die Schweiz gilt seit 1999 als tollwutfrei. Die Krankheitsfreiheit wurde durch eine gezielte Fuchsimpfkampagne erreicht.
Großbritannien: Von Großbritannien, das strenge Regulierungen bei der Einfuhr von Tieren hat, wurde angenommen, dass es von der Tollwut völlig frei sei, bis 1996 eine einzelne Wasserfledermaus entdeckt wurde, die mit einem tollwutartigen Virus infiziert war, das gewöhnlich nur bei Fledermäusen vorkommt - dem europäischen Fledermaus-Lyssavirus 2 (EBL2). Es gab keine weiteren bekannten Fälle bis September 2002, als in Lancashire eine weitere Wasserfledermaus positiv auf EBL2 getestet wurde. Ein Fledermaus-Schützer, der von der angesteckten Fledermaus gebissen worden war, erhielt eine Postexpositionsbehandlung, woraufhin er nicht an Tollwut erkrankte.
Im November 2002 wurde David McRae, ein Fledermaus-Schützer aus Guthrie, Angus, Schottland, der, wie man glaubte, von einer Fledermaus gebissen worden war, die erste Person, die in Großbritannien seit 1902 an Tollwut verschied. Er starb an der Krankheit am 24. November 2002.
In Großbritannien trugen Hundelizenzen, Tötung von Straßenhunden, Maulkorbpflicht und andere Maßnahmen zur Ausrottung der Tollwut am Anfang des 20. Jahrhunderts bei. In letzter Zeit ist auch die großangelegte Impfung von Katzen, Hunden und Frettchen in einigen Industrieländern bei der Bekämpfung von Tollwut erfolgreich gewesen.
USA: Seit der Entwicklung von wirksamen Impfstoffen für Menschen und Immunglobulin-Behandlungen ist die Zahl der Todesopfer der Tollwut in den USA von 100 oder mehr pro Jahr am Anfang des 20. Jahrhunderts, auf 1-2 pro Jahr gefallen, die größtenteils von Fledermaus-Bissen herrühren.
Am 2. Juli 2004 meldete dpa, dass in den USA die Tollwut von einem Organspender auf die Empfänger übertragen worden war. Drei Patienten, die verseuchte Organe transplantiert bekommen hatten, waren an der Krankheit gestorben. Der Organspender hatte sich durch eine Fledermaus mit dem tödlichen Virus angesteckt, wie die US-Seuchenüberwachungsbehörde CDC in Atlanta berichtet hatte.
Am 12. Mai 2006 starb ein 16-jähriger Schüler in Houston, Texas, an Tollwut nach einem nächtlichen Biss einer Fledermaus, die offenbar durch das offene Fenster flog.
Australien: Australien ist einer von wenigen Teilen der Welt, wo Tollwut nie eingeschleppt worden ist. Jedoch kommt das australische Fledermaus-Lyssavirus natürlicherweise sowohl bei insektenfressenden als auch bei fruchtfressenden Fledermäusen (Flugfüchsen) der meisten Festland-Staaten vor. Wissenschaftler glauben, dass das Virus in Fledermaus-Bevölkerungen überall in der Reihe von Flugfüchsen Australiens gegenwärtig ist.
Indien: Indien ist eines der Länder, in denen viele Tollwutfälle (Indien: ca.30 000/Jahr) bei Menschen bekannt sind. Die Dunkelziffer dürfte weit darüber liegen. Die Übertragung erfolgt dort überwiegend durch Bisse freilaufender Hunde (auch auf dem Land!). Da eine Immunglobulin-Behandlung nicht verfügbar ist, wird fast ausschließlich mit der Postexpositionsmethode behandelt, die möglicherweise nicht so gute Heilungschancen wie die kombinierte Methode verspricht. Bei einem längeren Aufenthalt sollte also an eine vorherige Aktivimpfung gedacht werden (Reisemedizin).
Meldung vom 22. Februar 2005: Nachrichtenmeldungen zufolge haben sich in Deutschland Anfang 2005 drei Empfänger von Organspenden mit Tollwut infiziert. Die Organspenderin hatte sich wahrscheinlich bei einem Indien-Urlaub infiziert und das Virus über die Organe weitergegeben. Fraglich ist, ob die Spenderin schon Anzeichen einer Tollwutinfektion gezeigt hatte, die als Folge Ihres Kokainkonsums fehlinterpretiert worden war.
Sechs Menschen erhielten Organe der Spenderin. Die Empfängerin der Lunge erlag der Infektion am Morgen des 20. Februar 2005, der 70-jährige Nierenempfänger am 21. Februar 2005. Auch der Nieren-Pankreas-Empfänger erlag der Krankheit trotz einer neuartigen Therapie am 7. April 2005. Man vermutet, dass die Erkrankung sich durch die für eine erfolgreiche Transplatation notwendige Immunsuppression sehr schnell ausbreiten konnte.
Die anderen drei Empfänger zeigen bis jetzt keinerlei Symptome. Sie sind aktiv und passiv geimpft, ihre Prognose ist gut. Zwei der Organempfänger haben ein Hornhauttransplantat erhalten, so dass die nötige Immunsuppression und der Operationsstress relativ gering sind, was ein frühzeitiges Ausbrechen der Erkrankung verhindert hat. Der Empfänger der Leber ist vor zirca 15 Jahren gegen Tollwut geimpft worden, so dass die Erkrankungen nicht ausbrechen konnte (Stand: 22. Februar 2005).
Weblinks:
Quellen
- ↑ CHAT-Survey-Studie
- ↑ Viele holen sich beim Partner HIV
- ↑ http://www.hiv-symptome.de
- ↑ http://63.126.384/2002/Abstract/13592.htm
- ↑ http://amedeo.com/lit.php?id=12637625
- ↑ 2006; doi: 10.1126/science.1126531
- ↑ http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=24352
- ↑ http://www.guardian.co.uk/print/0,3858,4770493-106925,00.html
- ↑ . “Fernreisende sind schlecht zu Tollwut informiert”. Ärzte Zeitung, 30.04. 2003.
- ↑ WHO - Rabies
Filoviridae
| Filoviridae | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||
| ||||||||
| Morphologie | ||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||
Zu der Familie Filoviridae gehören meist fadenförmige (lat. filum = Faden), manchmal auch bazillusförmige, behüllte Einzel(-)Strang-RNA-Viren. In ihrer Grundstruktur können diese Viren auch u-förmig gebogen sein. Die Filoviren gehören zu den größten bekannten RNA-Viren, die Länge kann bis zu 14.000nm betragen, der Durchmesser beträgt konstant 80nm. Die Viren besitzen als weitere Besonderheit die beiden Matrixproteine VP40 und VP24.
Innerhalb der Familie werden die Gattungen Marburg-Virus und Ebola-artige Viren mit insgesamt fünf verschiedenen Serotypen beschrieben, die sich auf die serologisch und genetisch unterscheidbaren Gattungen verteilen. Sowohl das Marburg-Virus als auch die Ebola-artigen Viren verursachen beim Menschen eine akute Erkrankung mit hohem Fieber und einer hohen Letalität.
Das Marburg-Virus stammt primär aus Afrika und kommt in den Ländern Uganda, Kenia (West-Kenia) und vermutlich Zimbabwe vor. Eine weitere Ausdehnung wird von Wissenschaftlern für wahrscheinlich gehalten. In Europa wurden 1967 die ersten Erkrankungsfälle dokumentiert.
Bei den Ebola-artigen Viren werden vier Subtypen voneinander unterschieden und jeweils nach den Orten ihres ersten Auftretens benannt. Ausgenommen der Subtyp Reston stammen alle anderen drei Virustypen dieser Gruppe aus Afrika und verursachen beim Menschen, wie schon erwähnt, hämorrhagisches Fieber mit sehr hoher Letalitätsrate und leichter Übertragbarkeit. Der Subtyp Reston stammt ursprünglich aus den Philippinen und verursacht bei Affen eine tödlich verlaufende Erkrankung, bei Menschen erfolgt nur eine subklinische Infektion ohne Krankheitssymptome.
Der natürliche Reservoirwirt für diese Viren ist bislang noch nicht gefunden.
Die Viren schnüren sich aus der infizierten Zelle ab und schädigen sie somit nicht unmittelbar durch Lysierung, ihr genauer Replikationsmechanismus ist noch unbekannt.
Systematik:
- Filoviridae
- Marburg-Virus
- Marburg-Lake Victoria-Virus
- Ebola-artige Viren
- Ebola-Zaïre-Virus
- Ebola-Sudan-Virus
- Ebola-Reston-Virus (nicht humanpathogen)
- Ebola-Côte d'Ivoire-Virus
- Marburg-Virus
Marburgvirus
| Marburgvirus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||||
Das Marburg-Virus ist ein behülltes Einzel(-)Strang-RNA-Virus (Familie Filoviridae, Gattung Marburgviren).
Dieses Virus besitzt meist eine fadenförmige, manchmal auch eine bazillusförmige Gestalt, ist aber auch in seiner Grundstruktur gelegentlich U-förmig gebogen. Es hat eine Länge von etwa 800 nm und einen konstanten Durchmesser von 80nm.
Virulenz: Das Marburg-Virus ist ein hochpathoger Erreger, der beim Menschen das Marburg-Fieber, ein hämorrhagisches Fieber, auslöst. Die Letalität dieser Erkrankung liegt laut dem Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bei mindestens 23 bis 25%, bei Ausbrüchen im Kongo und in Angola lag sie jedoch wesentlich höher (siehe Krankheitsfälle).
Verbreitung: Das Marburg-Virus stammt primär aus Afrika und kommt in den Ländern Uganda, Kenia (West-Kenia) und vermutlich Zimbabwe vor. Eine weitere Ausdehnung wird von Wissenschaftlern für wahrscheinlich gehalten. In Europa wurden 1967 die ersten Erkrankungsfälle dokumentiert.
Übertragung: Das Marburg-Virus wird durch den Austausch von Körperflüssigkeiten und durch Schmier- bzw. Kontaktinfektion übertragen.
Geschichte: Das Virus wurde zuerst im Jahre 1967 bei Laborangestellten in Marburg, später in Frankfurt am Main und Belgrad gefunden. Als am 25. August 1967 mehrere Personen in Marburg starben, wurde die Stadt in eine Art Ausnahmezustand versetzt. Alle, auch die später verstorbenen Infizierten, zeigten zuvor hohes Fieber und erlitten innere Blutungen. Erst Ende November 1967 gelang die eindeutige Identifizierung des bis dahin unbekannten Virus durch Werner Slenczka im Institut für Virologie Marburg. Das neue Virus wurde höchstwahrscheinlich von infizierten Versuchsaffen (Meerkatzen), aus Uganda, in die Labors des Pharmakonzerns Behringwerke im hessischen Marburg eingeschleppt.
Am 21. März 2005 wurde das Marburg-Virus in mehreren Blutproben von Todesopfern in Angola entdeckt. Im April war die Krankheit in sieben Provinzen ausgebrochen. Über 215 Angolaner starben bis dahin bereits am Marburg-Virus. Die meisten Opfer waren jünger als 5 Jahre.

Besonders problematisch ist die Weigerung der Bevölkerung, die Infizierten zu isolieren. Außerdem gehört traditionell bei den Familien zur Bestattung Verstorbener der persönliche Abschied in Form von Umarmung des Toten und anschließend weitere direkte, persönliche Kontakte der Trauergäste untereinander.
Krankheitsfälle:
- 1967: Marburg, Frankfurt am Main, Belgrad: 31 Infizierte, 7 Tote
- 1998 bis 2000: Demokratische Republik Kongo: 149 Infizierte, 123 Tote
- Oktober 2004 bis heute (31. Mai 2005): Angola, Beginn in der Provinz Uige: 388 Infizierte, 324 Tote.[1]
Impfungen: Im April 2006 wurden Forschungsergebnisse von Forschern aus den USA und Kanada veröffentlicht, denen es gelungen ist, einen Impfstoff gegen den Marburg-Virus zu entwickeln. Im Tierversuch bei Rhesusaffen erwies sich der Impfstoff auch in der Post-Expositionsprophylaxe als wirksam. Die Affen, die bei einer Infektion normalerweise nach etwa 12 Tagen verstarben, überlebten nach einer Impfung den Untersuchungszeitraum von 80 Tagen.
Gesetze: Nach § 6 Meldepflichtige Krankheiten des IfSG sind virusbedingte hämorrhagische Fieber mit Namen meldepflichtig.
Weblinks: RKI - Marburgviren-Infektionen
Ebolavirus
| Ebolavirus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||
Das behüllte, einzel(-)strängige, RNA-haltige Ebola-Virus (Familie Filoviridae, Gattung Ebola-artige Viren) ist für die Ebola-Erkrankung verantwortlich. Es infiziert auch Primaten, wie Affen, Gorillas und Schimpansen und löst bei ihnen ein hämorrhagisches Fieber aus.
Merkmale: Dieses Virus besitzt meist eine fadenförmige (lat. filum = Faden), manchmal auch bazillusförmige Gestalt, es kann in seiner Grundstruktur aber auch gelegentlich U-förmig gebogen sein. In seiner Länge variiert es bis zu maximal 14.000 nm, der Durchmesser liegt bei konstant 80 nm. Als weitere Besonderheit besitzt der Erreger die Matrixproteine VP40 und VP24.
Ebola ist fähig, sich in fast allen Zellen des Wirtes zu vermehren. Dabei kommt es aufgrund der schnellen Virensynthese zu einem Viruskristall (Kristalloid), der vom Bereich des Zellkerns nach außen dringt und einzelne Viren nach Lyse der Zelle freiläßt.
Vier Serotypen beziehungsweise Subtypen oder Stämme des Ebolavirus werden unterschieden und jeweils nach den Orten ihres ersten Auftretens benannt: Ebola-Zaïre-Virus, Ebola-Sudan-Virus, Ebola-Côte d'Ivoire-Virus und Ebola-Reston-Virus. Die drei erstgenannten Subtypen verursachen beim Menschen ein hämorrhagisches Fieber mit einer Letalitätsrate von etwa 50 bis 90%.
Das natürliche Reservoir des Virus, ist bis heute nicht zweifelsfrei gefunden. Es gibt jedoch Hinweise auf ein Nagetier.
Der Subtyp Reston löst bei Makaken die Krankheit aus, beim Menschen findet lediglich eine subklinische Infektion statt.
Herkunft: Das Virus stammt aus den tropischen Regenwäldern Zentralafrikas und Südostasiens (Subtyp Reston) und trat erstmals 1976 in Yambuku, Zaire (Demokratische Republik Kongo) und nahezu gleichzeitig im Sudan auf. Es wurde nach dem kongolesischen Fluss Ebola benannt, in dessen Nähe es zum ersten Ausbruch kam. In 55 Dörfern entlang dieses Flusses erkrankten 318 Menschen, von denen 280 starben, welches einer Sterberate von 88% entspricht. Der erste Fall trat in einem Belgischen Missionskrankenhaus auf. Kurz darauf waren fast alle Nonnen und Krankenschwestern erkrankt, sowie die meisten die das Krankenhaus besucht hatten oder noch dort waren. Die Schwestern hatten nur 5 Nadeln, die sie ohne zu desinfizieren für hunderte Patienten verwendeten.
Übertragung: Übertragen wird es bei direktem Körperkontakt und bei Kontakt mit Körperausscheidungen infizierter Personen per Kontakti- bzw. Schmierinfektion. Weiterhin ist eine Übertragung per Tröpfcheninfektion (aorogene Transmission), durch Sexualverkehr und nach der Geburt (neonatale Transmission) möglich, wobei diese Übertragungswege bislang eine untergeordnete Rolle spielen.
Gesetze: Nach § 6 Meldepflichtige Krankheiten des IfSG sind virusbedingte hämorrhagische Fieber mit Namen meldepflichtig. Aufgrund der hohen Letalitätsrate und Infektionsgefahr wird der Erreger in Klasse 4 der Biostoffverordnung eingeteilt.
Weblinks: RKI - Ebolavirus-Infektionen
Quellen
Paramyxoviridae
Die Paramyxoviren sind ebenfalls kugelförmig, aber mit 150-250nm etwas größer als die Orthomyxoviren. Das Virion ist helikal gebaut und besteht aus einer Lipidschicht, die mit "Stacheln" (Spikes) besetzt ist und ein virusspezifisches Antigen trägt. Zu den typischen Vertretern gehören das Masernvirus, das Mumpsvirus und auch das Rinderpest-Virus sowie der Erreger der Newcastle-Krankheit (atypische Geflügelpest) der Vögel.
Systematik der Paramyxoviridae:
- Paramyxoviridae
- Paramyxovirinae
- Paramyxoviren
- Parainfluenzavirus (1, 3)
- Morbilliviren
- Masernvirus
- Rubulaviren
- Parainfluenzavirus (2, 4)
- Mumpsvirus
- Paramyxoviren
- Pneumovirinae
- Pneumoviren
- Humanes Respiratory-Syncytical-Virus (RSV)
- Metapneumoviren
- Humanes-Metapneumo-Virus (HMPV)
- Pneumoviren
- Paramyxovirinae
Paramyxovirinae
Respirovirus/Rubulavirus
Human parainfluenza virus

| Human parainfluenza virus | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||||||||||||
Das weltweit verbreitete Parainfluenzavirus aus der Paramyxoviridae-Familie löst die Parainfluenza aus, ein Krankheitsbild mit grippeähnlichen Symptomen. Die Durchseuchungsrate bei Kindern bis 10 Jahren liegt bei 90%. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion. Parainfluenza kann eine bakterielle Superinfektion nach sich ziehen. Der Infektionsverlauf ist stark von der Disposition und Konstitution abhängig. Parainfluenza-Viren kommen in vier Serotypen vor. Das Virus besitzt eine einsträngige RNA und trägt Hämagglutinine und Neuraminidase in der Lipidhülle.
Morbillivirus
| Morbillivirus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||
Morbillivirus ist eine Virus-Gattung aus der Paramyxoviridae-Familie. Es handelt sich um hochinfektiöse, behüllte Viren mit einem helikalen Nukleokapsid. Das Genom besteht aus einer einzelsträngigen, nicht-segmentierten RNA negativer Polarität. Die Virushülle trägt Spikes aus Glycoproteinen mit Hämagglutinin-, Neuraminidase- und hämolytischer Aktivität.
Die Virus-Replikation vollzieht sich im Zytoplasma und in der Zellmembran infizierter Zellen.
Morbilliviren sind meist empfindlich gegenüber Wärme, Austrocknung, fettlösenden Stoffen und den meisten Desinfektionsmitteln.
Arten:
- Masern-Virus
- Pest der kleinen Wiederkäuer-Virus
- Rinderpest-Virus
- Staupe-Virus
- Seehund-Staupevirus
Masernvirus
| Morbillivirus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||||
Das Masernvirus ist ein ausschließlich humanpathogener, etwa 120–140nm großer Erreger aus der Familie der Paramyxoviren (Genus Morbillivirus). Der Mensch der einzige Reservoirwirt, der Erregers wird nur von Mensch zu Mensch übertragen, so dass eine Ausrottung leicht möglich wäre. Von ihm gibt es mehrere stabile Genotypen, in Mitteleuropa C2 und D6, die eine Verfolgung der globalen Infektionswege ermöglicht. Weiterhin existiert nur ein stabiler Serotyp, was die Impfstoffherstellung einfacher gestaltet. Die Lipidhülle, die zur hohen Kontagiosität beiträgt enthält das Glykoprotein Hämagglutinin, jedoch keine Neuraminidase. Das Virus reagiert sehr empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen wie erhöhten Temperaturen, Licht, UV-Strahlen, Detergenzien und Desinfektionsmitteln.
Krankheitsbild: Das Masernvirus löst die Masern (Morbilli) aus, eine hochansteckende, systemische Infektionskrankheit, die nach überstandener Erkrankung eine lebenslange Immunität hinterlässt.
Geschichte: Erste Berichte über die Masern gehen auf das 7. Jahrhundert zurück und werden dem jüdischen Arzt Al-Yehudi zugeschrieben. Die erste ausführliche Beschreibung der Masern verdanken wir dem persischen Arzt Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi [1], Anfang des 10. Jahrhunderts, der angab, sie würden „mehr gefürchtet als die Pocken“.
Den Namen „Morbilli“, was so viel wie „kleine Pest“ bedeutet, erhielten die Masern während der ausgedehnten Epidemien des Mittelalters, da damals wie heute viele Kinder an den Masern starben. 1882 veröffentlichte der französische Arzt Antoine Louis Gustave Béclère seine Aufsehen erregende Arbeit „Die Ansteckung mit Masern“.
1954 wurde das Virus erstmalig isoliert, ab 1963 war der erste Impfstoff erhältlich. Zuvor bekam aufgrund der hohen Kontagiosität des Erregers beinahe jeder die Masern: Es handelte sich um ein Ereignis im Leben, das unweigerlich - meist schon im Kindesalter - auftrat und auf das man warten konnte. Mehr als die Hälfte der Kinder bekam die Masern vor dem 6. und 90% vor dem 15. Lebensjahr. Hatte man die Krankheit überstanden, so war man für den Rest des Lebens immun.
Epidemiologie: Der Erreger kommt weltweit vor und ist in mehreren Entwicklungsländern noch weit verbreitet. In verschiedenen Ländern wurde er durch gut organisierte Impfkampagnen bereits ausgerottet. 1984 legte die WHO einen Zeitplan für die Elimination der Masern bis zum Jahr 2000 fest – tatsächlich starben 2003 jedoch weltweit nach Angaben der WHO noch etwa 530.000 Menschen – davon die Mehrzahl Kinder – an Masern. Maserninfektionen sind für ungefähr die Hälfte aller durch Impfung vermeidbaren Todesfälle verantwortlich. Der neue Zeitplan sieht die weltweite Ausrottung des Virus – bei entsprechender Anstrengung – jetzt für das Jahr 2007 vor. Rückblick:
- Die Anzahl der Masernerkrankungen in den USA sank von 800.000 im Jahre 1958 auf einige wenige Fälle in den letzten Jahren, wobei alle Erreger von ungeimpften Personen aus Europa und Asien importiert worden waren, was durch die Bestimmung des Genotyps nachgewiesen werden konnte. Einen dramatischen Anstieg der Fälle gab es in den Jahren 1989–1991, wo binnen drei Jahren über 55.622 Erkrankungsfälle berichtet wurde, von denen 123 tödlich endeten. Hauptsächlich waren Kleinkinder aus hispanoamerikanischen und afroamerikanischen Familien betroffen, wo die Rate an ungeimpften Kindern 4–7x höher lag als bei den Betroffenen der übrigen weißen Bevölkerung. Zwischenzeitig treten genuine Masernerkrankungen in allen amerikanischen Staaten von Kanada bis Argentinien mit Einschluss der Karibik kaum noch auf.
- In Finnland mit seinen 5,2 Mio. Einwohnern gab es von 1996 – 2000 vier Masernfälle. Auch diese waren aus dem Ausland importiert.
- In Deutschland wurden im Jahre 2005 778 Masernfälle gemeldet. 2005 kam es in Deutschland zu zwei größeren Masernausbrüchen, im Februar starb ein 14-jähriges Mädchen in Hessen, im Mai wurden 110 Fälle aus Oberbayern gemeldet. Anfang 2006 wurden Masernhäufungen aus Nordrhein-Westfalen (bisher 1.354 Fälle bis 31. Mai, Schwerpunkte in Duisburg, Mönchengladbach und im Kreis Wesel) und Baden-Württemberg (bisher 83 Fälle bis zur Kalenderwoche 15, Schwerpunkt in Stuttgart und im Kreis Esslingen) gemeldet. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass eine hohe Dunkelziffer existiert und die Zahl der Krankheitsfälle wesentlich höher liegt als die der Meldungen.
- In Österreich, das für Masern bis 2001 keine Meldepflicht kannte, wurde vom Institut für Virologie des AKH in Wien ein freiwilliges Meldesystem geschaffen, das etwa 8% der österreichischen Bevölkerung abdeckt. Somit konnten für den Zeitraum von 1993–1997 etwa 28.000–30.000 Masernfälle für ganz Österreich hochgerechnet werden, wobei besonders 1996 und 1997 ein beinahe epidemisches Auftreten von Masernerkrankungen zu verzeichnen war. Insgesamt dürfte die Durchimpfungsrate in Österreich somit nur unwesentlich besser sein als in Deutschland. Wären die Richtlinien hier ähnlich streng wie in den USA, würde man schon 2.700 Erkrankungen in fünf Jahren nicht mehr akzeptieren.
- In Rumänien kam es zwischen dem 1. Dezember 1996 und dem 30. September 1997 zu einer Masern-Endemie mit 20.034 Erkrankungen und 13 Todesfällen.[2] Im Dezember 2005 gab es eine neuerliche Masernepidemie in Rumänien. Etwa 4000 Kinder waren erkrankt, 10 gestorben [3].
Diagnose: Die Diagnose ist in unkomplizierten Fällen nur über den serologischen Nachweis von IgM-Antikörpern zu führen. Dies wird heute methodisch meist mit Hilfe eines Enzymimmunoassay (ELISA) erreicht, in manchen Labors wird auch noch die Komplementbindungsreaktion (KBR) oder der Hämagglutinationshemmtest (HHT) durchgeführt.



Der direkte Erregernachweis (RT-PCR aus Virus-RNA oder Virusanzucht in Zellkulturen) ist aufwändiger als der indirekte Antikörpernachweis und bleibt eher spezielleren Fragestellungen vorbehalten.
Die Diagnose anhand des „typischen“ Masernexanthems ist mit einer Fehlerhäufigkeit von 50% behaftet. Im Epidemiefall kann die Diagnose dennoch häufig klinisch gestellt werden, insbesondere von erfahrenen Untersuchern.
Meldepflicht: In Deutschland sind durch das 2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz (IfSG, § 6) Krankheitsverdacht, Erkrankung und Tod ebenso wie der direkte oder indirekte Nachweis des Masernvirus mit Namen meldepflichtig geworden. Bei Krankheitsverdacht oder Erkrankung besteht Tätigkeits- und Aufenthaltsverbot in Gemeinschaftseinrichtungen.
In Österreich besteht Meldepflicht seit Dezember 2001 (BGBl. II Nr. 456/2001 Verordnung: Anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten).
In der Schweiz besteht seit März 1999 Meldepflicht (Melde-Verordnung, SR 818.141.1).
Krankheitsverlauf/Symptome: Typisch für die Masern ist ein zweiphasiger Krankheitsverlauf: Auf die Inkubationszeit von 10 bis 14 Tagen folgt das 3–4 Tage dauernde, uncharakteristische Prodromalstadium, auch Initialstadium genannt. Dieses äußert sich durch eine Entzündung der Schleimhäute des oberen, teilweise auch des mittleren Atemtraktes und der Augenbindehäute. Die katarrhalischen Beschwerden umfassen Rhinitis, trockene Bronchitis, Konjunktivitis, Fieber bis 41°C, Übelkeit, Hals- und Kopfschmerzen kommen. Erst danach, etwa am 12. – 13. Tag, geht die Krankheit in das typische Exanthemstadium über, in dem ein Schleimhaut-Enanthem am weichen Gaumen auftreten kann. Typisch sind auch die sog. Koplikflecken an der Wangenschleimhaut gegenüber den Prämolaren. Der Fieberverlauf ist häufig zweigipflig, wobei der erste Gipfel während des Prodromal-, der zweite während des Exanthemstadiums auftritt.
Am 14.–15. Tag breitet sich ein makulopapulöses, zum Teil konfluierendes Exanthem – hinter den Ohren (retroaurikulär) beginnend – innerhalb von 24 Stunden von oben nach unten über den ganzen Körper aus. Nach weiteren 4 – 5 Tagen bilden sich die Symptome in der Regel zurück. Als Überbleibsel des Exanthems kann eine kleieförmige Schuppung für kurze Zeit bestehen bleiben. Begleitend treten häufig Lymphknotenschwellungen auf.
Atypische Verläufe kommen in verschiedenen Situationen vor: Säuglinge mit Leihimmunität durch mütterliche Antikörper oder Patienten, die Antikörperpräparate erhalten haben, erkranken an mitigierten (abgeschwächten) Masern. Bei Personen mit Immundefizienz kann der Verlauf nach außen hin atypisch oder symptomarm sein, so kann beispielsweise der typische Hautausschlag fehlen („weiße Masern“), während sich innerlich z.B. eine progrediente Riesenzellpneumonie oder die Masern-Einschlusskörper-Enzephalitis entwickeln kann, die mit einer Letalität von etwa 30% verbunden ist.
Während und nach der Erkrankung an Masern kommt es regelhaft zu einer insgesamt 4–6 Wochen dauernden Immunschwäche. Diese kann anderen Infektionserregern den Weg bereiten und stellt daher eine zusätzliche Gefahr für das erkrankte Kind dar.
In unkomplizierten Fällen folgt eine rasche Erholung und eine lebenslang anhaltende Immunität.
Komplikationen: Etwa 20% aller Maserninfektionen gehen mit Komplikationen einher, wobei Mittelohrentzündungen und Lungenentzündungen die häufigsten sind. Das Robert-Koch-Institut gibt an, dass die Letalität bei Masern der Literatur zufolge bei 1:10.000 bis 1:20.000 liege, bei einem Ausbruch in den Niederlanden 1999/2000 starben drei von knapp 3.000 Betroffenen, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geben für die USA eine Sterblichkeit von ca. 1:500 bis 1:1.000 an. In Entwicklungsländern liegt die Letalität wesentlich höher (laut Literaturangaben bis zu 25%). Zum Tode führende Komplikationen sind meist die Masernpneumonie oder die Masernenzephalitis.
Masernkrupp
Durch eine Kehlkopfentzündung mit Schwellung der Schleimhaut kommt es zu Heiserkeit und Atemnot bereits im Vorstadium (DD.: Pseudokrupp).
Masernpneumonie
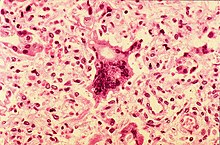
1. Primäre Masernpneumonie: Dabei handelt es sich um eine interstitielle Pneumonie mit Bronchiolitis, die sich hauptsächlich als Atemstörung äußert. Mittels körperlicher Untersuchung ist sie schwer zu diagnostizieren, so dass ein Röntgenbefund erforderlich ist.
2. Bronchopneumonie als bakterielle Superinfektion: Sie tritt insbesondere nach oder bei einer interstitiellen Viruspneumonie auf, ist aber auch isoliert möglich durch die masernbedingte Immunsuppression (s. o.).
3. Riesenzellpneumonie: Eine seltene Pneumonie mit vielkernigen, von den Alveolarepithelien abstammenden Riesenzellen, pathognomonisch für Masern (Masernriesenzellen) und Keuchhusten, selten auch bei Diphtherie oder Grippe zu beobachten.
Keratitis
Die Entzündung der Hornhaut mit multiplen, punktförmigen, epithelialen Läsionen ist eine weitere Komplikation der Masern. In Entwicklungsländern sind die Masern eine der häufigsten Ursache der Erblindungen von Kindern (besonders im Zusammenhang mit Vitamin-A-Mangel).
Enzephalomyelitis
Die akute postinfektiöse Enzephalitis tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von in 0,1 % auf. Die Entzündung des Gehirns und seiner Häute entwickelt sich 3–10 Tage nach Exanthembeginn, bei Patienten über sechs Jahren häufiger als bei Kleinkindern. Symptome sind Fieber, Kopfschmerz, Bewusstseinstrübung und meningeale Reizung (Nackensteifigkeit, Erbrechen) mit Rückgang nach 1–3 Tagen. Bei leichten Formen ist keine Krankenhauseinweisung notwendig. Schwere Verlaufsformen äußern sich in epileptischen Anfällen und neurologischen Funktionsstörungen. Die Ausbreitung ist herdförmig oder diffus. Häufigkeit: Nach Einführung der Masernimpfung sank die Zahl ständig und liegt derzeit in Deutschland bei < 10/Jahr. Letalität: 20%; Defektheilungen: 20–40%.
Subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE)
Die SSPE ist eine generalisierte Entzündung des Gehirns. Sie ist selten, endet aber in 100% der Fälle letal. Die Angaben über die Häufigkeit von SSPE schwanken zwischen 7–11 Fälle pro 100.000 Masernfällen. Die Erkrankung tritt Monate bis zu zehn Jahre, im Durchschnitt 6-8 Jahre nach einer Maserninfektion auf. Die absolute Häufigkeit der SSPE ist durch die Masernimpfung deutlich reduziert worden. Der Verlauf ist langsam progredient über 1–3 Jahre (slow virus infection), in 10% tritt ein akuter Verlauf (3–6 Monate) auf, in weiteren 10% ein langsamerer Verlauf (länger als drei Jahre).
1. Stadium: psychische Störungen und Demenz 2. Stadium: Myoklonien, epileptische Anfälle 3. Stadium: Dezerebrationssyndrom
Im EEG finden sich typische Veränderungen, die nahezu wegweisend für die SSPE sind (Radermecker-Komplex). Mittlerweile wurde ein Masernvirus mit einem defekten M-Protein isoliert: „SSPE-Virus“
Weitere Komplikationen:
Innenohrschädigung mit Ertaubung, Diarrhoe, Blinddarmentzündung, generalisierte Lymphadenitis, Thrombozytopenische Purpura.
Vorbeugung:
Quarantäne
Nach dem deutschen Infektionsschutzgesetz (IfSG, §9) aus dem Jahre 2001 dürfen infizierte Kinder solange nicht die Schule oder den Kindergarten besuchen, bis sie keine Viren mehr ausscheiden.
Impfung
Die Impfung gegen Masern wird üblicherweise als Masern-Mumps-Röteln-Kombinationsimpfung (MMR-Impfstoff) durchgeführt, in der Regel zwischen dem 12. und 15. Lebensmonat, möglichst bis zum Ende des 2. Lebensjahres, um den frühestmöglichen Impfschutz zu erreichen. Damit ist nach einmaliger Impfung bei 90 % der Kinder ein ausreichender Impfschutz vorhanden. Da bei einer Durchimpfungsrate von weniger als 95 % mit sporadischen Masernepidemien (alle drei bis sieben Jahre) zu rechnen ist, müssen mit einer zweiten Impfung – frühestens vier Wochen nach der ersten – Impflücken geschlossen werden, um Impfversagern den entsprechenden Impfschutz zu gewähren. Nach dem Impfkalender der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut ist die zweite MMR-Impfung bei allen Kindern im Alter von 15–23 Monaten vorgesehen.
Steht bei einem Kind die Aufnahme in eine Kindereinrichtung an, kann die MMR-Impfung auch vor dem 12. Lebensmonat, jedoch nicht vor dem 9. Lebensmonat erfolgen, da im 1. Lebensjahr im Blut des Säuglings noch vorhandene mütterliche Antikörper die Impfviren neutralisieren können (Lebendimpfung, die Vermehrung der Impfviren ist erforderlich). Sofern die Erstimpfung vor dem 12. Lebensmonat erfolgte, sollte die MMR-Impfung bereits im 2. Lebensjahr wiederholt werden.
Auch wenn von Eltern oder Impflingen angegeben wird, dass eine Masern-, Mumps- oder Rötelnerkrankung bereits durchgemacht wurde, sollte die zweite MMR-Impfung durchgeführt werden. Anamnestische Angaben über eine Masern- oder Rötelnerkrankung sind ohne mikrobiologisch-serologische Dokumentation der Erkrankungen unzuverlässig und nicht verwertbar. Es gibt keine Hinweise auf Nebenwirkungen nach mehrmaligen Masern-, Mumps- oder Rötelnimpfungen.
Die Eliminierung der Masern ist ein erklärtes Ziel der deutschen Gesundheitspolitik. „Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die zweite MMR-Impfung so früh wie möglich, spätestens jedoch bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nachgeholt wird; bei Mädchen wird damit auch der unverzichtbare Schutz vor einer Rötelnembryopathie gesichert.“[4]
Österreich: Zwei Teilimpfungen im 2. Lebensjahr mit einem Mindestabstand von einem Monat. Wiederholungen der Impfung werden bei Schuleintritt im 7. Lebensjahr und im 13. Lebensjahr vom öffentlichen Gesundheitsdienst kostenlos angeboten. (Österreichischer Impfplan 2006)
Impfkomplikationen
Von Impfreaktionen sind die Impfkomplikationen abzugrenzen, die zu vorübergehenden oder anhaltenden Schäden oder gar zum Tod führen können. Prinzipiell ist ein direkter Zusammenhang mit einer Masernimpfung schwer zu beweisen. So soll bei einer von 200.000 Impfungen ein Impfschaden mit bleibenden Folgen auftreten und auf ca. 500.000 Impfungen ein Todesfall kommen. Da es sich bei der Masernimpfung um eine Impfung mit einem abgeschwächten Lebendimpfstoff handelt, können in 3–5 % der Fälle so genannte Impfmasern auftreten. Diese stellen eine abgeschwächte Form der Masern dar: eine Konjunktivitis, eine Tracheitis, ein feinfleckiger Hautausschlag und sehr selten eine Otitis media können auftreten. Schwerwiegendere Folgen bei besonders empfänglichen Kindern sind denkbar oder möglich.
Fieber und lokale Impfreaktionen wie Rötung, Schmerzen und Schwellungen an der Injektionsstelle können wie bei allen Impfungen vorkommen und sind als harmlose Nebenwirkungen zu betrachten.
Weblinks: RKI - Masern
Rubulavirus
Mumpsvirus
| Mumps virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||||
Mumps (Parotitis epidemica, Salivitis epidemica), umgangssprachlich auch Ziegenpeter genannt, ist eine ansteckende Virusinfektion, die durch den Erreger Paramyxovirus parotitis, ein umhülltes RNA-Virus aus der Familie der Paramyxoviridae, Genus Paramyxovirus, verursacht wird. Die Mumps zählt zu den Kinderkrankheiten.
Epidemiologie: Mumps kommt auf der ganzen Welt endemisch vor. Der Mensch ist das einzige Erregerreservoir. Vor Einführung der allgemein empfohlenen Impfung erkrankten die meisten Kinder zwischen dem zweiten und 15. Lebensjahr, Jungen häufiger als Mädchen. Seit Einführung der Impfung ging die Zahl der Erkrankungen drastisch zurück. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion, direkten Kontakt oder seltener durch speichelverschmutzte Gegenstände. Das Virus wird auch im Urin und der Muttermilch ausgeschieden. Patienten sind drei bis fünf, maximal sieben Tage vor Ausbruch der Erkrankung bis in die frühe Rekonvaleszenz, aber maximal bis zum neunten Tag nach Ausbruch der Erkrankung kontagiös. Die Parotitis epidemica hinterlässt in der Regel eine lebenslange Immunität. Zweiterkrankungen sind möglich, aber selten. Die Inkubationszeit beträgt zwölf bis 25, im Mittel 16 bis 18 Tage.
Symptome: Die Mumps zeigt eine große Variabilität im Erscheinungsbild. Mindestens 30 bis 40% der Infektionen verlaufen symptomlos (stille Feiung). Am häufigsten treten Fieber und eine ein- oder noch häufiger beidseitige entzündliche Schwellung der Ohrspeicheldrüse (Parotitis) auf. Nicht selten sind auch andere Speicheldrüsen (einschließlich der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis)) betroffen. Das zentrale Nervensystem ist klinisch relevant in drei bis 15% in Form einer aseptischen Meningitis betroffen. Diese kann bereits eine Woche vor bis zu drei Wochen nach Beginn der Ohrspeicheldrüsenentzündung oder auch isoliert auftreten. Während oder nach der Pubertät kommt es bei 25 bis 30% der männlichen Betroffenen zu einer Hodenentzündung (Mumpsorchitis). Diese beginnt am Ende der ersten Krankheitswoche mit erneutem Fieberanstieg, starker Schwellung und Druckschmerzhaftigkeit meist nur eines Hodens. Seltene Manifestationen sind Eierstockentzündung, Schilddrüsenentzündung, Entzündung der Iris, Herzmuskelentzündung, Nierenentzündung und Mumpsenzephalitis.
Komplikationen: Mumps ist eine akute, selbstlimitierende, gutartige Erkrankung. Todesfälle kommen heutzutage praktisch nicht mehr vor. Chronische Erkrankungen des Zentralnervensystems werden vereinzelt beschrieben. Nach Mumpsmeningitis kann in etwa 1:10.000 Infektionen eine Innenohrschwerhörigkeit auftreten. Auch die Mumpsenzephalitis kann z.B. Lähmungen als bleibende Schäden verursachen. Nach Mumpsorchitis kann es zu einer einseitigen Hodenatrophie kommen. Unfruchtbarkeit ist jedoch ungewöhnlich. Nach heutiger Auffassung besteht kein direkter kausaler Zusammenhang zwischen Mumps und Diabetes mellitus Typ I. Bei Mumps während der Schwangerschaft ist im ersten Drittel mit einer erhöhten Rate an Aborten zu rechnen. Eine Mumpsembryopathie ist nicht bekannt. Neugeborene und junge Säuglinge erkranken selten. Unbehandelt kann die Krankheit auch zum Tode führen.
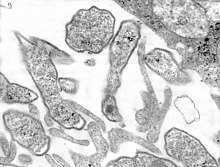

Diagnose: Bei typischer Symptomatik im Rahmen einer Epidemie kann die Diagnose klinisch gestellt werden. Im Einzelfall kann die Diagnose durch Bestimmung der spezifischen Antikörper im Serum bestätigt werden (z.B. mittels ELISA). In besonderen Fällen ist auch die Virusanzucht oder der Nachweis mumpsspezifischer RNA durch PCR aus Rachenabstrich, Speichel, Liquor, Urin oder Biopsiematerial möglich. Ein hinweisender Befund kann die Erhöhung der S-Amylase sein. Die Immunität einer Person kann leicht durch Bestimmung mumpsspezifischer IgG-Antikörper festgestellt werden.
Therapie: Es gibt keine spezifische antivirale Behandlung. Eine symptomatische Behandlung ist selten erforderlich und beschränkt sich meist auf fiebersenkende Maßnahmen. Bei schweren Verläufen sind unter Umständen Kortikosteroide indiziert.
Prophylaxe: Es existiert eine Lebendimpfung aus abgeschwächten, auf Hühnerfibroblasten gezüchteten Mumpsviren. Er ist entweder als monovalenter Impfstoff oder in Kombination mit abgeschwächten Masern- und Röteln-Viren erhältlich. Die exakte Dauer des Impfschutzes ist nicht bekannt. In der Regel wird die Impfung sehr gut vertragen. Gelegentlich kann kurzdauerndes Fieber und eine leichte Schwellung der Ohrspeicheldrüse auftreten. Eine Impfmeningitis kommt beim heutzutage verwendeten Impfstamm nicht mehr vor. Die Mumpsimpfung gehört in Deutschland zu den von der STIKO allgemein empfohlenen Impfungen und soll als Kombinationsimpfung mit der Masern- und Röteln-Impfung (MMR) ab dem elften bis zum 14. Lebensmonat und eine Wiederholungsimpung zur Schließung von Impflücken frühestens vier Wochen nach der ersten Impfung verabreicht werden. Gegenanzeigen gegen die Impfung sind Schwangerschaft, allergische Reaktionen auf Impfstoffbestandteile und angeborene oder erworbene T-Zell-Defekte. Eine gesicherte Hühnereiweißallergie stellt allerdings keine Kontraindikation dar! Auch Personen mit humoralen Immundefekten, Granulozytenfunktionsstörungen, Asplenie oder asymptomatischer HIV-Infektion dürfen geimpft werden. Nach Mumpskontakt kann eine Erkrankung durch eine Impfung in der frühen Inkubationszeit nicht sicher verhindert werden. Dennoch wird die Impfung empfohlen, da sie vor Ansteckung bei nachfolgender Exposition schützt. Spezielle Mumpsimmunglobuline zur passiven Impfung gibt es nicht. Hospitalisierte Patienten mit Mumps sollen von anderen Patienten getrennt werden. Nach Abklingen der Symptome können Kinder frühestens neun Tage nach Ausbruch der Erkrankung Gemeinschaftseinrichtungen wieder besuchen.
Weblinks: RKI - Mumps
Pneumovirinae
Pneumovirus
Human respiratory syncytial virus (RSV)
| Human respiratory syncytial virus | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||||||
Das humane respiratorische Synzytial-Virus (RSV, Typ A und B) ist ein behülltes Virus mit einzelsträngiger Minus-RNA aus der Gruppe der Paramyxoviren.
Es wird meistens über Tröpfcheninfektion übertragen und verursacht obere Atemwegsinfekte mit Schnupfen, Husten, Bronchitis und Mittelohrentzündung. Es gibt auch tierpathogene Stämme, die Infektion von Kälbern mit bovinen RSV hat einen ähnlichen Verlauf wie beim Kleinkind und wird aus diesem Grunde zu Modelluntersuchungen zur Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika genutzt.
Die Infektion kann akut verlaufen und in schweren Fällen eine intensivmedizinische Überwachung notwendig machen. Das Virus lässt sich mittels immunologischer Testverfahren (ELISA) nachweisen. Zur Therapie eignet sich dann evtl. das Virostatikum Ribavirin, dessen Wirkung in Placebo-Studien jedoch nicht belegt werden konnte.
Eine Erkrankung erzeugt keine andauernde Immunität, es kann lebenslang zu Re-Infektionen kommen, die bei gesunden Menschen milde verlaufen. Für immungeschwächte Menschen mit hohem Risiko besteht die Möglichkeit einer passiven Immunisierung, die (aus Kostengründen) nur speziellen Risikofällen vorbehalten ist. Diese erzeugt auch lediglich eine Wirkungsdauer von ca. einem Monat.
Weblinks: RKI - Erkrankungen durch Respiratory Syncytial Viren (RSV)
Quellen
- ↑ http://www.medicine-worldwide.de/persoenlichkeiten/al_razi.html
- ↑ http://www.cdc.gov/nip/diseases/measles/history.htm
- ↑ http://www.dgk.de/web/dgk_content/de/masern_12-05.htm
- ↑ Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) Juli 2005
Orthomyxoviridae
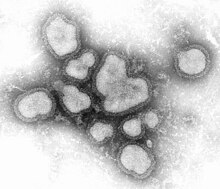
Myxoviren (von gr. myxa = Schleim) sind eine wichtige Virenfamilie, die die Atemwege von Säugetieren und Vögeln befallen. Ihr Genom besteht aus einzelsträngiger RNA negativer Polarität, d.h. die Virus-RNA ist zur später produzierten mRNA komplementär. Die Myxoviren werden unterteilt in die Familien Orthomyxoviridae und Paramyxoviridae.
Orthomyxoviridae
Die behüllten Orthomyxoviren sind meist kugelförmig und haben eine Größe von 80-120nm. Die Oberfläche ist mit Spikes besetzt. Wichtigster Vertreter dieser Gruppe ist das Influenzavirus, das die echte humane Grippe auslöst. Insgesamt hat diese Familie mittlerweile fünf Gattungen:
1.) Influenza-A-Viren sind die wichtigsten humanpathogenen Grippeviren, zu dieser Gruppe gehören z.B. H1N1, H3N2 und H5N1. Influenza-A-Viren befallen üblicherweise jeweils nur bestimmte Wirte. Neben dem Menschen auch verschiedene Säugetierarten wie Schwein, Pferd (vgl. Pferdegrippe), Nerz, Seehund und Wal sowie zahlreiche Vogelarten. Das primäre Reservoir aller Influenza A-Viren liegt im Wassergeflügel.
2.) Influenza-B-Viren befallen nur den Menschen und spielen eine geringere medizinische Rolle.
3.) Influenza-C-Viren befallen Mensch und Schwein, allerdings spielt das Virus für den Menschen keine große Rolle, da es wenn überhaupt nur zu milden Erkrankungen führt.
4.) Thogotovirus: Die lineare, einzelsträngige RNA dieses nicht humanpathogenen Virus besitzt nur sechs Segmente und wird durch Zecken übertragen. Verbreitet ist diese Virusgattung in Afrika, Asien und Südeuropa. Befallen werden vor allem Schafe, Rinder, Ziegen und Nagetiere bei denen das Virus zu fiebrigen Erkrankungen mit Aborten führt.
5.) Isavirus: In diese neu geschaffene Gattung wurde das Virus der infektiösen Anämie der Lachse eingeordnet.
Influenza-Viren
| Influenza-Viren | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||||||||
Influenza, auch „Grippe“, ist eine Erkrankung, ausgelöst durch eine von drei Influenza-Virusgattungen (A, B, C). Der Name „Influenza“ (von ital. influenza: Einflüsse der Gestirne, der Kälte) leitet sich von der bis ins Mittelalter vorherrschenden medizinisch-astrologischen Vorstellung ab, Krankheiten seien durch bestimmte Planetenstellungen beeinflusst. Erst seit dem 15. Jahrhundert bleibt der Name der „echten Grippe“ vorbehalten, einer oft tödlichen Virusinfektion.
Im Volksmund wird die Bezeichnung Grippe häufig für weit harmlosere grippale Infekte (Erkältungen) verwendet.
Morphologie und Eigenschaften: Der 1930 erkannte Erreger der Influenza ist das Influenza-Virus, ein behülltes Einzel(-)Strang-RNA-Virus aus der Familie der Orthomyxoviren, die insgesamt fünf Gattungen enthält.
Das Genom fast aller Influenzaviren besteht aus 8 RNA-Segmenten negativer Polarität. Die Segmentierung des Genoms als Grundlage genetischer Reassortierung ist (neben der hohen Mutationsfrequenz) für die erhebliche genetische Variabilität der Influenzaviren verantwortlich.
Die Segmente kodieren zehn virale Proteine: Hämagglutinin HA, Neuraminidase NA, Nukleoprotein NP, die Matrixproteine M1 und M2, die Polymerase-Proteine PB1, PB2 und PA und die Nichtstrukturproteine NS1 und NS2. Eines der acht Gensegmente enthält allein das NS-Gen, welches die beiden Nichtstrukturproteine NS1 und NS2 kodiert. Ein Forscherteam um Clayton Naeve vom St. Jude Children's Hospital in Memphis, Tennessee - USA hat durch vergleichende Analysen der DNA-Sequenzen von Influenzaviren festgestellt, dass sich an einem Ende des NS-Gens ein Abschnitt befindet, der vermutlich mit über die Schwere eines Infektionsverlaufs entscheidet. Änderungen in diesem Genabschnitt führen zu einer Variation in einem variablen Bereich auf dem NS1-Protein. Dieser variable Proteinbereich kann sich je nach Struktur mehr oder minder effektiv an sogenannte PDZ-Domänen (aus etwas 90 AS bestehende Proteininteraktionsdomäne, deren Gen in eukaryontischen Genomen weit verbreitet sind) binden und dadurch die Signalübermittlung in den Zellen unterschiedlich stark stören. Folge ist eine Überstimulation des Immunsystems mit übermäßiger Zytokinausschüttung.
Im Elektronenmikroskop erscheinen alle Gattungen dieses Virus als kugelige oder auch vielgestaltige, behüllte Viruspartikel mit einem Durchmesser von 80-120nm, in deren Hülle eine jeweils verschiedene Anzahl an Proteinen und Glykoproteinen eingelagert sind. Diese Glykoproteine ragen als 10-14nm lange, Spikes oder Peplomere genannte, Fortsätze über die Virusoberfläche hinaus. Bei den Influenza-A- und Influenza-B-Viren sind genau zwei Typen dieser Spikes von besonderem Interesse: Das Hämagglutinin (HA) und die Neuraminidase (NA).
 |
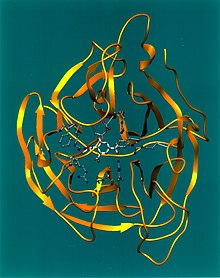 |
 |
 |
 |
 |
Das Hämaglutinin bewirkt die Verklumpung von Erythrozyten und vermittelt bei der Infektion einer Wirtszelle die Anheftung an die Wirtszellrezeptoren und das Eindringen des Virus. Das Schlüssel-Schloss-Prinzip ist auch der Grund dafür, dass bestimmte Subtypen oder Virusvarianten mit ihrem speziellen Hämaglutinintyp bestimmte Wirte leicht infizieren und dabei eine Erkrankung auslösen können und andere prinzipiell mögliche Wirte wiederum nicht oder nur sehr eingeschränkt. Durch Mutation des Hämaglutinin-Gens kann sich die Pathogenität für den einen oder anderen potentiellen Wirt erheblich ändern.
Die Neuraminidase hat im Infektionsvorgang eine noch nicht abschließend geklärte enzymatische Funktion. Nach derzeitigen Erkenntnisstand zerstört sie die N-Acetylneuraminsäure zellulärer Rezeptoren und spielt darüber eine entscheidende Rolle bei der Freisetzung Tochtervirionen aus den infizierten Zellen. Außerdem verhindert die Neuraminidase das Hämagglutinin-vermittelte Anheften der Tochtervirionen an bereits infizierte Zellen.
Die Influenzaviren vermehren sich im Atemtrakt des infizierten Individuums.
Gattungen der Influenzaviren: Es gibt drei verschiedene Gattungen dieser Viren, welche mit den Gattungen Thogotovirus und Isavirus alle zusammen zur Familie der Orthomyxoviren gehören.
1.) Influenza-A-Viren: Die lineare, einzelsträngige RNA des Influenza-A-Genoms besitzt 8 Segmente und zeichnet sich durch die große Variabilität der antigenen Eigenschaften aus(Mutationsfrequenz, Neugruppierungen). Man unterscheidet verschiedene Untertypen, die verschiedene Vorlieben bezüglich des Wirtes haben. Als Wirte zählen der Mensch und verschiedene Säugetierarten wie Schwein, Pferd, Nerz, Seehund und Wal sowie zahlreiche Vogelarten. Das primäre Reservoir aller Influenza A-Viren liegt im Wassergeflügel.
2.) Influenza-B-Viren: Ihr Genom hat ebenfalls eine 8-fach segmentierte lineare, einzelsträngige RNA. Influenza-B ist ausschließlich humanpathogen, löst allerdings weniger schwerwiegende Erkrankungen aus als Influenza A.
3.) Influenza-C-Viren Die lineare, einzelsträngige RNA der Influenza C-Viren hat nur 7 Segmente und sie exprimieren keine Neuraminidase (NA). Influenza-C bildet ein Glykoprotein, das Oberflächen-Haemagglutinin-Esterase-Fusion-Protein HEF, das sowohl die Rezeptorbindung an die Wirtszelle, die anschließenden Invasion (Fusion) wie auch die spätere Freisetzung der neugebildeten Viren aus der Zelle übernimmt. Das Virus ist für Menschen und Schweine pathogen, löst bei letzteren aber nur milde Erkrankungen aus.
In Fachkreisen wird jeder Virusstamm mit den Kennungen Typus, Ort der erstmaligen Isolierung (Virusanzucht), Isolierungsnummer, Isolierungsjahr (Beispiel: Influenza B/Shanghai/361/2002) und nur bei den A-Viren auch zusätzlich mit der Kennung des Oberflächenantigens benannt [Beispiel: Influenza A/California/7/2004 (H3N2)].
Umweltstabilität: Je nach Temperatur ist die Umweltstabilität der Influenzaviren sehr unterschiedlich. Bei einer normalen sommerlichen Tagestemperatur von etwa 20°C können an Oberflächen angetrocknete Viren in der Regel zwei bis acht Stunden überdauern. Bei 22°C überstehen sie sowohl in Exkrementen wie auch in Geweben verstorbener Tiere und in Wasser mindestens vier Tage, bei einer Temperatur von 0°C mehr als 30 Tage und im Eis sind sie nahezu unbegrenzt überlebensfähig. Oberhalb von 22°C verringert sich die Umweltstabilität sehr deutlich. Bei 56°C werden sie innerhalb von 3 Stunden und bei 60°C innerhalb von 30 Minuten inaktiviert [1]. Ab 70°C verliert das Virus zügig seine Infektiösität.
Variabilität:
- Antigendrift Eine Häufung von Punktmutationen in den kodierenden Nukleotiden der beiden Glykoproteine HA und NA führt zu einem Antigendrift, d.h. zu einer Änderung der antigenen Eigeschaften dieser Oberflächenantigene. Diese eher kleinen Veränderungen sind der Grund dafür, dass ein Mensch mehrmals in seinem Leben mit geringfügig veränderten Virusvarianten (Driftvarianten) infiziert werden kann und dass Epidemien regelmäßig wiederkehren.
- Antigenshift: Wird ein Organismus gleichzeitig von zwei Virusvarianten infiziert (Doppelinfektion), kann es zum Rearrangement unter den zweimal 8 Genomsegmenten der beteiligen Influenzaviren kommen, in dem einzelne oder mehrere RNA-Moleküle zwischen den Influenzaviren ausgetauscht werden. Diesen Vorgang nennt man genetische Reassortierung. Meist findet die Durchmischung von humanen und aviären Gensegmenten im Schwein statt, das oft Träger beider Viren sein kann. Die so verursachten größeren antigenen Veränderungen in den viralen Oberflächenantigenen werden allein bei den Influenza A-Viren beobachtet (Shiftvarianten), allerdings kommen sie nur selten vor. Derartige Veränderungen können dann der Ursprung von Pandemien sein, von denen es im 20. Jahrhundert die von 1918-19 mit dem Subtyp H1N1, 1957 mit H2N2, 1968 mit H3N2 und die von 1977 mit dem Wiederauftauchen von H1N1 gab.
Influenza-A-Subtypen: Im Allgemeinen werden die Influenza-A-Viren in erster Linie nach bestimmten, deutlich unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften in Untertypen bzw. Subtypen eingeteilt. Dies geschieht nach dem Muster A/HxNx oder A/Land/HxNx/Probe. Bisher wurden insgesamt 16 H-Untertypen und 9 N-Untertypen festgestellt.
Die wichtigsten Oberflächenantigene beim Influenza-A-Virus sind die Hämagglutinine (H1, H2, H3, H5 seltener H7 und H9) und die Neuraminidase (N1, N2, seltener N7), die folgende Subtypen bilden:
A/H1N1
Dieses Virus gilt als Auslöser der sogenannten Spanischen Grippe von 1918 und konnte im Lungengewebe der Opfer nachgewiesen werden. Im Jahr 2005 gelang schließlich eine Rekonstruktion des Erregers aus Genfragmenten. Dieser Virustyp kann aufgrund seiner Struktur besonders leicht in menschliche Körperzellen eindringen und sein Erbgut einschleusen. Eine weitere globale A/H1N1-Pandemie war die Russische Grippe von 1977.
A/H2N2
A/H2N2 führte 1957 als Asiatische Grippe zur Pandemie.
A/H3N2
A/H3N2 ist ebenfalls ein sehr bekannter Subtyp der Humaninfluenza (Fujian Typ) und führte 1968 als Hongkong-Grippe zur globalen Pandemie.
A/H5N1
Nur der Vollständigkeit halber hier aufgeführt. Der Subtyp A/H5N1 ist einer von mehreren Auslösern der Geflügelpest ("Vogelgrippe"). Trotz mehrerer Dutzend Übergänge auch auf den Menschen gehört dieser (HPAI, Highly Pathogenic Avian Influenza) Subtyp bisher nicht in die Reihe der für menschen hochkontagiösen Influenza-A-Viren, da das Virus bislang allenfalls in sehr seltenen Einzelfällen von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Die WHO sieht jedoch derzeit noch keine große Gefahr darin, dass sich das Virus an den Menschen adaptiert und dann zu einer Pandemie führt.
A/H7N7

Nur der Vollständigkeit halber hier aufgeführt. Dieser Subtyp gehört nicht in die Reihe der Influenza-A-Viren, die beim Menschen eine sich weiterverbreitende Grippe auslösen können (Geflügelpest). Zuletzt 2003 wurden in den Niederlanden auch 89 Infektionen von Menschen mit diesem (HPAI, Highly Pathogenic Avian Influenza) Subtyp bestätigt. Ein Fall verlief tödlich.
A/H9N2
Nur der Vollständigkeit halber hier aufgeführt. Dieser Subtyp gehört nicht in die Reihe der Influenza-A-Viren, die beim Menschen eine inefektiöse Grippe auslösen können und er wurde bislang auch beim Menschen nur in einer minder pathogenen Form (LPAI, Lowly Pathogenic Avian Influenza) von Peiris et al. 1999 isoliert und dokumentiert. Bei drei Fällen in Hongkong und China (1999, 2003) erholten sich die Patienten von dieser influenzaähnlichen Infektion. Siehe Geflügelpest
Influenza-B-Subtypen: Die Influenza-B-Viren werden in zwei Stamm-Linien eingeteilt
- B/Victoria-Linie
- B/Yamagata-Linie
Influenza-C-Subtypen:
Die Unterschiede zwischen einzelnen Virusstämmen sind derart gering, dass hier bislang keine weitere Unterteilung vorgenommen wurde.
Vorkommen: Die Influenzaviren und die durch sie ausgelösten Erkrankungen existieren weltweit, allerdings kommen die Influenza-C-Viren nur gelegentlich vor.
Übertragung: Das Virus wird übertragen
- per Tröpfcheninfektion oder über Kontakt- bzw. Schmierinfektion (absinkende Exspirationströpfchen).
- über das Trinkwasser, unter Umständen sogar durch das öffentliche Trinkwassernetz, da die Viren bei Kälte über mehrere Wochen konserviert werden und so in der kalten Jahreszeit bis zum Wasserhahn gelangen können
- durch Kontakt mit Kotpartikeln, Haaren, Haut und Gefieder erkrankter Wirte und Vektoren.
Es gibt unterschiedliche Schätzungen, nach welcher Zeit ein infiziertes Individuum seinerseits in der Lage ist, das Virus auf andere Individuen zu übertragen. Nach Longini et al. dauert es vier Tage, bis ein gerade infizierter Mensch weitere Menschen infizieren kann. Dagegen kommt ein anderes Wissenschaftsteam (Fergurson et al.) nach Analyse von historischen Daten zu dem Schluss, dass die Weitergabe schon 2,6 Tage nach der Infektion möglich ist.
Diagnostik: Die Diagnostik erfolgt meist anhand eines hinteren Nasenabstrichs oder eines tiefen Rachenabstrichs. Andere Untersuchungsflüssigkeiten sind Trachealsekret, die Bronchoalveoläre Lavage (BAL), Nasenspülflüssigkeit, Rachenspülflüssigkeit oder Blut. Es bestehen folgende Möglichkeiten:
- Direkter Erregernachweis in der Elektronenmikroskopie (sehr teuer).
- Bestimmung von Influenzaantikörpern im Blut.
- Influenza - PCR-Test. Die Kosten i.H.v. ca. 40 € werden derzeit nicht von den deutschen gesetzlichen Krankenkassen getragen.
- Influenza-Schnelltest. Dieser Test liefert innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis. Hierbei werden Virusproteine mittels farblich markiertem Antikörper auf einem Teststreifen sichtbar gemacht. Dieser Test wird im Gegensatz zur Influenza-spezifischen PCR von den deutschen gesetzlichen Krankenkassen bei Kindern bezahlt.
Krankheitsverlauf/Symptome: Symptome treten nach einer Inkubationszeit von wenigen Stunden bis Tagen auf. Bei einer Inkubationszeit von mehreren Tagen kann der Infizierte schon zwei Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome die Viren auf andere Menschen übertragen.
Generell sind die Krankheitsanzeichen unspezifisch und können mit jeder anderen akuten Atemwegserkrankung verwechselt werden. Charakteristisch ist der oft schlagartige Ausbruch der Erkrankung.
Die wichtigsten Symptome sind ausgeprägtes Krankheitsgefühl mit hohem Fieber bis 40°C, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Augentränen, trockenem Husten und angeschwollener Nasenschleimhaut bzw. Schnupfen.
Komplikationen: In seiner schwersten Verlaufsform führt eine Influenza bei vorerkrankten, immungeschwächten oder ohne jeden Impfschutz versehenen Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen zu einer primären grippebedingten Lungenentzündung (Influenzapneumonie) oder auch innerhalb weniger Stunden (perakut) zum Tod.
Als weitere Komplikationen kommen Enzephalitiden und Myokarditiden in Betracht. Diese Komplikationen treten in erster Linie bei Menschen mit schwerwiegenden Grunderkrankungen wie chronischen Herz-Lungen-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Immundefekten und anderen in Erscheinung.
Eine weitere häufige Komplikation ist die bakterielle Superinfektion, die sich häufig als Pneumonie manifestiert.
Die Impfungsrate ist in Deutschland und Österreich gering. Pro Jahr sind aufgrund einer Influenza-Erkrankung in der Altersgruppe der 5- bis 44-jährigen 200 bis 300 bzw. in der Gruppe der über 65-jährigen 2.000 bis über 10.000 Krankenhauseinweisungen erforderlich. In der letzteren Gruppe sind pro Jahr unter einer Million Personen 300 bis über 1.500 Todesfälle durch Influenza bedingt.
Im Winter 2002/2003 gab es nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Deutschland 5 Millionen Infizierte und 16.000 bis 20.000 Todesfälle, die auf eine Influenza zurückzuführen sind. Diese Angaben beruhen allerdings auf Hochrechnungen, da nur selten ein direkter Virusnachweis veranlasst wird. In der amtlichen deutschen Todesursachenstatistik sind daher für die Jahre 1998 bis 2004 jeweils nur zwischen 9 und 34 nachgewiesene Influenza-Todesfälle verzeichnet. Gleichwohl werden in dieser Statistik für die ICD 10-Klassifikation J10 - J18 (Grippe und Pneumonie) für diese Zeitspanne jährlich 17.500 bis 21.800 Todesfälle ausgewiesen.
Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik Österreich starben 2002 in Österreich 18 Menschen direkt an der Grippe. Es ist aber davon auszugehen, dass der Influenza noch viele weitere Todesfälle ursächlich zuzurechnen sind.
Therapie: Die Therapie ist in erster Linie symptomatisch, ggf. wird ein Antibiotikum zur Prophylaxe bakterieller Superinfektionen verordnet. In begründeten Einzelfällen können in der Inkubationsphase bzw. Anfangsphase der Erkrankung und mit begrenztem Nutzen Neuraminidase-Hemmer (Oseltamivir (Handelsname Tamiflu®) p.o., Zanamivir (Handelsname Relenza®) zur Inhalation) oder andere Virostatika wie Amantadin (Handelsname Symmetrel® / PK-Merz®) p.o. oder Rimantadin (Handelsname Flumandine®) p.o. eingesetzt werden.
Vorbeugung: Eine aktive Impfung gegen die Influenza wird jährlich vorzugsweise in den Monaten Oktober und November angeboten, ist kostenlos und umfasst die häufigsten Erregerstämme. Im Falle einer drohenden Epidemie ist eine Impfung auch zu jeder anderen Jahreszeit möglich und sinnvoll. Die Impfung wird empfohlen für Menschen über 60, für Menschen mit chronischen Erkrankungen und bei beruflicher Exposition.
Besonders für Kleinkinder und für Erwachsene jenseits der 65 kann ferner eine Impfung gegen Pneumokokken sinnvoll sein. Diese Bakterien sind häufig verantwortlich für die einer Virusinfektion unmittelbar folgende Sekundärinfektion.
Epidemien/Pandemien: Von einer Influenzaepidemie oder Grippewelle spricht man, wenn 10-20% der Bevölkerung infiziert sind und die Ausbrüche lokal begrenzt bleiben. Auslöser der Epidemien und Pandemien sind Influenzaviren der Gruppen A und seltener B, da diese in der Lage sind, ihre antigenen Oberflächenmoleküle HA und NA ständig zu verändern. Das führt dazu, dass sie bei einer erneuten Infektion vom Immunsystem nicht mehr oder nur schlecht erkannt werden.
Pandemien treten in der Regel alle 10 bis 40 Jahre auf und verbreiten sich explosionsartig mit Infektionsraten von bis zu 50% über den ganzen Globus. Auslöser ist immer ein neuer Subtyp des Influenza-A-Virus, der durch einen Antigenshift (eine Durchmischung von humanen und aviären Gensegmenten) entsteht. Meistens findet die Durchmischung von Vogelgrippe- und humanen Influenzaviren im Schwein statt, das oft Träger beider Viren sein kann.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Jahre 1948 ein weltweites Überwachungssystem installiert, das die von 110 Referenzlaboratorien isolierten Virusstämme ständig auf neue Varianten überprüft, was zu den jährlich neuen Empfehlungen für die Impfstoffzusammensetzung der kommenden Saison führt, mit industriellem Herstellungszyklus von 10-12 Monaten. Das Nationale Referenzzentrum für Influenza (NRZ) in Deutschland befindet sich am Robert Koch Institut.
Übersicht: Die Epidemien und Pandemien des 20. Jahrhunderts wurden nach ihren Ursprungsgebieten benannt:
- 1918–1920 – „Spanische Grippe“ extrem hohe Zahl von Toten, die Schätzungen variieren zwischen 20 und 50 Millionen Opfern (Pandemie). Der Name „Spanische Grippe“ rührt daher, dass die Presse in Spanien freier war als in den Staaten, die am 1. Weltkrieg direkt beteiligt waren. Nachrichten über die Krankheit wurden daher in vielen Ländern zensiert, so dass die ersten alarmierenden Berichte über diese Pandemie aus dem neutralen Spanien kamen. Der Ursprung der Grippe lag jedoch vermutlich in den Vereinigten Staaten.
- 1957–1958 – „Asiatische Grippe“ etwa 1 bis 1,5 Mio. Tote (Pandemie)
- 1968–1969 – „Hongkong-Grippe“ etwa 3/4 bis 1 Mio. Tote (Pandemie)
- 1976-1977 - „Russische Grippe“ etwa 3/4 Mio. Tote (Epidemie)
Auch in normalen Grippejahren ohne Pandemie sterben jährlich eine Vielzahl von Menschen an dieser Krankheit oder ihren Folgen.
Influenza-Pandemien stellen nach wie vor eine große Gefahr für die Weltgesundheit dar. Als größte vorstellbare und realistische globale Katastrophe gilt heute eine Grippe-Pandemie, da sie das Gesundheitssystem der meisten Länder überfordern würde.
Die zwei Hauptausbreitungswege einer Grippepandemie sind wahrscheinlich die menschliche Reisetätigkeit und der der Vogelzug. Die direkte Ausbreitung von Mensch zu Mensch erfolgt in erster Linie mittels Tröpfcheninfektion. Ob eine Ansteckung über das Trinkwasser ein wesentlicher Übertragungsweg ist, ist noch ungesichert.
Historisches: Die Geschichte der Virologie ist u.a. eng mit den Namen Adolf Mayer, Dmitrii Iwanowski, Martinus Beijerinck sowie Wendell Meredith Stanley verknüpft. Deren Arbeiten und die Isolation des für die Influenza beim Menschen „verantwortlichen“ Virus durch Andrewes, Smith and Laidlaw vom National Institute for Medical Research im Jahr 1933 waren nötig, um die Hilflosigkeit angesichts der Influenza (zumal gegen die bakteriellen Folgeinfektionen auch noch keine Antibiotika verfügbar waren) zu überwinden, die der nachstehende Bericht aus einer österreichischen Tageszeitung aus dem Jahre 1889 anschaulich darstellt:
„Die Influenza breitet sich aus. In Wien, wo der erste Fall Ende des vorigen Monats auftrat, soll die Krankheit bereits den Charakter einer rapid um sich greifenden Infektionskrankheit angenommen haben. Im Wiener Allgemeinen Krankenhause gibt es keine Klinik und Abteilung, wo das Wartepersonal von Influenzafällen frei wäre. Dasselbe gilt von den Sekundarärzten, Operateuren und Aspiranten. Auch in Berlin sind in den letzten Tagen Fälle von Influenza vorgekommen, und in Paris ist die Krankheit bekanntlich im Louvremagazin ausgebrochen, wo gegen 400 Personen daran leiden. In Russland hat sich die Influenza über das ganze Reich ausgebreitet. In Petersburg und Moskau wurden über 300000 Menschen davon befallen. Die Influenza greift überaus rapid um sich, wie dies von keiner anderen Krankheit, selbst Cholera und gelbes Fieber gesagt werden kann. Sie gibt sich, wie der russische Professor Dr. Filatoff in einer wissenschaftlichen Abhandlung schildert, vor allem durch das Fiebern des Körpers, durch heftige Kopfschmerzen, vorzüglich im Schädel und im Bereiche des sinus frontalis (Stirnbogen) und durch die Steigerung der Körperwärme kund. Manche Patienten werden überdies von heftigem Schnupfen und Husten befallen. Im ganzen Körper empfindet man Schwäche und Mattigkeit. Die Krankheit dauert nicht länger als 5 bis 6 Tage, wobei der Kranke an einzelnen Zwischentagen gar keine Leiden hat und sich ganz wohl fühlt. Nach solchen Zwischenfällen treten gewöhnlich starkes Fieber und große Hitze im Körper ein, worauf der Patient wieder ganz gesund wird. Als eines der besten Mittel gegen die Influenza empfiehlt ein Arzt in der russischen St. Petersburger Zeitung den Absud vom Salbei, welcher glasweise, unter Beimischung einiger Tropfen des stärksten Cognacs getrunken wird. Die Krankheit ist nach Prof. Nothnagel in Wien unzweifelhaft eine Bakterienkrankheit; sie verbreitet sich nicht durch ein Contagium, sondern mittels Miasmen durch die Luft.“
Literatur und Weblinks:
- W. H. Haas: Prinzipien und Aspekte der Seuchenalarmplanung am Beispiel der Influenzapandemieplanung. in: Bundesgesundheitsblatt. Springer, Berlin 9.2005, S. 1020-1027. ISSN 0007-5914
- Neues über die Grippe-Pandemie von 1918. in: Deutsche Apotheker Zeitung. (DAZ). Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart 140.2000, 22, S. 46 ff. ISSN 0011-9857
- Influenza. Furcht vor der Pandemie. in: Pharmazeutische Zeitung. Govi, Eschborn 148.2003, 34, S. 30–31. ISSN 0031-7136
- Jeffery K. Taubenberger, Ann H. Reid, Thomas G. Fanning: Das Killervirus der Spanischen Grippe. In: Spektrum der Wissenschaft. Spectrumverlag, Stuttgart 2005,4, S. 52–60. ISSN 170-2971
- RKI - Influenza
- Arbeitsgemeinschaft Influenza
- Influenza Report
- WHO - Influenza
- European Influenza Surveillance Scheme (EISS)
Quellen
Bunyaviridae
Krim-Kongo-Fieber-Virus
| Krim-Kongo-Fieber-Virus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||
Das Krim-Kongo-Fieber (engl. Crimean-Congo-Haemorrhagic-Fever, CCHF) wird vom Krim-Kongo-Fieber-Virus ausgelöst (CCHFV). Das RNA-Virus gehört zur Gruppe der Arboviren, Genus Nairovirus aus der Familie der Bunyaviren.
Geschichte: Erstmals wurde das Virus 1956 in Zaire (ehem. Belgisch-Kongo) aus menschlichem Blut isoliert. Die Erkrankung "Hämorrhagisches Krim-Fieber" war schon länger bekannt. In den 1940er Jahren sind Erkrankungsfälle auf der Krim (Russland) dokumentiert, wahrscheinlich hat es in Zentralasien schon seit Jahrhunderten sporadische Krankheitsfälle gegeben.
Vorkommen: Süd-Ost-Europa, Asien, mittlerer Osten, Afrika
Übertragung: Das Virusreservoir sind grasfressende Haus- und Wildtiere (Kühe, Schafe, Ziegen, Hasen, Kamele). Die Übertragung erfolgt durch den Biss von Zecken, vor allem Hyalomma-Zecken, die in wärmeren Regionen südlich des Balkans vorkommen. Über 30 verschiedene Hyalomma-Arten sind als Überträger identifiziert.
Zunächst nehmen die Zecken das Virus mit dem Blut infizierter Tiere auf, das Virus kann dann längere Zeit im Verdauungstrakt der Zecke überleben und durch Zeckebisse über den Speichel weitergegeben werden. Eine Übertragung kann auch direkt durch den Kontakt mit Blut oder Fleisch erkrankter Tiere erfolgen, sowie über den Kontakt mit Urin, Stuhl oder Speichel infizierter Menschen. Auch Tröpfcheninfektion ist möglich. Je schwerer die Erkrankung verläuft, desto mehr Viren werden vom Patienten ausgeschieden. Daher kommen auch nosokomiale Infektionen in nennenswertem Umfang vor.
Klinik: Die Inkubationszeit schwankt zwischen 3-12 Tagen. Die Symptome setzen plötzlich ein: Fieber, Schüttelfrost, Reizbarkeit, Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen, Oberbauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Typisch ist eine Gesichtsrötung und ein Gesichtsödem, Bindehaut- und Rachenrötung. Bei einem Teil der Erkrankten stellt sich als Komplikation eine hämorrhagische Verlaufsform ein: Darmblutungen, Bluterbrechen (Hämatemesis), Hautblutungen, hämorrhagische Diathese. Die Letalität ist abhängig vom Virusstamm und beträgt zwischen 2 und 50%. Die Krankheit kann wohl auch inapparent verlaufen.
Therapie: Eine Impfung ist nicht bekannt, eine antivirale Therapie mit Ribavirin ist möglich, ihre Wirksamkeit jedoch noch nicht abschließend zu beurteilen. Der Erregernachweis ist mittels Virusisolierung in der Zellkultur möglich.
Vorbeugung: In Endemiegebieten ist Zeckenschutz angezeigt (Repellentien, geschlossene helle Kleidung, regelmäßige Selbstuntersuchung nach Zecken). Der Kontakt mit infizierten Personen sollte gemieden werden.
Gesetz: Nach dem IfSG §6 ist der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an virusbedingtem hämorrhagischen Fieber mit Namensnennung meldepflichtig.
Weblinks: RKI - Krim-Kongo-Fieber
Hantaviren
| Hantavirus | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||||||
Die Gattung Hantavirus und diverse Arten wie z.B. Hantaan-Virus, Puumala-Virus, Seoul-Virus, Sin-Nombre-Virus sind verantwortlich für schwere hämorrhagische Fiebererkrankungen insbesondere im südasiatischen Raum. Hanta-Viren sind weltweit verbreitet. In Mitteleuropa sind beispielsweise einige Regionen in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg als Endemiegebiete bekannt.
Der Name Hanta geht auf einen Fluss in Korea zurück, an dem in den 1950er-Jahren während des Koreakrieges tausende UN-Soldaten an einer Infektion mit Hanta-Viren erkrankten.
Übertragung: Die Übertragung erfolgt durch verschiedene Nager, die mit dem Speichel, den Fäkalien und dem Urin große Mengen an Erregern ausscheiden. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt sowohl durch Kontaktinfektion als auch durch orale oder respiratorische Aufnahme der Erreger. Eine mögliche Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist nur in einem einzigen Fall in Südamerika beschrieben worden.[1]
Inkubationszeit: Die Inkubationszeit beträgt 12 bis 21 Tage.
Klinik: Es kommt je nach Erreger zu Fieber, Husten, Dyspnoe, Petechien, geringen Blutungen und Proteinurie; diese Symptome heilen ohne Folgen aus.
Bei bis zu einem Drittel der Erkrankten entwickelt sich ein schwererer Verlauf: Nach einer Fieberphase von 3 bis 7 Tagen mit retroorbitalen Schmerzen, Myalgien, konjunktivalen Blutungen, Petechien und Blutungen der Schleimhäute kommt es vorübergehend zu Hypotonie, Tachykardie und evtl. Bewusstseinsstörungen. Eine akute tubuläre und interstitielle Nephritis kann dann zunächst zu Oligurie mit Hypertonie führen oder zur Niereninsuffizienz. Begleitend treten Erbrechen, gastrointestinale (den Magen-Darm-Trakt betreffende) und zerebrale (das Gehirn betreffende) Blutungen, Hämaturie, selten Lungenödeme auf. Das Schicksal des Patienten entscheidet sich in dieser Phase. Anschließend (5. Krankheitswoche) kommt es zu einer polyurischen Phase mit einer Ausscheidung von 3 bis 6 l/die. Die Erkrankung durch das Hanta-Virus erfordert eine stationäre Aufnahme. Eine Anämie kann Monate fortdauern.


Die europäische mildere Form wird als Nephropathia epidemica bezeichnet. Dabei treten selten Blutungen auf. Akute Glaukomanfälle, eine Beteiligung des ZNS, Myokarditiden und intestinale Blutungen können als Komplikationen auftreten.
Diagnose: Die Erregerisolation ist im Tierversuch und in Zellkulturen bei Krankheitsbeginn möglich. Der serologische Nachweis wird im Immunfluoreszenztest und ELISA erbracht. IgM-Antikörper sind nur einige Wochen nachweisbar, wohingegen die 14 Tage nach Krankheitsbeginn auftretenden IgG-Antikörper jahrelang bestehen bleiben.
Prophylaxe: In ländlichen Gebieten ist eine Bekämpfung der Nagetiere wenig erfolgversprechend, in städtischen Gebieten sollte ihre Ausrottung systematisch betrieben werden. Impfstoffe sind noch nicht verfügbar.
Vorkommen: In Deutschland gab es im Oktober 2004 in Dormagen einige Fälle von Hanta-Virus-Infektionen. Nach Information des Gesundheitsdienstes für Stadt und Landkreis Osnabrück erkranken dort jährlich etwa 20-30 Personen, Tendenz steigend. So wurden bis Mai sechs Fälle in Bissendorf und zwei in Osnabrück-Stadt gemeldet.
Weiterhin erkrankte im November 2004 eine Frau in Würzburg. In den Jahren vorher traten dort einige weitere Infektionen auf. Anfang 2005 gab es ca. 20 Fälle in Köln. Im Mai 2005 gab es einen Fall im Raum Braunschweig, im Juni 2005 erneut mehrere Erkrankte in Dormagen. Seit Beginn des Jahres 2005 gibt es in Aachen ca. 20 Fälle des Virus.
In Luxemburg haben sich zwischen März 2005 und Juli 2005 elf Menschen infiziert.
Weblinks: RKI - Hantavirus
Quellen
- ↑ P.Padula et al. 2004
Arenaviridae
Arenavirus
Lassa-Virus
| Lassa-Virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||
Das Lassafieber ist eine meldepflichtiges virales hämorrhagisches Fieber. Es wurde 1969 zum ersten Mal beschrieben, als in Nigeria eine amerikanische Missionsschwester starb, eine weitere erkrankte und zur Behandlung in die USA ausgeflogen wurde. Das Virus wurde nach der Stadt Lassa benannt, in der die erste Krankenschwester gearbeitet hatte. In New York City traten unter Wissenschaftlern, die das Virus isolierten, zwei Laborinfektionen auf, einer der Infizierten ist infolge der Erkrankung verstorben.
Erreger: Der Erreger des Lassa-Fiebers ist ein behülltes Einzel(-)Strang-RNA-Virus mit hoher Virulenz und gehört zu Gattung Arena-Virus (Familie Arenaviridae). Zur selben Virenfamilie gehören auch die Erreger des Junin-Fiebers und des Machupo-Fiebers. Sie alle werden der höchsten biologischen Sicherheitsstufe 4 zugeordnet. Vom Lassa-Virus sind bisher vier serologische Subtypen bekannt: Typ Nigeria, Sierra Leone, Liberia und Typ Zentralafrikanische Republik.
Serologische Daten lassen vermuten, dass zumindest in Westafrika etwa 90 bis 95% aller Infektionen inapparent verlaufen könnten.
Als natürlicher Reservoirwirt für das Lassa-Virus ist neben anderen Kleinnagern hauptsächlich die Natal-Vielzitzenmaus (Mastomys natalensis) festgestellt worden.
Vorkommen: Man findet das Lassa-Virus endemisch in den westafrikanischen Ländern Senegal, Gambia, Mali, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Elfenbeinküste, Ghana, Burkina Faso und Nigeria. Daneben ist es auch in weiteren tropischen Ländern wie der Zentralafrikanische Republik und Namibia festgestellt worden. In den genannten Gebieten sind bis zu 15% der Vielzitzenmäuse mit dem Virus infiziert. Verwandte nicht-humanpathogene Viren gibt es auf dem ganzen afrikanischen Kontinent.
Übertragung: Das Lassa-Virus wird durch die in afrikanischen Häusern weit verbreitete Natal-Vielzitzenmaus (Mastomys natalensis) per Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion über die Ausscheidungen der Tiere auf anschließend vom Menschen verzehrte Lebensmittel übertragen. Daneben können die Viren auch über Tröpfcheninfektion, Wundinfektion und durch Sekrete direkt von Mensch zu Mensch wie auch durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Vor dem Krankheitsausbruch ist lediglich über das Blut eine Übertragungsmöglichkeit durch infizierte Menschen festgestellt worden.
Bisher ging man von einem saisonalen Anstieg der Inzidenz während der Trockenzeit von Januar bis März aus. In Sierra Leone hingegen wurde ein Epidemiegipfel im Übergang zur Regenzeit (Mai bis November) beobachtet.
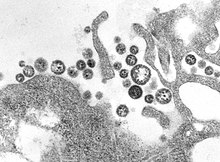
Diagnose: Testung auf Erreger in der Rachenspülflüssigkeit, im Pleura- oder Aszitespunktat oder durch Titeranstieg in der Komplementbindungsreaktion. Diese Untersuchungen sind nur in Labors mit speziellen Sicherheitseinrichtungen durchführbar.
Differentialdiagnostisch kommen Malaria, Influenza, Typhus und septisches Fieber in Frage.
Krankheitsverlauf/Symptome: Die Inkubationszeit des Lassa-Fiebers beträgt zwischen 6 und 21 Tagen, meist 7 bis 10 Tage.
Nach einem schleichendem Krankheitsbeginn mit Abgeschlagenheit, grippeähnlichen Muskel- und Gliederschmerzen, Übelkeit und Kopfschmerzen entsteht ein Dauerfieber (Kontinuafieber) von ca. 40°C. Ab dem 3. bis 7. Tag stellen sich zuerst Entzündungserscheinungen im Rachen ein später dann weißliche Plaques und Ulzerationen. Die Patienten sind stark allgemeinreduziert und apathisch. Die Zervikallymphknoten sind vergrößert und druckdolent.
Ab dem 7. Tag entsteht oft ein makulo-papulöses Exanthem (fleckiger Hautausschlag mit kleinen erhabenen Knötchen) im Gesicht, am Hals und an den Armen beginnend, das sich dann auf den ganzen Körper ausbreitet. Um die gleiche Zeit treten kolikartige Bauchschmerzen auf, der Stuhl ist von breiiger Konsistenz bis hin zu Durchfall. Erbrechen ist aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes möglich. Gelegentlich kommt es zur generalisierten Lymphknotenschwellung. Die Krise tritt zwischen dem 7. und 14. Tag ein. Die Nahrungsaufnahme ist wegen der Ulzerationen und Schwellungen erschwert; auch die Atmung kann beeinträchtigt sein. Die meisten Patienten weisen eine Hepatosplenomegalie auf. Zur hämorrhagischen Diathese kommt es aufgrund der verminderten Gerinnungsfaktoren bei normaler Thrombozytenzahl und erhöhter Permeabilität der Kapillaren durch Wandschädigungen. Auf die Nierenbeteiligung weisen eine Proteinurie und Mikrohämaturie hin. Nach einer kurzen Entfieberung nach dem 5.-7. Tag kann es zu einem neuerlichen Fieberanstieg nach weiteren 3-5 Tagen kommen. Die Prognose ist ernst und die Letalität liegt für hospitalisierte Patienten bei etwa 15%, bei schwangeren Frauen bei etwa 50%.
Komplikationen: Zwischen dem 5. und 8. Tag des Ausbruchs des Lassa-Fiebers stellt die hämorrhagische Diathese eine gefürchtete Komplikation dar. Des Weiteren die Pneumonie, unter Umständen mit Begleitpleuritis und Erguß. Sie tritt häufig in der zweiten Woche auf und ist in einigen Fällen die Todesursache gewesen. Zu nennen sind noch Meningismus, Verwirrtheitszustände, Benommenheit. Die Rekonvaleszenz ist deutlich verzögert und Kreislaufprobleme können noch lange nach der Erkrankung anhalten.
Therapie: Eine spezifische Therapie ist nicht bekannt. Innerhalb der ersten sechs Tage der Erkrankung war das Virostatikum Ribavirin (oral, intravenös oder als Immunplasma) erfolgreich. In anderen 6 Fällen wurde Rekonvaleszentenserum gegeben, welches bei 5 dieser 6 Fälle ebenfalls erfolgreich war. Bei Ebola-Fieber reduziert die Gabe von Humanplasma mit ebolaspezifischen Antikörpern die Virämie. Dazu kommen fiebersenkende Mittel und die intensivmedizinische Überwachung und Versorgung.
Vorbeugung: Gegen die Erkrankung existiert bislang keine Schutzimpfung zur Vorbeugung, an der Entwicklung eines Impfstoffes wird jedoch gearbeitet.[1]
Zur Verhinderung einer Infektion sind allgemeine Hygieneregeln zu beachten und ein enger, ungeschützter Umgang mit erkrankten Personen und deren Körperausscheidungen zu vermeiden.
Statistik: Schätzungen zufolge kommen in Westafrika jedes Jahr etwa 100.000-300.000 Fälle von Lassa-Fieber vor, etwa 70% verlaufen subklinisch. Die Sterblichkeitsrate rangiert zwischen 2% in den Dörfern, 16% in den Krankenhäusern und 30% bei schwangeren Frauen. In Westafrika kam es mehrfach zu Ausbrüchen in Krankenhäusern vor allem in Nigeria, Liberia und Sierra Leone häufig mit Todesfällen unter dem medizinischen Personal.
Gesetze: Nach § 6 Meldepflichtige Krankheiten des IfSG sind virusbedingte hämorrhagische Fieber mit Namen meldepflichtig.
Literatur und Weblinks:
Lymphozytisches Choriomeningitis-Virus (LCMV)
| Lymphozytisches Choriomeningitis-Virus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||
Krankheitsbilder: Das LCM-Virus kann bei Immunkompetenten eine leichte bis mittelschwere, meist unkomplizierte virale Meningitis auslösen. Bei Immunsupprimierten kann die Infektion zum Tode führen. Erregerreservoir ist die Hausmaus, allerdings können auch andere Nager wie z.B. Hamster und Meerschweinchen infiziert sein und das Virus mit dem Urin ausscheiden. Das New England Journal of Medicine berichtet 2006 von 8 Organtransplantierten, die sich in zwei Clustern über eine Organspende infiziert hatten und von denen 7 Patienten zwischen dem 9. Tag bis zweieinhalb Monate nach Organerhalt verstorben sind. Bei einem der zwei Organspender konnte ein LCMV-positiver Hamster als Infektionsquelle eruiert werden.
Standardmäßig werden Organspender auf Syphilis, HIV, HBV und HCV getestet, für LCMV gibt es keinen geeigneten Schnelltest. Daher sollte in der Anamnese nach entsprechenden Haustieren gefragt werden, aufgrund des Spendermangels wäre dies allerdings keine absolute Kontraindikation für eine Explantation.[2]
Quellen
- ↑ Forschungsbericht: Charakterisierung der zellulären und humoralen Immunantwort bei der humanen Lassavirusinfektion
- ↑ Fischer SA et al. “Transmission of lymphocytic choriomeningitis virus by organ transplantation.”. N Engl J Med, 354(21):2235-49, May 25 2006. PMID:16723615
Deltavirus
| Hepatitis D Virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| nackt, kein eigenes Kapsid | ||||||||||
Das Hepatitis D-Virion kann sich nur in Anwesenheit von Hepatitis B vermehren, dessen Hüllproteine es benutzt. Prinzipiell gibt es zwei Infektionsformen:
- Bei der Simultaninfektion kommt ebenso wie bei der einfachen Hepatitis B meist zur Ausheilung.
- Eine HDV-Superinfektion bei bestehender chronischer HBV-Infektion führt im Sinne eines „second hit“ meist zu einer Aggravierung des Krankheitsverlaufs.
Picornaviridae
Allgemeines
Die Benennung der Picornaviren leitet sich vom Wort „pico“ = sehr klein und „RNA“ ab. Die bekanntesten Repräsentanten dieser Art von Viren sind Enteroviren (Polio- Coxsackie- und Echoviren), Rhinoviren (Schnupfenviren), Hepatoviren (Hepatitis-A-Virus), Cardioviren (Mengovirus, EMC-Virus) und das Maul- und Klauenseuche-Viren.
Alle Picornaviren bestehen nur aus dem Nukleinsäurekern und dem Proteinmantel. Sie sind kugelig geformte Ikosaeder und etwa 20-30nm groß. Die Anzahl der Kapsomere ist bei den Picornaviren relativ gering, man schätzt sie auf 42. Die Vermehrung im Zytoplasma erfolgt mittels Doppelstrang-RNA, im Virion selbst findet sich ss(+)RNA. Da die Picornaviren keine Lipoidhülle besitzen, sind sie gegenüber fettlösenden Substanzen (Äther, Chloroform, etc.) resistent.
Aphtoviren
Foot-and-mouth disease virus
| Foot-and-mouth disease virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||
Das Foot-and-mouth disease virus kann die sogenannte Hand-Fuß-Mund-Krankheit verursachen, eine epidemische Erkrankung des Kindesalters mit Bläschenbildung und Ulzerationen. Die Inkubationszeit beträgt 4-8 Tage, meist sind Kinder unter 10 Jahren betroffen. Die Bläschen sind meist an Händen und Füßen zu finden, teils findet sich ein knötchenförmiger (papulöser) Ausschlag am Oberschenkel und Aphthen im Mund.
Enteroviren
Weblinks: RKI - Enteroviren
Poliovirus
| Poliovirus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
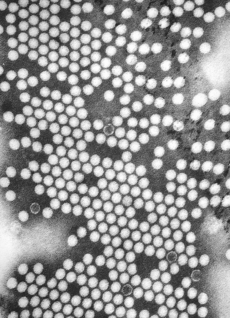 | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||
Morphologie und Eigenschaften: Das Poliovirus ist der Erreger der Kinderlähmung (Poliomyelitis epidemica anterior acuta). Es handelt sich um ein kleines, unbehülltes Virus mit einzelsträngiger (+)-RNA von ca. 25nm Durchmesser, das zum Genus Enterovirus der Picornaviridae-Familie gehört. Es kommt außer beim Menschen auch beim Affen vor. Das Poliovirus ist sehr umweltstabil und durch hygienische Maßnahmen kaum zu bekämpfen. Es verträgt wie alle Enteroviren pH-Werte unter 3 (Magenpassage), ist gegen viele Proteasen resistent und widersteht wegen der fehlenden Phospholipidhülle auch lipidlöslichen Mitteln wie Äther, Chloroform oder Detergenzien. Immunologisch lassen sich drei Typen unterscheiden: Typ 1 (Typ "Brunhilde") ist am häufigsten und kann auch schwere Erkrankungen auslösen, Typ 2 (Typ "Lansing") erzeugt eher leichte Verläufe, Typ 3 (Typ "Leon") ist selten, aber mit ernstem Verlauf.
Vorkommen: Der Erreger ist außer in den Polargebieten weltweit anzutreffen. Durch eine konsequente Durchführung von Impfmaßnahmen ist das häufige Auftreten der Erkrankung auf Gebiete in Afrika und Asien zurückgedrängt worden.
Übertragung: Das Virus wird fäkal-oral durch Schmierinfektion und über Gegenstände übertragen. Dabei befällt es zunächst das Epithel des Verdauungstraktes und breitet sich in einem geringen Prozentsatz hämatogen aus (zyklische Allgemeininfektion).
Pathogenese: Das Virus gelangt in der Regel peroral in den Körper und vermehrt sich anschließend im Rachen- und Darmepithel. Von dort aus kann es dann das ZNS befallen.
Krankheitsbilder: In bis zu 95% der Fälle verläuft die Infektion inapparent und hinterlässt eine dauerhafte Immunität (stille Feiung).
In etwa 4-8% der Fälle kommt es etwa eine Woche nach der Infektion zu unspezifischen Symptomen wie Fieber, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen. Das ZNS ist bei dieser abortiven Poliomyelitis nicht befallen.
In etwa 1-2% kommt es zur nicht-paralytischen Poliomyelitis im Sinne einer aseptischen viralen Meningitis. Zu den vorgenannten Symptomen können dann noch Nackensteifigkeit und Muskelkrämpfe hinzutreten. Die Inkubationszeit beträgt 3 bis 7 Tage. Der Liquorbefund zeigt die für Viren typische Lymphozytose bei normalem Glukosespiegel (im Vgl. zur gleichzeitig bestimmten Blutglucose) und normalem bis moderat erhöhtem Protein.
In seltenen Fällen (0,1-1%) befällt das Poliovirus die Vorderhornzellen des Rückenmarks und ruft das paralytische Krankheitsbild der Kinderlähmung, klinisch (anatomisch) auch die Poliomyelitis (epidemica anterior acuta) (älteres, gelehrtes Griechisch πολιομυελίτις, neuer πολιομυελίτιδα „die Entzündung des grauen Marks“, von πολιός „der graue“ und μυελός „das Mark“), kurz die Polio oder die Heine-Medin-Krankheit hervor. Pathogenetisch kommt es durch die Einwanderung von Immunozyten ins Rückenmark und die Entzündungsreaktion zur Zerstörung der anterioren grauen Substanz. Die Folgen sind nach Stunden oder Tagen auftretende, mehr oder weniger ausgeprägte, asymmetrisch verteilte schlaffe Lähmungen, die vorwiegend die Beine, aber auch die Arme, die Rumpf- und die Augenmuskeln betreffen können. Durch die Affektion der Hirnnerven IX und X kann auch die Atemfunktion beeinträchtigt werden. Die sensible Wahrnehmung bleibt dabei meist erhalten.

Charakteristisch für den plötzlichen Beginn dieser Phase ist eine „Morgenlähmung“ des noch am Vorabend gesunden Kindes. Die Kinderlähmung tritt durch den frühzeitigen Kontakt mit dem Erreger hauptsächlich bei Kindern unter fünf Jahren auf. Oft bilden sich die Symptome innerhalb eines Jahres zurück, jedoch können Lähmungen und trophische Störungen der Haut zurückbleiben; auch Gelenkschäden aufgrund der Lähmungen und der veränderten Statik wie Skoliose der Wirbelsäule und Fußdeformitäten sowie gebremstes Längenwachstum einzelner Extremitäten können das Kind im Wachstum zum Invaliden machen. Für Erkrankte, bei denen Lähmungen auftreten, liegt die Letalität bei etwa 2-20%.

Manchmal treten biphasische Verläufe auf, bei denen nach Rückbildung der meningitischen (nicht-paralytischen) Symptome, zunehmend typische Polio-Lähmungen auftreten.
Jahre und Jahrzehnte nach einer akuten Poliomyelitis mit vollständiger oder partieller Symptomrückbildung kommt es bei etwa 20 bis 30% der Betroffenen zur Postpolio muskulären Dysfunktion (PPMD) bzw. zum Postpolio-Syndrom. Die Ursache ist unbekannt. Man nimmt eine sekundäre Nervendegeneration durch Überbeanspruchung an, da die überlebenden Motoneurone nach der Akutphase mit ihren Ausläufern aussprossen, um die denervierte Skelettmuskulatur wieder zu innervieren und die motorischen Einheiten danach oft das fünf- bis zehnfache der normalen Myozytenzahl umfassen. Symptome des Postpolio-Syndroms sind extreme Müdigkeit, Muskelschmerzen, progressive Muskelatrophien, Atem- und Schluckbeschwerden, Gelenkdeformationen, Muskelzucken und Kälteintoleranz. Für eine persistierende Poliovirus-Infektion gibt es beim Postpolio-Syndrom keine gesicherten Hinweise.
Diagnostik: Die Stuhldiagnostik ist in ca. 3/4 der Fälle positiv (in den ersten Wochen mit manifester Erkrankung). Eine Serodiagnostik ist mit dem Neutralisationstest (Nachweis von neutralisierenden Antikörpern) oder mit der Komplementbindungsreaktion (KBR) möglich. Mit der PCR können Virus-Nukleinsäuren nachgewiesen werden.
Therapie: Die Behandlung ist symptomatisch. Nach der Akutphase kann mit Physiotherapie und orthopädischen Maßnahmen eine Verbesserung der Folgeschäden erreicht werden.
Prophylaxe: Der Totimpfstoff nach Salk (Inaktivierte Poliovakzine, IPV) zur intramuskulären Injektion, enthält auf Affennierenzellkulturen gezüchtete, mit Hitze und Formaldehyd inaktivierte Virusbestandteile der 3 Typen. Die Impfung bietet 10 Jahre Schutz, allerdings unsicherer als mit dem Lebendimpfstoff. Eine Impfpolio und die Ansteckung Ungeimpfter ist bei der IPV ausgeschlossen.
Die Grundimmunisierung mit IPV umfasst 3 (Einzelimpfstoff) bis 4 (Kombinationsimpfstoffe) Impfdosen im 2., (3.,) 4. und 11.-14. vollendeten Lebensmonat. Für Kinder und Jugendliche im Alter von 9-17 Jahren wird eine Auffrischimpfung empfohlen. Eine spätere Auffrischung ist nicht notwendig, außer bei erhöhtem Risiko, wie Auslandsaufenthalte in Endemiegebieten u.ä.
Die Schluckimpfung mit dem Lebendimpfstoff nach Sabin (Orale Poliovakzine, OPV) ist eine Mischung aus den attenuierten (d.h. vermehrungsfähigen, aber nicht pathogenen) Viren der 3 Typen. Der Lebendimpfstoff gewährleistet für 5-10 Jahre einen effektiveren Schutz als der Totimpfstoff, in Deutschland ist er allerdings wegen der Seltenheit der Erkrankung nicht mehr üblich, da eine Impfpolio (Vakzine-assoziierte paralytische Poliomyelitis (VAPP)) bei dem Geimpften und auch bei nicht-geimpften Kontaktpersonen nun wahrscheinlicher ist (etwa 1 bis 2 Fälle pro Jahr in Deutschland zur Zeit der OPV) als die eigentliche Polioerkrankung. In Deutschland ist die Impfung mit OPV nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Gesundheitsbehörden zulässig zur Eindämmung von Epidemien, sogenannte Riegelungsimpfungen, für die sich die OPV besser eignet als die IPV. In Entwicklungsländern ist die Schluckimpfung für Massenimpfungen oft günstiger und praktikabler als die IPV.
Historie: Entscheidende Vorarbeiten lieferten John F. Enders, Frederick Chapman Robbins und Thomas Huckle Weller, die 1954 für ihre Entdeckung der Fähigkeit des Poliomyelitis-Virus, in Kulturen verschiedener Gewebstypen zu wachsen gemeinsam den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielten.
Impfstoffentwicklung: Jonas E. Salk entwickelte einen Impfstoff aus mit Formalin abgetöteten Polioviren (Totimpfstoff). Die Zulassung in den USA erfolgte 1955 und schon binnen kurzem konnte dort die Verbreitung von Polio auf ein Fünftel zurückgedrängt werden. Albert Sabin entwickelte die Schluckimpfung, die ab 1960 Verbreitung fand und neben des genannten effektiveren Schutzes noch den großen Vorteil aufwies, dass sie oral verabreicht werden konnte.
Gesetze: Nach § 6 IfSG sind der Krankheitsverdacht (jede akute schlaffe Lähmung ohne anderweitige Erklärung), die Erkrankung sowie der Tod an Poliomyelitis mit Namen meldepflichtig.
Weblinks: RKI - Poliomyelitis
Humane Coxsackieviren
| Humane Coxsackieviren | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
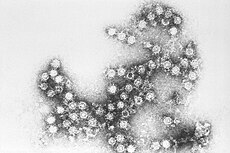 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
Bei den Coxsackie-Viren handelt es sich um unbehüllte Einzel(+)-Strang RNA-Viren der Gattung Enterovirus (Familie Picornaviridae), die sich auf die Arten Humanes Enterovirus A, B und C verteilen. Die Viren rufen vor allem grippale Infekte, virale Meningitiden und Myokarditiden hervor. Sie wurden nach einem Ort bei New York benannt, wo sie 1948 erstmals identifiziert wurden.
Merkmale: Zu den Coxsackie-Viren gehören die pathogenen Spezies A1 bis A22, A24 und B1 bis B6. Der Mensch stellt für diese Viren ein Reservoirwirt dar.
Verbreitung: Die Erreger kommen weltweit vor. So trat 1997 auch in Malaysia eine Epidemie mit dem Coxsackie-Virus auf, bei der in drei Monaten insgesamt 30 Kinder starben.
Übertragung: Menschen infizieren sich in der Regel über verunreinigte Nahrung und Wasser und per Tröpfcheninfektion, ferner über Kontakt-/Schmierinfektion.
Krankheitsbilder: Coxsackie-Viren hatten im April 2002 in Griechenland zur Schließung aller Schulen geführt. Wie die Aristoteles-Universität in Saloniki berichtete, haben sich damals insgesamt 46 Kinder und Erwachsene infiziert, von denen drei starben. Die Erreger gehörten zum B-Stamm der Cocksackie-Viren, der bei den Betroffenen unter anderem zur Myokarditis führte.
Coxsackie-Viren können je nach Serotyp auch eine Meningitis, Enzephalitis, Perikarditis u.a.m. verursachen. Des Weiteren können Infektionen mit Coxsackie-Viren der Gruppen A und B, vor allem in den Sommermonaten zu akuten Durchfallerkrankungen ("Sommerdiarrhoe") führen. Vor allem der Serotyp A 16 verursacht die Hand-Mund-Fuß-Krankheit.
Weblinks: DermIS - Hand-Fuß-Mund-Krankheit
Humane Echoviren
| Humane Echoviren | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||
ECHO-Viren sind RNA-Viren der Art Humanes Enterovirus B und der Gattung Enterovirus aus der Familie der Picornaviridae. Die Viren sind 24-30nm groß und besitzen ein nacktes Proteinkapsid, das etwa 75% der Virusmasse ausmacht und einen dichten zentralen Kern aus Einzel(+)-Strang-RNA enthält. Die RNA ist etwa 7,5kb lang.
Die ersten Echoviren wurden in den frühen 50igern aus dem Stuhl asymptomatischer Kinder isoliert kurz nachdem die Zellkultur etabliert war. Echovirus ist ein Akronym für „enteric cytopathic human orphan virus“. „Orphan virus“ meinte, dass das Virus nicht mit einer bekannten Erkrankung assoziiert war. Auch wenn sich das mittlerweile geändert hat, blieb der Name erhalten.
Echoviren sind hochinfektiös und vorwiegend bei Kindern anzutreffen, wo sie die führende Ursache von fieberhaften Infekten und aseptischer Meningitis sind. Gefährlich sind Infektionen in der Perinatalperiode (Leberversagen, Myokarditis). Die Viren vermehren sich zuerst im Nasopharynx und befallen dann die regionären Lymphknoten. Durch Verschlucken gelangen die Viren in den Magen-Darm-Trakt, wo sie an spezifische Rezeptoren andocken können. Nach Eindringen in den Organismus können sie praktisch jedes Organ befallen.
Hepatoviren
Hepatitis-A-Virus (HAV)
| Hepatitis-A-Virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
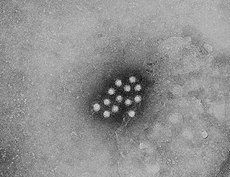 | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||
Das Hepatitis-A-Virus (HAV) ist ein unbehülltes Einzel(+)-Strang RNA-Virus und gehört zu den Hepatoviren aus der Familie der Picornaviridae. Das HAV ist die häufigste Ursache der akuten viralen Hepatitis weltweit. Das Virus ist in Ländern mit hohen hygienischen Standards selten anzutreffen. Es ist sehr resistent gegen hohe Temperaturen, Säuren und Laugen (beispielsweise Seifen und andere Reinigungsmittel) und es verbreitet sich fäkal-oral und über Kontakt- bzw. Schmierinfektion.
Vorkommen: HAV kommt in Südostasien, Russland, im vorderen Orient, Mittelmeerraum, in gesamt Afrika, Mittel- und Südamerika vor und wird häufig von Reisen aus diesen Ländern mitgebracht.
Übertragung: Die Übertragung der Hepatitis-A-Viren erfolgt fäkal-oral über engen Personenkontakt und verunreinigtes Trinkwasser, Säfte oder ungenügend gegarte Nahrungsmittel. Ein erhöhtes Risiko stellen fäkaliengedüngtes Gemüse (z.B. Salate) oder auch Meeresfrüchte (z.B. Muscheln) dar.
Diagnose: Die Diagnose wird klinisch gestellt, der laborchemische Nachweis erfolgt durch die Bestimmung des Serum-Anti-HAV-IgM. Alternativ lassen sich das HAV-Antigen oder die Virus-RNA per PCR im Stuhl nachweisen.
Verlauf: Die Inkubationszeit dieses Virus beträgt 15 bis 50 Tage. Die Hepatitis A kann akut über mehrere Wochen bis Monate verlaufen, die Ausheilung nimmt etwa 4 bis 8 Wochen (selten bis zu 18 Monaten) in Anspruch. Verglichen mit anderen Hepatitiden ist diese Erkrankung aber relativ milde. Besonders bei Kindern verläuft sie in der Regel harmlos, oft ganz asymptomatisch. Sie wird nicht chronisch und führt auch nicht zu einem dauerhaften Leberschaden. Die Infektiösität ist etwa ein bis zwei Wochen vor dem Ausbruch am höchsten, besteht aber auch noch eine Woche nach Erkrankungsbeginn. In 10% der Fälle ist eine stationäre Aufnahme notwendig.
Symptome: Nach ca. 28 Tagen entwickeln sich Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Fieber, Durchfall, Abgeschlagenheit, häufig anikterisch, selten schwer ikterisch mit dunklem Urin und Cholestase.

Prophylaxe: Eine Impfung ist möglich und wird bei Reisen in Risikogebiete (z.B. Südeuropa) empfohlen. Eine passive und eine aktive Immunisierung sind möglich. Der Impfstoff wird dreimal intramuskulär injiziert, das zweite Mal nach etwa zwei Wochen, das dritte Mal nach etwa einem halben Jahr. Eine zweite Möglichkeit der Grundimmunisierung besteht darin, bei der ersten Teilimpfung die doppelte Dosis zu injizieren und die zweite und letzte Teilimpfung nach einem Jahr mit der einfachen Dosis fortzusetzen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit einer zweimaligen Impfung im Abstand von 4 bis 6 Monaten, wobei die erste Impfung bei einer geplanten Reise schon Schutz bietet. Kinder können ab 12 Monaten geimpft werden. Auch ein HAV/HBV-Kombinationsimpfstoff ist erhältlich.
Weblinks: RKI - Hepatitis A
Rhinoviren
| Rhinovirus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||||
Rhinoviren sind neben den Adenoviren typische Erreger des gewöhnlichen Schnupfens (Rhinitis acuta).
Caliciviridae
Norovirus
Norwalk Virus
| Norwalk Virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||
Das Norovirus (abgekürzt NV, ehemals als Norwalk-Like-Virus, NLV, bezeichnet), ein Einzel(+)-Strang RNA-Virus ist für die Mehrzahl der nicht bakteriell verursachten Durchfallerkrankungen im Erwachsenenalter verantwortlich. Besonders gefährdet sind die Bewohner sowie das Personal von Gemeinschaftseinrichtungen aller Art.
Übertragungsweg
Die Viren werden über den Stuhl oder Erbrochenes ausgeschieden und meist auf fäkal-oralem Weg, auch über Aerosolbildung beim Erbrechen übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt durch Kontakt mit kontaminierten Gegenständen, Speisen und Getränken, oder kontaminierten Trinkwassers. [1]
Krankheitsbild
Krankheitssymptome entwickeln sich innerhalb weniger Stunden bis Tage und bestehen in erster Linie in plötzlich auftretendem Brech-Durchfall, der zu erheblichen Flüssigkeitsverlusten führen kann. Hinzu kommt ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl mit Übelkeit, Bauch-, Kopf- und Muskelschmerzen sowie Schwächegefühl.
Die Erkrankung verläuft meist kurz und heftig und klingt innerhalb von ein bis zwei Tagen wieder ab.
Erstbeschreibung
Der Prototyp der Noroviren, das Norwalk-Virus, wurde 1972 nach einem Gastroenteritis-Ausbruch in Norwalk, Ohio, immunelektronenmikroskopisch als eigenständige Spezies bestimmt. Dies war die erste elektronenmikroskopische Darstellung eines Virus überhaupt.
Epidemiologie
Noroviren werden zunehmend als Ursache für virale Gastroenteritiden erkannt. Weltweit verbreitet, weisen sie eine große Stabilität gegenüber Umwelteinflüssen auf. Sie überleben Temperaturschwankungen von -20 bis +60°C und zeigten ihre Überlebensfähigkeit auf einem kontaminierten Teppich noch nach zwölf Tagen. Mit einer minimalen Infektionsdosis von nur 10 bis 100 Viruspartikeln ist ihre Kontagiosität außerordentlich hoch. Dementsprechend erfolgt die Übertragung zwar hauptsächlich von Mensch zu Mensch, kann aber auch über infizierte Getränke, Speisen und Gegenstände erfolgen.
Endemische NV-Infektionen wurden bislang v.a. in Krankenhäusern (gehäuft in geriatrischen Abteilungen) und Alters- oder Pflegeheimen nachgewiesen. In der Schweiz muss Schätzungen zufolge jährlich mit 400.000 bis 600.000 NV-Infektionen gerechnet werden.
Therapie
Die Behandlung ist symptomatisch und besteht im Ausgleich von Flüssigkeits- und Elektrolytverlusten.
Prg: Der Verlauf ist selbstlimitierend und hinterlässt keine Immunität.
Meldepflicht: Laboratoriumsleiter müssen nach § 7 IfSG den direkten Nachweis von Noroviren melden. Ärzte müssen nach § 6 IfSG den Krankheitsverdacht und die Erkrankung an einer akuten infektiösen Gastroenteritis melden bei Personen, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 IfSG ausüben. Weiterhin besteht für Ärzte Meldepflicht, beim Auftreten von zwei oder mehr ähnlichen Erkrankungen, bei denen ein epidemiologischer Zusammenhang nahe liegt.
Einzelnachweis
- ↑ Noroviren im Trinkwasser W.Soddemann, Juni 2013
Weblinks
Hepevirus
Hepatitis-E-Virus (HEV)
| Hepatitis-E-Virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||
Das HEV ist ein etwa 32-34nm großes, unbehülltes Einzel(+)-Strang RNA-Virus, das früher der Familie Caliciviridae zugeordnet wurde, heute aber der Familie der Hepeviridae zugeordnet wird, dessen einzige humanpathogene Art es darstellt. Die Erkrankung tritt meist in anikterischer Form auf und wurde erstmals 1980 in Indien entdeckt. Vieles spricht dafür, dass das HEV eine Zoonose ist, da ähnliche Viren auch bei Schweinen, Affen, Rehen, Mäusen und Schafen nachgewiesen werden konnten.
Vorkommen: Die Hepatitis E ist die zweithäufigste Hepatitis in Nordafrika und Vorderasien, speziell im Sudan und Irak. In Deutschland wurden 2001 insgesamt 34 Fälle gemeldet. Die Erkrankungen waren nach Auslandsreisen in Endemiegebiete aufgetreten.
Übertragung: Der Übertragungsweg ist fäkal-oral über Kontakt- und Schmierinfektion sowie über Wasser.
Verlauf: Die Erkrankung hat eine Inkubationszeit von 30 bis 40 Tagen und ist klinisch nicht von der Hepatitis A zu unterscheiden. Sie ist jedoch schwerer im Verlauf, in 0,5 bis 4% der Fälle sogar tödlich. Besonders Schwangere sollten nicht in Endemiegebiete reisen, da eine Infektion in der Schwangerschaft mit einer mütterlichen Sterblichkeit von ca. 20% verbunden ist.
Vorbeugung: Eine aktive Immunisierung existiert zur Zeit noch nicht. Ein Impfstoff ist in Nepal in Erprobung.
Gesetze: Nach § 6 IfSG sind der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an einer akuten Virushepatitis mit Namen meldepflichtig.
Weblinks: RKI - Hepatitis E
Astroviridae
Humane Astroviren
| Humanes Astrovirus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| nackt, ikosaedrisch | ||||||||||
Über Astroviren ist nicht viel bekannt, da sie sich im Labor nicht anzüchten lassen. Das Virus gehört zur Familie der Astroviridae und wurde 1975 erstmals beschrieben, als bei einem Diarrhoe-Ausbruch zur Diagnostik auch das Elektronenmikroskop verwendet wurde.
Astroviren besitzen eine nicht-segmentierte Einzel(+)-Strang-RNA in einem unbehüllten, ikosaedrischen Kapsid. 1995 konnten Roderick et al. zeigen, dass Astroviren die wichtigste virale Ursache infektiöser Magen-Darm-Erkrankungen in England sind.[1]
Quellen
- ↑ Roderick P et al. “A pilot study of infectious intestinal disease in England”. Epidemiol Infect., 114(2):277-88, Apr 1995. PMID:7705491
Coronaviridae
| Coronaviridae | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||||||
| umhüllt, helikal | ||||||||||||||||||||||
Coronaviren (Coronaviridae) sind eine seit langem bekannte Familie von behüllten Einzel(+)-Strang-RNA-Viren. In ihr sind die beiden Gattungen Coronavirus und Torovirus vertreten. Die Gattung Coronavirus enthält mehr als 13 verschiedene Arten, die verschiedene Wirbeltiere wie Hunde, Katzen, Rinder, Schweine sowie einige Nagetiere und Vogelarten infizieren.
Der Name leitet sich vom Aussehen der Viren ab: auf der äußeren lipidhaltigen Virushülle sitzen in regelmäßigen Abständen Glycoproteine mit keulenförmigen Enden. Dadurch erinnern sie an einen Kranz (corona). Die Viren sind unregelmäßig geformt und besitzen einen Durchmesser zwischen 60 und 220nm. Sie enthalten eine 20-30kB lange unsegmentierte (+)-Strang-RNA. Diese wird in der Zelle direkt in Proteine übersetzt. Dabei entsteht unter anderem das Enzym RNA-abhängige RNA-Polymerase, welche das Genom zunächst in einen Antigenom(-)-Strang umschreibt. Von diesem werden wiederum (+)-Stränge gebildet. Außerdem werden von dem Genom subgenomische mRNAs transkribiert, die für weitere Proteine codieren.
Humanpathogene Coronaviren infizieren vor allem den oberen Atemwegs- und den Gastrointestinaltrakt. Zwei Arten, das Human Coronavirus 229E und das Human Coronavirus OC43, gemeinsam mit HCoV abgekürzt, verursachen beim Menschen Erkältungssymptome. Etwa ein Drittel aller Erkältungskrankheiten werden von HCoV ausgelöst. Das HCoV NL63 wurde 2003 in den Niederlanden bei einem Kind mit Bronchiolitis identifiziert[1] und mittlerweile fast weltweit nachgewiesen (Belgien, Japan, Australien, Kanada). Das Virus benutzt wahrscheinlich den gleichen Zell-Rezeptor wie das SARS-CoV.[2]
Das im März 2003 ausgebrochene Schwere Akute Atemwegssyndrom (SARS) wird ebenfalls von einem Coronavirus, dem SARS-CoV verursacht.
Coronaviren sind empfindlich gegen Lipoidlösungsmittel.
Humanpathogene Coronaviren:
- HCoV 229E und OC43: Erkältungskrankheiten
- HCoV NL63: Bronchiolitis
- SARS-CoV (SARS-assoziiertes Coronavirus): Erreger des schweren akuten Atemwegssyndroms (SARS) des Menschen. Das Virus kann auch eine Gastroenteritis auslösen.
Tierpathogene Coronaviren:
- FCoV (Felines Coronavirus): Erreger der felinen infektiösen Peritonitis (FIP) der Katzen.
- HEV: Haemagglutinating Encephalomyelitis-Virus der Schweine, verursacht Erbrechen und Kümmern bei Saugferkeln, Aufreibung des Bauches, trichterförmige Einziehung des Brustkorbes, Rhinitis und Tracheitis.
- IBV: Erreger der infektiösen Bronchitis der Vögel. Verursacht Infekte der oberen Atemwege.
- MHV (Mäuse-Hepatitis-Virus). Verursacht Hepatitis, Aszites, Enzephalomyelitis (Verwandtschaft mit menschlichen Stämmen).
- TGE-Virus: Erreger der transmissiblen Gastroenteritis der Schweine (TGE). Es verursacht schwere Diarrhoe bei jungen Ferkeln. Bei neugeborenen Ferkeln erreicht die Mortalität meist 100 Prozent.
Literatur und Weblinks:
- I. Stock: Coronaviren als Krankheitserreger des Menschen. Chemotherapie Journal 13(1), S. 17 - 26 (2004), ISSN 0940-6735
- I. Stock: Coronaviren: Erreger von SARS und anderen Infektionen. Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 27/1), S. 4 - 12 (2004), ISSN 0342-9601
SARS-CoV
Das Schwere Akute Atemwegssyndrom (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) ist eine Infektionskrankheit, die erstmals im November 2002 in der chinesischen Provinz Guangdong beobachtet wurde. Laut dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg entspricht das klinische Bild einer atypischen Pneumonie. Der Erreger von SARS war ein bis zum Ausbruch der Epidemie unbekanntes Coronavirus, das man mittlerweile als SARS-assoziiertes Coronavirus (SARS-CoV) bezeichnet.[3][4][5]
Krankheitsbild: SARS-CoV befällt sowohl den oberen als auch den unteren Respirationstrakt. Die Inkubationszeit beträgt 2 bis 7 Tage. Symptome des Severe Acute Respiratory Syndrome sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO): Plötzlich auftretendes, schnell steigendes, hohes Fieber (über 38°C), Pharyngitis mit Husten und Heiserkeit, Atemnot, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und die bilaterale interstitielle Pneumonie. Thrombozytopenie und Leukozytopenie sollen ebenfalls im Rahmen der Krankheit auftreten.
Übertragungsweg: Die Erregerübertragung erfolgt überwiegend durch Tröpfcheninfektion aus kurzer Distanz (< 1m) und damit bei engem Kontakt mit hustenden und niesenden Infizierten. Eine fäkal-orale Übertragung kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Weiterhin ist laut WHO eine Erregerübertragung durch infizierte Tiere (z.B. Kakerlaken) möglich.
Therapie: symptomatisch, Antibiose zur Prophylaxe bakterieller Superinfektioonen.
Prognose: Die erste umfangreiche wissenschaftliche Studie über die Ausbreitung der Seuche, basierend auf exakten Daten aus Hong Kong ergab, dass SARS bei Menschen, die jünger als 60 Jahre sind, in 7 bis 13% der Fälle tödlich verläuft, bei Menschen über 60 sogar in 43 bis 55% der Fälle.
Skizzierung einer abgeklungenen Epidemie:


Die Lungenkrankheit ging nach Angaben der WHO von der chinesischen Provinz Guangdong aus. Im Februar 2003 breitete sich die Erkrankung dann auf Vietnam und Hong Kong aus; in Vietnam wurde das erste Auftreten der Krankheit in Hanoi am 26. Februar 2003 beobachtet.
Bis Mitte März 2003 wurden der WHO 150 weitere Krankheitsfälle, meistens aus den asiatischen Ländern der Volksrepublik China, Vietnam, Hong Kong, Indonesien, Singapur, Thailand und den Philippinen, gemeldet. Bis dahin waren auch über 200 Fälle in Kanada aufgetreten. Auch in Japan wurden bei Personen, die in die betroffenen asiatischen Regionen gereist waren, die ersten SARS-Verdachtsfälle registriert. Am 12. April wurde gemeldet, dass sogar in der chinesischen Inneren Mongolei erstmals 2 Menschen an SARS gestorben seien. Zudem hätten sich in der abgelegenen Region weitere 8 Menschen mit dem Virus infiziert. Dann wurde offiziell bestätigt, dass es dort weitere Betroffene gab. In Großbritannien und Deutschland wurden bis zum 14. April je 6 Fälle einer SARS-Infektion gemeldet. Erstmals infizierte sich auch innerhalb Europas ein Mensch mit SARS, der nicht nach Südostasien gereist war.
Das Lungenvirus hatte nach Angaben der WHO zum damaligen Zeitpunkt 916 Menschen getötet, davon 290 in Hong Kong und 343 in den 5 chinesischen Provinzen. 81 SARS-Tote gab es in Taiwan, 32 in Kanada, 31 in Singapur, 5 in Vietnam. Rund 8.400 Personen wurden in 32 verschiedenen Ländern weltweit infiziert, vor allem in asiatischen Ländern. Dabei unterschied die WHO zwischen Ländern, in denen lokale Infektionsketten bestanden, d.h. Neuansteckungen auftraten und Ländern, in denen die Erkrankung nur bei Reisenden auftrat, die sich in den Ländern der ersten Kategorie infiziert hatten. Länder mit lokalen Infektionsketten waren die Volksrepublik China, Hong Kong, Singapur, Kanada, Vietnam, Taiwan, die USA und Großbritannien. Der Schwerpunkt der Erkrankung lag dabei in China und Hong Kong, wo mehr als 80% der Fälle auftraten.
In Hongkong starben damals immer mehr jüngere Menschen an SARS. In China wurde die Zahl der Erkrankten mit rund 5.300 angegeben. Peking war am schwersten betroffen. Das Zentrum der damaligen Epidemie war Guangdong. In Hongkong, wo es offenbar die verlässlichsten Daten gab, wurden rund 1.750 Personen infiziert. Besonders verbreitet war das Virus hier unter Klinikmitarbeitern. Im weiteren Verlauf der Epidemie starb auch ein Ausländer in China am akuten Atemnotsyndrom. Es handelte sich dabei um einen 53jährigen Finnen, der für die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in Peking eine Konferenz vorbereitet hatte. Am 20. April 2003 wurden der chinesische Gesundheitsminister Zhang Wenkang und der Bürgermeister von Peking Meng Xuenong wegen steigender Kritik in ihrem Umgang mit der Gefahr durch SARS ihrer Ämter enthoben. Kurz davor legte China deutlich höhere Zahlen von Infektionen vor.
Am 29. März 2003 starb der italienische Arzt Carlo Urbani, der als Erster auf die Lungenkrankheit aufmerksam gemacht hatte, selbst in Thailand an dem Virus.
Im Sommer 2003 ging die Zahl der Erkrankten beständig und schließlich vollständig zurück. Im Dezember 2003 gab es noch eine Neuerkrankung bei einem Militärarzt in Taiwan, der mit dem Virus experimentierte.
Weblinks:
Quellen
- ↑ Van der Hoek L et al. “Identification of a new human coronavirus”. Nat Med., 10(4):368-73, Apr 2004 [Epub Mar 21 2004].
- ↑ Hofmann H et al. “Human coronavirus NL63 employs the severe acute respiratory syndrome coronavirus receptor for cellular entry”. Proc Natl Acad Sci U S A, 102(22):7988-93, May 31 2005.
- ↑ Peiris JSM et al. “Coronavirus as a possible cause of severe acute respiratory syndrome”. The Lancet, 361(9364), Apr 5 2003.
- ↑ Paul A et al. “Characterization of a Novel Coronavirus Associated with Severe Acute Respiratory Syndrome”. Science, 300(5624):1394–1399, May 30 2003 [Epub May 1 2003]. DOI:10.1126/science.1085952.
- ↑ Marra MA et al. “The Genome Sequence of the SARS-Associated coronavirus”. Science., 300(5624):1399–1404, May 30 2003 [Epub May 2003]. DOI:10.1126/science.1085953.
Flaviviridae
Die Flaviviridae stellen eine Familie Einzel(+)-Strang-RNA-Viren dar. Da als Typspezies der gesamten Familie das Gelbfieber-Virus (flavus: gelb) gilt, werden diese Viren auch als Flaviviren bezeichnet.
Alle Vertreter dieser Familie sind behüllt und haben eine Größe zwischen 40- 60nm. Die Viren vermehren sich im Zytoplasma der Wirtszelle. Sie sind im Bereich von pH7-9 stabil. Es gibt verschiedene Subgruppen, wobei alle Viren serologisch miteinander verwandt sind.
Zu den Flaviviridae zählen die Gattungen Flavivirus, Pestivirus und die Hepatitis-C-Virusgruppe (Hepaciviren). Die Erreger der Gattung Flavivirus rufen sowohl beim Menschen, als auch beim Tier eine große Anzahl an Virusinfektionen hervor. Hierzu zählen u.a. das Gelbfieber, Dengue-Fieber, die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), das West-Nile-Fieber, die Wesselsbron-Krankheit (Schafe, Ziegen u.ä.) und die japanische B-Enzephalitis (Vögel und Schweine). Hauptvertreter der Hepatitis-C-Viren ist das HCV-Virus, das die Hepatitis C beim Menschen hervorruft. Die Viren der Gattung Pestivirus spielen vor allem bei Tieren als Krankheitserreger eine Rolle. Hierzu zählt u.a. das SP-Virus als Auslöser der Klassischen Schweinepest, das BVD/MD-Virus (Bovine Virusdiarrhoe) und die Border Disease der Schafe.
Hepaciviren
Hepatitis-C-Virus (HCV)
| Hepatitis-C-Virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||
Das Hepatitis-C-Virus (HCV) wurde im Jahre 1988 mit Hilfe gentechnischer Methoden erstmals identifiziert (vorher Hepatitis non-A non-B genannt). Es ist ein 45nm großes behülltes Einzel(+)-Strang-RNA-Virus und gehört zu den Hepaciviren aus der Familie der Flaviviridae. Es gibt sechs Genotypen und 30 Subtypen. In Europa und in den USA überwiegen die Genotypen 1, 2 und 3 und in Afrika Typ 4. Der Mensch ist der einzige Wirt des HCV.
Übertragung: Bei etwa der Hälfte der Erkrankungen lässt sich im Nachhinein der Infektionsweg nicht mehr nachvollziehen. Erhöhte Infektionsgefahr besteht für i.v.-Drogenabhängige (Spritzentausch), auch beim unhygienischen Tätowieren und Piercen kann das HCV übertragen werden. Häufige Infektionswege sind die Verletzung mit spitzen und scharfen Instrumenten (Nadelstichverletzung) mit kontaminiertem Blut. Das Risiko der Ansteckung nach einer Nadelstichverletzung bei bekannt positiven HCV-Patienten wird in der Literatur mit 3 bis 10% angegeben, erscheint aber abhängig vom Genotyp.
Bis etwa 1990 traf es viele Hämophilie-Patienten, die HCV- und HBV-kontaminierte Gerinnungspräparate erhielten. Mit der Einführung moderner Testverfahren, mit deren Hilfe heute über 99% der Hepatitis-C-positiven Spender identifiziert werden können, besteht nur noch ein minimales Risiko.
Eine Übertragung des Virus durch andere Körperflüssigkeiten als Blut (z.B. Speichel) wurde bisher nicht beobachtet. Das Risiko der Übertragung beim GV ist abhängig vom Sexualverhalten, wird jedoch als niedrig gewertet. Das Risiko einer vertikalen Transmission liegt bei unter 5%.
Verbreitung: Für das Jahr 2005 wurden 8.308 Erstdiagnosen in Deutschland gemeldet.[1]. Davon wurden etwas mehr als 50% labordiagnostisch festgestellt ohne typisches klinisches Krankheitsbild. Eine Unterscheidung zwischen akuten und schon länger bestehenden HCV-Infektionen ist allerdings nicht möglich.
Weltweit sind etwa 170 Millionen Menschen mit dem HC-Virus infiziert, in Deutschland sind 400.000 bis 500.000 Menschen davon betroffen.[2].
Verlauf: Die Hepatitis C ist eine der Infektionskrankheiten, die in der Akutphase aufgrund des meist symptomlosen oder symptomarmen Verlaufs in 75% nicht diagnostiziert wird. In 25% kommt es zur (milden) Hepatitis, fulminante Verläufe sind selten. Die Akutphase geht jedoch in 50-85% der Fälle in eine chronische Verlaufsform über und führt bei ca. 1/4 der chronisch Hepatitis C-Kranken im Langzeitverlauf nach 20 bis 30 Jahren zur Leberzirrhose. Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko von 1-5%/Jahr für das Auftreten eines Leberzellkarzinoms.
Die chronische Hepatitis C verursacht nur milde, unspezifische Symtome wie Müdigkeit, Oberbauchbeschwerden, evtl. auch Juckreiz und Gelenkbeschweden. Extrahepatische Manifestationen wie z.B. Arthritis, vaskulitische Purpura, Kryoglobulinämie, membranoproliferative Glomerulonephritis, oder Porphyria cutanea tarda können auftreten.
Diagnostik: Die Diagnose erfolgt durch den Nachweis virusspezifischer Antikörper (ab der 6.-8. Woche nach Infektion) gegen Struktur-und Nichtstrukturproteine mittels Enzymimmunoassays (ELISA) und Immunoblots sowie durch Nachweis von HCV-RNA mittels RT-PCR bei Neugeborenen HCV-positiver Mütter. Dazu kommt der Nachweis auffällig erhöhter Leberwerte, die sich nicht durch übermäßigen Alkoholkonsum oder Cholestase erklären lassen. Das Ausmaß der Leberschädigung lässt sich histopathologisch bestimmen. Anders als bei anderen Hepatitiden korrelieren die Transaminasen kaum mit der Schwere bzw. dem Stadium der Erkrankung.
Risikopersonen sollte zusätzlich ein HIV-Test angeboten werden.
Therapie: Die akute Hepatitis C kann mit einer Interferon-Monotherapie über 24 Wochen fast immer geheilt werden.
Die Behandlung der chronischen Hepatitis C besteht aus einer kombinierten Therapie mit pegyliertem Interferon Alpha und dem Virostatikum Ribavirin über eine Dauer von 24 bis 48 Wochen. Abhängig von dem vorliegenden Genotyp besteht mit dieser Therapie eine Chance von etwa 40-50 % (Genotyp 1,4,5,6) bis 80 % (Genotyp 2,3) das Virus dauerhaft zu eliminieren. PEG-IF-alpha besitzt ein verlängerte Halbwertszeit und wird einmal pro Woche verabreicht.
Allerdings ist bei dieser Behandlung mit zahlreichen Nebenwirkungen zu rechnen. Insbesondere PEG-IF-alpha kann psychische Nebenwirkungen wie Aggressivität, Depressionen und Angstzustände hervorrufen. Weitere wichtige Faktoren für einen Therapieerfolg sind Alter, Virusmenge, Dauer der Erkrankung, Körpergewicht und Schädigungsgrad der Leber.
Chronische Patienten, die für die Therapie in Frage kommen müssen vorher eingehend untersucht und beraten werden!
Vorbeugung: Trotz intensiver Bemühungen wurde bis heute kein wirksamer Impfstoff zur aktiven Immunisierung gegen Hepatitis C gefunden. Schutzmaßnahmen bestehen vor allem darin, Blut-zu-Blut-Kontakte mit Infizierten(Nadelstichverletzungen) zu vermeiden und bei intravenösem Drogenkonsum immer ein neues Spritzbesteck zu verwenden.
Es gibt keine Postexpositionsprophylaxe nach einer Infektion mit Hepatitis C, wie sie z. B. bei Hepatitis B oder HIV bekannt ist. Wird eine Hepatitis C jedoch im ersten halben Jahr nach der Infektion entdeckt und behandelt, kann eine 24-wöchige Interferon-Therapie in mehr als 90% der Fälle zur Heilung führen, bevor die Erkrankung einen chronischen Verlauf nimmt.
Forschung: 2004 gelang es jeweils einer Forschergruppe aus Japan (Takaji Wakita, Tokyo) und Deutschland (Ralf Bartenschlager, Heidelberg), infektiöse Hepatitis-C-Viren in Zellkultur herzustellen und damit neue Zellen zu infizieren. Dieselben beiden Gruppen sowie die Gruppen um Charles M. Rice (Rockefeller University, New York) und Frank V. Chisari (Scripps Research Institute, San Diego) stellten 2005 eine effiziente Weiterentwicklung des ursprünglichen Systems vor. Dadurch kann die Forschung an neuen Behandlungswegen wie Medikamenten und Impfungen eröffnet werden
Gesetze: In Deutschland sind nach § 6 des IfSG der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an einer akuten Virushepatitis mit Namen meldepflichtig.
Weblinks:
Hepatitis-G-Virus (HGV)
| Hepatitis-G-Virus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||
Der Erreger der sogenannten "Hepatitis G" (früher HGV) ist ein behülltes Einzel(+)-Strang-RNA-Virus aus der Gattung Hepacivirus der Familie Flaviviridae. Es wird heute in Anlehnung an die Initialen des ersten Patienten, bei dem 1996 eine Isolierung des Virus gelang, als GB-Virus bezeichnet (die Bezeichnung Hepatitisvirus ist obsolet). Nachdem man bei Affen analoge Viren (GBV-A und GBV-B) fand, wird die menschliche Variante als GB-Virus-Typ C (GBV-C) bezeichnet.
Übertragung: Die Übertragung geschieht über Blut und Blutprodukte, per Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion und durch Austausch von Körperflüssigkeiten.
Die Infektion kommt etwas häufiger in Zusammenhang mit einer Hepatitis C vor und ist vor allem unter Drogenabhängigen verbreitet. In der Normalbevölkerung sind etwa 60% GBV-C infiziert ohne daß irgendeine Erkrankung damit assoziiert werden konnte. Unklar ist, welche Bedeutung dieses Virus beim Menschen hat, denn es gilt als unwahrscheinlich, dass es eine eigenständige Erkrankung verursacht. Sicher ist die Infektion nicht mit einer Hepatitis assoziiert, wie zunächst vermutet wurde. Der einzige klinische Effekt, der gezeigt werden konnte, ist daß HIV-Infizierte, bei denen GBV-C nicht nachweisbar war eine höhere HIV-Replikation zeigen als solche, bei denen GBV-C vorhanden ist. Dieser suppressive Effekt des GBV-C auf HIV ist in seinem Mechanismus völlig ungeklärt.
Diagnose: Die Virus-RNA des GBV-C kann bei wissenschaftlichen Fragestellungen in Speziallabors nachgewiesen werden.
Flavivirus
FSME-Virus / Tick-borne encephalitis virus
| FSME-Virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
Das FSME-Virus ist der humanpathogene Erreger der Frühsommer-Meningoenzephalitis aus der Familie der Flaviviridae. Es handelt sich um ein behülltes Einzel(+)-Strang-RNA-Virus, von dem drei Subtypen unterschieden werden[3]:
- Far Eastern Subtype: Vorkommen hauptsächlich in Russland, östlich des Urals und in Teilen von China, Japan und Korea, Überträger dieses Subtyps ist Ixodes persulcatus, die Letalität dieses Subtyps liegt bei bis zu 20%.
- Western Subtype: Vorkommen in Zentral-, Ost- und Nord-Europa, Überträger ist Ixodes ricinus, Letalität beträgt bis zu 2%.
- Siberian Subtype
Das Viruskapsid besteht aus drei Strukturproteinen, dem Envelope-Protein E, dem Core-Protein C und dem Membrane-Protein. Das Glykoprotein E spielt eine zentrale Rolle in der Biologie der Infektion und ist für die Bindung und das Eindringen in die Zielzelle verantwortlich. Es gehört zu den am besten charakterisierten viralen Proteinen überhaupt.
Vektor: Zecken (Ixodida sp.) sind die Hauptvektoren und das Hauptreservoir der FSME. Die Krankheit selbst wurde erstmals 1931 bei Forstarbeitern aus Neunkirchen (Österreich) beschrieben, der Erreger 1949 isoliert.
Das endemische Auftreten von FSME ist immer mit großen Flüssen assoziiert. Die Gründe dafür sind bis dato unklar.
FSME: Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, engl. tick-borne encephalitis, TBE) ist eine durch das FSME-Virus ausgelöste Erkrankung, die mit grippeähnliche Symptomen, Fieber und bei einem Teil der Patienten mit einer Meningoenzephalitis verläuft. Beim Großteil der Infizierten treten jedoch keine Krankheitszeichen auf. Eine ursächliche Behandlung der FSME ist nicht möglich. Übertragen wird die Krankheit durch den Stich einer infizierten Zecke in Risikogebieten, hauptsächlich durch Ixodes ricinus, den gemeinen Holzbock. Neben allgemeinen Schutzmaßnahmen wie dem Absuchen des Körpers nach einem Waldbesuch ist die aktive Impfung die wichtigste vorbeugende Maßnahme. Sie wird, national etwas unterschiedlich, für alle Personen, die sich in Risikogebieten aufhalten, empfohlen. Die Erkrankung an FSME ist meldepflichtig.

Übertragung: Der Verursacher der Frühsommer-Meningoenzephalitis ist das FSME-Virus, ein humanpathogenes Virus aus der Familie der Flaviviridae.[4] Dieses Virus ist ein behülltes Einzelstrang-RNA-Virus, von dem derzeit drei Subtypen (Western, Siberian, Far Eastern Subtype) bekannt sind.
Der in Europa vorkommende Western Subtype des FSME-Virus wird durch den Stich einer infizierten Zecke übertragen. Wichtigste Vektoren in Mitteleuropa sind die Arten der Gattung Ixodes mit der häufigsten einheimischen Art, dem Gemeinen Holzbock (Ixodes ricinus) sowie Ixodes persulcatus, seltener auch die Gattungen Rhipicephalus, Dermacentor, Haemaphysalis, Amblyomma und aus der Familie der Lederzecken die Gattungen Argas und Ornithodorus.
Das FSME-Virus gelangt beim ersten Einstich direkt aus der Speicheldrüse der Zecke in den Körper ihres Opfers. Im Gebüsch, an Waldrändern oder im hohem Gras auf Wiesen besteht das größte Risiko eines Zeckenstiches, weil dort Kleinsäugetiere (Mäuse, Vögel) und Wild als Hauptwirte (primäres Erregerreservoir) dieser Blut saugenden Parasiten leben. In Höhen oberhalb von 1000 Metern kommen keine Zecken vor. In Risikogebieten liegt der Anteil der FSME-infizierten Zecken bei etwa 1 bis 5% (2004).[5]
Die Übertragung durch virusinfizierte Milchprodukte von Ziegen und Schafen, in Ausnahmefällen auch von Kühen ist sehr selten. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich.
Durch Zecken kann auch das Bakterium Borrelia burgdorferi übertragen werden und zur Lyme-Borreliose führen, die wesentlich häufiger als die FSME auftritt und in Deutschland auch nicht auf bestimmte Risikogebiete begrenzt ist.
Häufigkeit: In Deutschland ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis seit 2001 nach § 7 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz durch den Leiter des diagnostizierenden Labors meldepflichtig. Im Jahr 2004 wurden insgesamt 274 und im Jahr 2005 432 Fälle gemeldet, die den Falldefinitionen des Robert-Koch-Institutes (RKI) entsprachen. Aufgrund der grippeähnlichen, oft unspezifischen Symptomatik ist jedoch eine hohe Dunkelziffer von Erkrankungen möglich.
In der Schweiz erkranken pro Jahr etwa 100 Personen an FSME. Die Erkrankungsraten sind in den letzten Jahren im Steigen begriffen, wofür ein ungenügendes Impfbewusstsein in den Risikogebieten verantwortlich gemacht wird.
In Österreich gab es zwischen 1999 und 2004 41 bis 82 FSME-Erkrankungen, 2005 stieg die Zahl auf 100 Erkrankungen.[6] mit 3 Todesfällen[7]
Risikogebiete: Als FSME-Risikogebiete gelten Landkreise, in denen im Zeitraum von einem Jahr mindestens zwei oder innerhalb einer 5-Jahresperiode mindestens fünf Erkrankungen festgestellt wurden. Dabei muss die Ansteckung im selben Gebiet erfolgt sein. Als Hochrisikogebiete gelten diejenigen Risikogebiete, in denen innerhalb von fünf Jahren mindestens 25 Krankheitsfälle auftraten.
In Deutschland gelten die meisten Landkreise Baden-Württembergs und Bayerns sowie einzelne Kreise in Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen als Risikogebiete. Hochrisikogebiete sind der Schwarzwald in Südbaden, der südhessische Odenwald sowie die Region um Passau.[8]
In der Schweiz finden sich Risikogebiete in den nördlichen Landesteilen, am häufigsten im Kanton Zürich, gefolgt von Thurgau, St. Gallen, Aargau und Bern.
Österreich gilt als ein Kernland der FSME-Virusverbreitung in Europa, das gesamte Bundesgebiet ist Zecken-Endemiegebiet, wobei sich die FSME in den Alpen auf die größeren Täler beschränkt. Die meisten Erkrankungen gab es 2005 in der Steiermark, Oberösterreich und Tirol, jedoch gab es in allen Bundesländern FSME-Fälle.[9] Die Hochrisikogebiete befinden sich entlang der Donau in Wien, in der Wachau, im Gebiet von St. Pölten sowie zwischen Passau und Linz. Auch große Teile des Burgenlandes, Kärntens und der Steiermark sowie das Tiroler Inntal sind Gebiete mit hohem Risiko, dazwischen finden sich weitere Risikogebiete. In Österreich erkranken trotz der weiten Verbreitung verhältnismäßig wenig Personen an FSME, was an der hohen Impfrate von rund 90% liegt.[10]
In anderen europäischen Ländern ist die Situation sehr unterschiedlich. Besonders ausgeprägt ist das Risiko in Russland, der Tschechischen Republik und europaweit am höchsten in den baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland. Eine nicht unerhebliche Bedeutung besitzt die FSME außer in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor allem in Polen, Ungarn, Kroatien, Schweden, Finnland und der Slowakischen Republik. Nur selten wird ein Vorkommen in Frankreich, Italien, Dänemark und Griechenland beobachtet, überhaupt keines im Vereinigten Königreich, den Benelux-Ländern und auf der iberischen Halbinsel.[10]
Aus bislang unbekannten Gründen ist das endemische Auftreten der FSME mit großen Flüssen assoziiert.
Symptome und Krankheitsverlauf: Nur etwa 10-30% der Infizierten zeigen Symptome, bei den übrigen verläuft die Krankheit asymptomatisch. Zwei bis zwanzig Tage nach der Infektion treten grippeähnliche Symptome mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen auf, die sich nach wenigen Tagen wieder zurückbilden.
Wiederum nur bei einem kleinen Teil (etwa 10%) der symptomatischen Patienten kommt es etwa eine Woche nach der Entfieberung zu einem weiteren, zweiten Fiebergipfel mit bis zu 40 °C Körpertemperatur und den Zeichen der Gehirn- und Hirnhautbeteiligung, Erbrechen sowie Hirnhautzeichen (meningeale Reizzeichen). Schreitet die Meningoenzephalitis fort, treten Bewusstseinsstörungen bis zum Koma und Lähmungen auf. Diese Symptome können mehrere Monate anhalten, häufig kommt es jedoch selbst nach schweren Verläufen zur völligen Ausheilung.[11]
Diagnostik: Ein erinnerlicher Zeckenstich in der Anamnese und die neurologische Untersuchung geben Hinweise auf eine Erkrankung. Im Liquor zeigt sich ab dem zweiten Fiebergipfel eine Pleozytose mit Eiweißerhöhung.
Beweisend für eine FSME ist der Nachweis von IgM- und IgG-Antikörpern gegen das Virus in Serum oder Liquor mittels ELISA. Auch dieser Nachweis ist erst mit Beginn der zweiten Fieberphase möglich. Allerdings kann eine FSME-Impfung zu positiven Antikörpertitern führt. Spezialverfahren zum direkten Virusnachweis sind die RT-PCR sowie der Western Blot.[5]
Behandlung und Prognose: Eine kausalen Therapie existiert nicht. Das therapeutische Spektrum symtomatischer Maßnahmen umfasst Bettruhe, den Einsatz von Antipyretika und Schmerzmitteln sowie Glukokortikoiden. In schweren Fällen ist eine intensivmedizinische Behandlung mit parenteraler Ernährung und Flüssigkeitsersatz, eventuell auch Intubation und kontrollierter Beatmung notwendig.
Im Rahmen einer Rehabilitation nach der aktuen Phase der Erkrankung kommen Methoden wie die Physiotherapie, Logopädie und neurophysiologisches Training zum Einsatz.
Die Prognose ist insgesamt günstig, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Der überwiegende Teil der Erkrankungen heilt folgenlos aus, in 10-30% der symptomatischen Fälle bleiben jedoch neurologische Defizite unterschiedlichen Ausmaßes bestehen. Dabei kann es sich um Lähmungen, Gleichgewichtsstörungen, Epilepsien, Hörstörungen sowie Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme handeln. Nach einer überstandenen Infektion besteht eine lebenslange Immunität, auch gegen die anderen Typen des FSME-Virus. 1 bis 2% der Patienten mit Meningoenzephalitis versterben.
Prophylaxe: Im Gegensatz zur Borreliose kann eine FSME durch eine aktive Impfung effektiv verhindert werden. Nicht zu vernachlässigen sind auch allgemeine vorbeugende Schutzmaßnahmen (Expositionsprophylaxe), das Tragen von langen Hosen und hohem Schuhwerk, das Meiden von Unterholz und hohem Gras sowie das Duschen und Absuchen des Körpers und der Kleider nach Besuch in Wald und Flur. Gefundene Zecken sollten sorgfältig entfernt werden, die Stelle des Stichs ist zu desinfizieren, der Zeitpunkt zu notieren.
Eine passive Impfung nach einem Zeckenbiss (postexpositionelle Immunprophylaxe) wird nicht empfohlen.
Impfung: Der FSME-Impfstoff enthält für eine aktive Immunisierung inaktivierte, nicht vermehrungsfähige FSME-Viren sowie als Hilfsmittel (Adjuvans) Aluminiumhydroxid, das die Wirksamkeit des Impfstoffs verstärkt. Der Impfstoff wird intramuskulär gespritzt. Es gibt mehrere Impfstoffhersteller, die unterschiedliche Dosierungen ihrer Produkte für Erwachsene und Kinder anbieten. Der Impfstoff gegen FSME ist sehr effektiv. Basierend auf Angaben zur Durchimpfung und zur Häufigkeit von Erkrankungen bei geimpften Personen wurde bei einer Untersuchung in Österreich die Wirksamkeit nach dreimaliger Gabe auf 96-99% geschätzt.[12] Das Erkrankungsrisiko wird von etwa 1:18.000 bei Nicht-Geimpften auf 1:840.000 reduziert. In Österreich erkrankten von 1995 bis 2004 insgesamt nur zwei Geimpfte mit eindeutigen Erkrankungszeichen.
Die Meinungen zur Verträglichkeit der Impfstoffe sind geteilt. Als Nebenwirkung treten lokale Hautreaktionen bei bis zu einem Drittel der Geimpften auf. Fieber als systemische Nebenwirkung der zugelassenen Impfstoffe ist bei Erwachsenen selten (< 1 %), kommt bei Kindern jedoch etwas häufiger (6-24%) vor, jedoch fast ausschließlich in milder Form (unter 40°C). Weitere Nebenwirkungen können Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit sowie Muskel- und Gelenkschmerzen sein (10-20% der Geimpften). Allergische Reaktionen traten hingegen nur nach 1-2 von 1.000.000 Impfungen auf.[13] Im Jahr 2001 wurde der Impfstoff TicoVac des Herstellers Baxter AG aufgrund vermehrter Fieberanstiege und Fieberkrämpfe bei Kindern vom Markt genommen.
Durchführung
Für einen langjährigen Schutz ist eine Grundimmunisierung notwendig, die aus drei Impfungen besteht. Dabei wird die erste Impfung nach etwa drei Monaten und einem Jahr wiederholt.
Eine Auffrischungsimpfung wird nach drei bis fünf Jahren empfohlen. Verschiedene neuere Publikationen zeigten jedoch anhand der Untersuchung von Antikörper-Titern, dass eine Auffrischimpfung wahrscheinlich erst nach längerer Zeit notwendig wäre.[14][15]
Bei kurzfristigem Bedarf können die Impfungen in einem Schnellschema verabreicht werden, je nach Hersteller in zwei oder drei Dosen innerhalb von drei Wochen. Für einen langfristigen Schutz ist dann eine einmalige Wiederholungsimpfung nach einem Jahr notwendig.
Impfempfehlungen
Nach den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)[16] am Robert Koch-Institut besteht eine Indikation zur aktiven Impfung für alle Personen, die sich in FSME-Risikogebieten aufhalten und durch Beruf (Forst- und Waldarbeiter, Landwirte u.a.) oder Freizeitaktivitäten (Urlauber, Jogger) Zecken ausgesetzt sind. Als Risikogebiete gelten dabei die FSME-Endemiegebiete, in denen bei Zeckenexposition ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko durch periodische Erkrankungsfälle oder eine infizierte Zeckenpopulation belegt ist. Dabei soll die Saisonalität von FSME (April bis November) beachtet werden. Für Kinder gelten dieselben Indikationen, bei Kindern unter drei Jahren sollte aufgrund der milde verlaufenden Krankheit in diesem Alter die Impfung in Beratung mit dem Kinderarzt sehr zurückhaltend erfolgen.
Die Eidgenössische Kommission für Impffragen der Schweiz empfiehlt Impfungen für alle Personen in Endemiegebieten, allerdings erst ab einem Alter von sechs Jahren.[13]
Gegenanzeigen zur Impfung stellen allgemeine Impfhindernisse wie fieberhafte Erkrankungen, chronische Erkrankungen, Allergien gegen Impfbestandteile sowie bevorstehende große körperliche Anstrengungen dar. Während einer Schwangerschaft ist eine sorgfältige Abwägung der Risiken und Vorteile vorzunehmen. Erfahrungen zur Impfung von schwangeren Frauen liegen nicht vor.
Impfstoffherstellung
Die Herstellung des FSME-Impfstoffes erfolgt auf sogenannten CEC (chick embryo cells)-Zellen. Dabei handelt es sich um eine primäre Zellinie, die von embryonierten Hühnereiern ausgehend hergestellt wird. Hierzu werden die 10-12 Tage alten Eier geöffnet, der Embryo entnommen, zerkleinert und einer Trypsin-Behandlung unterworfen. In kleinen Fermentoren werden die CEC-Zellen mit dem FSME-Virus inokuliert. Nach Vermehrung des Virus sterben die CEC-Zellen ab, der Überstand wird geerntet, es erfolgt eine Inaktivierung des Virus mit Formaldehyd. Anschließend wird eine Antigen-Reinigung mittels einer Fällungsstufe, Ultrafiltration und einem kontinuierlichen Saccharose-Gradienten durchgeführt.
Gesetze: In Deutschland sind nach § 6 des IfSG der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an FSME mit Namen meldepflichtig.
Literatur und Weblinks:
- Reinhard Kaiser: Frühsommer-Meningoenzephalitis. Prognose für Kinder und Jugendliche günstiger als für Erwachsene. Deutsches Ärzteblatt 101(33), S. A2260-A2264 (2004), ISSN 0012-1207
- Peter Kimmig, Dieter Hassler, Rüdiger Braun: Zecken, Trias, 2001. ISBN 3431040187
- Patrick Oschmann, Peter Kraiczy: Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis, UNI-MED, Bremen, 1998. ISBN 3895994081
- RKI - FSME
- Risikogebiete: Deutschland -
Österreich - Schweiz - Europaweit
Dengue-Virus
| Dengue-Virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
Das Dengue-Fieber (engl. dengue hemorrhagic fever (DHF)) ist eine Arbovirose (von arthropod born viruses: von Arthropoden übertragene Viren), die von vier verschiedenen Serotypen des Dengue-Virus verursacht wird. Die Symptome sind oft unspezifisch oder einer schweren Grippe ähnlich, können aber auch innere Blutungen umfassen. Deshalb zählt man das Dengue-Fieber zu den hämorrhagischen Fiebern. Das Dengue-Fieber ist auch als Sieben-Tage-Fieber, Pokalfieber oder Knochenbrecherfieber bekannt.
Der Name Dengue leitet sich aus dem spanischen Wort dengue ab, das man mit Ziererei oder Mätzchen übersetzen kann. Diese Bezeichnung deutet auf eine schmerzbedingte, auffällig eigenartige Veränderung der Körperhaltung und Verhaltensweise bei erkrankten Personen hin, die eventuell auch nach Abklingen der Erkrankung fortbesteht.
Erreger: Das Dengue-Virus gehört zur Gattung der Flaviviren aus der Familie der Flaviviridae. Es handelt sich dabei um ein behülltes Einzel(+)-Strang-RNA-Virus. Es lassen sich vier unterschiedliche DEN-Serotypen (DEN-1 bis DEN-4) unterscheiden, die entweder in abgegrenzten oder überlappenden Endemiezonen vorkommen.
Das Genom des Virus kodiert nur 10 Proteine. 3 Strukturproteine und 7 Proteine, die für die Wirtsvermehrung zuständig sind. Eines der Strukturproteine, das sog. envelope- bzw. Hüllprotein ist in 180facher Ausfertigung in die Lipidmembran des Virus eingelagert. Nach Aufnahme in die Wirtszelle gelangen die Virionen in die Lysosomen. Dort ändern die Hüllproteine unter dem Einfluss des niedrigen pHs ihre Konformation und sorgen nun für die Fusion der Virushüllmembran mit der lysosomalen Membran. Dadurch entgehen die Virionen dem lysosomalen Abbau und setzen gleichzeitig ihre RNA frei. Die Nicht-Strukturproteine sorgen danach für die Vermehrung (RNA-Polymerase, Helikase) und Modifikation (Methylierung) der RNA, sowie das Zuschneiden des am Ribosom gebildeten Polypeptids (Protease) in die einzelnen Virusproteine.
Epidemiologie: Als Reservoirwirte dienen dem Virus sowohl der Mensch wie auch Affen.
Die Krankheit stammt ursprünglich aus Afrika, ist vor etwa 600 Jahren nach Asien eingeschleppt und mittlerweile auch in Amerika dokumentiert worden. Seit etwa 200 Jahren beobachtet man in vielen tropischen Gebieten weltweit ein epidemisches Auftreten des Dengue-Fiebers.
Der internationale Handel - wie beispielsweise Containerschiffe mit Obstimporten aus Afrika - ermöglichte es infizierten Larven, weitere Infektionsgebiete zu eröffnen, in denen sie normalerweise nicht vorkommen. Auch in den Tropen infizierte Reisende können die Erkrankung in normalerweise sichere Gebiete einschleppen. Aufgrund der globalen Erwärmung breitet sich das Dengue-Fieber nunmehr auch in den gemäßigten Breiten aus.
 |
Hauptverbreitungsgebiet sind heute Lateinamerika, Zentralafrika, Indien, Südostasien, Teile des Pazifik (u.a. Neukaledonien) und der Süden der USA. Auch nach Europa wird das Fieber regelmäßig eingeschleppt, mit jährlich etwa 2.000 eingeschleppten Fällen gehört Dengue zu den häufigsten viralen Infektionen bei deutschen Urlaubern.
Häufigkeit: 2,5 Milliarden Menschen leben in Endemiegebieten. Jährlich werden einige 10 bis 100 Millionen Menschen von dieser Erkrankung befallen, etwa 95% der Infizierten sind Kinder. 1999 war das Dengue-Fieber die am häufigsten durch Mücken übertragene Viruskrankheit. Etwa 2 bis 5% der Erkrankten versterben an diesem Fieber, insbesondere Kinder und Jugendliche. Bei Kindern bis zu einem Jahr liegt die Todesrate bei etwa 30%.
Übertragung: Die Viren werden ausschließlich durch den Stich von Mücken der Art Aedes aegypti oder Aedes Albopticus - auch Tigermücken genannt - als deren biologische Vektoren übertragen. Heute ist das Dengue-Fieber auch eine Krankheit der Großstädte, sowie der Slums (Favelas) in Brasilien, wo sich die Aedes-Mücken im stehenden Wasser vermehren, z.B. in den bei mangelnder Kanalisation vorhandenen Grabensystemen, sowie unverschlossene Wasserbehältern (Brunnen, Zisternen, Kloaken). Aber auch Behälter oder Abfall, in denen sich Regenwasser sammelt (Eimer, Dosen, Autoreifen, Plastikfolien) reichen für die schnell wachsende Larve der Aedes-Mücke aus.
Bekämpfung: Versuche im Zeitraum von 1950 bis 1960 die Krankheit durch das Bekämpfen von Mücken mit Insektiziden oder durch das Trockenlegen von Sumpfgebieten einzuschränken, waren damals zumindest vorübergehend erfolgreich. Heutzutage werden diese groß angelegten Bekämpfungsmaßnahmen aufgrund der damit verbundenen negativen Folgen für die Umwelt - Insektizidbelastung und Aussterben anderer Insektenarten - jedoch abgelehnt. Angesichts der schnell einsetzenden Resistenzbildung der Mücken gegen die eingesetzten Insektizide (z.B. DDT) waren sie aber auch langfristig nicht erfolgreich. Außerdem wurden bei der Anwendung des ehemals neu entwickelten Mittels "Abate" die bei der Anwendung empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen derart vernachlässigt, dass zum Teil schwere gesundheitliche Schäden bei den Anwendern die Folge waren.
Seit einiger Zeit wird nur ein die Larve angreifendes Insektizid eingesetzt, welches als ein sog. "ökologisch korrektes" Larvizid aus dem Bakterium Bacterium isrealensis gewonnen wird. Dieser Wirkstoff gilt als umweltverträglich, doch ist seine Wirksamkeit noch nicht eindeutig nachgewiesen. Weitere einfache und wirksame Maßnahmen sind die Gaben von Chlor oder Sand in selbst allerkleinste Pfützen wie bspw. auch in die Untersetzer von Topfpflanzen.
Diagnose: Die klinische Diagnosestellung ist wegen der Vielzahl der möglichen Erreger für Infektionskrankheiten schwierig. Antikörper sind erst nach dem vierten Krankheitstag nachweisbar. Ein direkter Nachweis für das Dengue-Virus mit der Reverse-Transkriptase-Polymerasekettenreaktion (RT-PCR) zwischen dem vierten und siebten Krankheitstag sichert die Diagnose.
Krankheitsverlauf: In ca. 90% der Erkrankungen wird ein stummer (oligosymptomatischer) Verlauf beobachtet. Bei den restlichen 10% der Fälle beginnt die Krankheit nach einer Inkubationszeit von etwa zwei bis zehn Tagen mit einem Verlauf über drei Stadien:
- Plötzlich einsetzender Krankheitsbeginn mit Fieber bis 41° C, Schüttelfrost, Erschöpfungszuständen, Kopf-, Glieder-, Gelenk– und Muskelschmerzen ("breakbone fever"), auffälliger Bradykardie und metallisch bitterem Mundgeschmack. Gelegentlich tritt auch Hautausschlag, Übelkeit und Erbrechen auf.
- Nach dem Fieberabfall und einer weiteren Zeitspanne von vier bis fünf Tagen kommt es zu einem erneuten Fieberschub. Danach entwickelt sich ein masernähnliches Exanthem mit Lymphknotenschwellungen.
- Nach weiteren fünf bis sechs Tagen beginnt die Erholungsphase, die sich über mehrere Wochen hinziehen kann.
Als Dengue-Trias bezeichnet man Fieber, Exanthem und Kopf-, Glieder-, Gelenk- oder Muskelschmerzen.
Hämorrhagisches Denguefieber (DHF): Das hämorrhagische Denguefieber ist ein akutes Schocksyndrom mit Hämorrhagien nach einer erneuten Infektion durch einen anderen Serotypen des Dengue-Virus.
Ausschließlich bei Menschen mit bereits existierenden Antikörpern gegen einen anderen Serotyp des Dengue-Virus kann es zu einer immunologischen Überreaktion kommen, in deren Verlauf die Blutgefäße durchlässig werden. Die Antikörper können durch eine vorangegangene Erkrankung erworben oder von Müttern auf ihre Kinder übertragen werden. Dies erklärt, warum vor allem Kinder von dieser Variante des Dengue-Fiebers betroffen sind.
Die hämorrhagische Form beginnt wie das normale Dengue-Fieber, verschlechtert sich aber nach zwei bis fünf Tagen dramatisch. Es kommt zu (inneren) Blutungen, Hepatomegalie und hämorragisch-distributivem Schock.
Der Krankheitsverlauf ist abhängig vom Schweregrad, dem Therapiebeginn sowie den medizinischen Möglichkeiten einer angemessenen (adäquaten) Schockbehandlung. In ärmeren Regionen beträgt die Letalität 10-30%.
Therapie: Zur Zeit gibt es keine kausale Therapie. Symptomatisch stehen Schockprophylaxe und Analgetika (kein ASS) im Vordergrund.
Immunisationsschutz: Die Infektion mit einer von den vier Arten des Krankheitserregers bietet nur einen Immunisationsschutz gegen den selben Serotyp, so dass eine Person bis zu vier mal am Dengue-Fieber erkranken kann. Auffällig ist, dass nach einer überstandenen Infektion eines Serotyps die Krankheitsfolgen bei einer späteren Infektion mit einem anderen Serotyp durch eine überschießende Immunreaktion oft wesentlich heftiger ausfallen als bei der Erstinfektion. Ein bislang nicht vorhandener Impfschutz wäre deshalb nur dann sinnvoll, wenn er zugleich gegen alle vier bisher bekannten Serotypen schützen könnte.
Prophylaxe: Der beste Schutz ist die Vermeidung von Stichen durch Schutzkleidung, Sprays und Moskitonetze. Dabei ist zu beachten, daß die Mücken tagaktiv sind.
Gegenwärtig gibt es keine Impfung gegen das Dengue-Fieber. Allerdings wird in Thailand an einem tetravalenten Lebendimpfstoff gearbeitet. Die ersten Ergebnisse erscheinen vielversprechend. Man hofft, zwischen 2005 und 2010 durch Massenimpfungen die epidemischen Ausmaße des Dengue-Fiebers einzudämmen. Bis dahin ist ein Schutz gegen das Dengue-Fieber nur durch einen generellen Schutz vor Mücken möglich. Dabei ist neben der Vernichtung der Mücken oder ihrer Brutstätten auch die Nutzung (insektizidgetränkter) Moskitonetze eine sinnvolle Maßnahme.
Ein weiteres bedeutendes Forschungszentrum auch für diese Erkrankung ist das Novartis Institute for Tropical Deseases (NITD) in Singapur. Nach Aussagen Ihres Leiters Prof. Paul Herrling stehen die Forschungen dort in Bezug auf einen medikamentösen Wirkstoff zur erfolgreichen Behandlung des Dengue-Fieber noch am Anfang.
Gesetze: In Deutschland sind nach § 6 des IfSG der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an einem virusbedingtem hämorrhagischen Fieber mit Namen meldepflichtig.
Literatur und Weblinks:
- RKI - Dengue-Fieber
- U. Kuhnle, W. Krahl: Dengue-Fieber und Hämorrhagisches Dengue-Fieber. Die tödliche Pandemie des 20. Jahrhunderts. Monatsberichte Kinderheilkunde 147(1), S. 48 – 50 (1999), ISSN 0026-9298
- Anonymus: Dengue-Fieber. Die unbekannte Pandemie. Pharmazeutische Zeitung 147(7), S. 52 – 55 (2002), ISSN 0031-7136
- Anonymus: Dengue-Fieber rund um die Welt verbreitet. Pharmazeutische Zeitung 149(14), S. 50 – 53 (2003), ISSN 0031-7136
Japan-B-Enzephalitis-Virus
| Japan-B-Enzephalitis-Virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
Die Japanische Enzephalitis wird durch das Japan B-Enzephalitis-Virus ausgelöst, ein Arbovirus, das wie der Erreger des Gelbfiebers zu den Flaviviridae gehört. Es existieren mehrere Subtypen des Virus, bisher konnten die Varianten Nakayama und JaGar-01 identifiziert werden.
Die Japanische Enzephalitis kommt vor allem in Ost- und Südostasien vor. In Südostasien gibt es regelmäßig zur Monsunzeit Epidemien, die in den Ländern, die noch kein effektives Impfprogramm implementiert haben, Hunderte bis Tausende von Opfern fordern.
Übertragungswege: Die Japanische Enzcephalitis ist eine Zoonose. Das Erregerreservoir bilden vor allem wildlebende Vögel (unter anderem Reiher), aber auch Reptilien und Fledermäuse. Zwischenwirte für die Infektion des Menschen sind häufig Haustiere (Schweine, Pferde). Als Vektoren dienen Mücken der Gattungen Culex und Aedes, die die Erreger über Stiche weitergeben. Zu den wichtigsten Überträgern zählen Culex tritaeniorhynchus, C. fuscocephala und C. annulus.
Infektionsrisiko: Das Infektionsrisiko für Touristen ist vergleichsweise gering. Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht in den Endemiegebieten vor allem auf dem Land, vorzugsweise am Ende der Regenzeit. Nur ein Teil der Mücken sind Virusträger. Die Durchseuchungsrate ist regional unterschiedlich und wird bei den übertragungsfähigen Gattungen mit 1:100 bis 1:300 angeben. Das Risiko steigt damit proportional zur Zahl der Stiche.

Epidemiologie: Die Japanische Enzephalitis ist in Asien weit verbreitet. In Japan selbst tauchen - bedingt durch die systematische Durchimpfung von Haustieren - nur noch wenige Fälle auf. Hauptsächlich betroffen sind China, Indien, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, die Philippinen und das nördliche Thailand. Jährlich werden weltweit 35.000 bis 50.000 Fälle mit mehr als 10.000 Toten registriert, wobei die tatsächliche Anzahl der Erkrankungen deutlich höher liegen dürfte.
Symptomatik: In den meisten Fällen verläuft die Infektion mild oder asymptomatisch. Bei schwererem Verlauf stellt sich nach einer Inkubationszeit von 5-15 Tagen ein Grippe-ähnliches Krankheitsbild mit Fieber, Schüttelfrost, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen ein.
Befällt das Virus das Zentralnervensystem (ZNS), entwickelt sich eine Enzephalitis mit Bewusstseinstrübung, Krampfanfällen, Reflexstörungen, Paresen und Meningitiszeichen, die in ca. 30% der Fälle tödlich enden kann. Bei einem weiteren Drittel blieben dauerhafte neurologische Defizite zurück.
Impfung: Es gibt verschiedene ausländische Impfstoffe wie von Biken, Denka Seiken. In Deutschland wird derzeit überwiegend ein Impfstoff verwendet, der in Japan hergestellt wird. Alle folgenden Angaben beziehen sich auf diesen Impfstoff. Er enthält im Wesentlichen abgetötete Japanische-Enzephalitis-Viren, das aus Mäusehirnen gewonnen und gereinigt wurde. Seine Wirksamkeit wird mit 91% angegeben. Er wird unter die Haut gespritzt und sollte bei Kindern nach Möglichkeit erst ab einem Alter von einem Jahr eingesetzt werden.
Für eine vollständige Grundimmunisierung werden drei Injektionen jeweils an den Tagen 0, 7 und 30 verabreicht. Kinder zwischen einem und drei Jahren erhalten jeweils nur die halbe Dosis. Bei Zeitnot kann auch an den Tagen 0, 7 und 14 geimpft werden. In Ausnahmefällen reichen zwei Impfdosen. Der Schutz wirkt frühestens zwei bis drei Wochen nach der zweiten Impfung. Die letzte Dosis sollte spätestens zehn Tage vor Abreise verabreicht werden. Der Schutz hält zwischen einem und vier Jahren an. Nach zwei Jahren kann eine Auffrischimpfung erwogen werden.
Die Japanische-Enzephalitis-Schutzimpfung kann gleichzeitig mit anderen Impfungen vorgenommen werden. Aus Vorsichtsgründen sollten jedoch sieben Tage vor einer Impfung gegen Japanische Enzephalitis andere Impfungen vermieden werden.
Hinweis: In Deutschland nicht zugelassene Impfstoffe können über internationale Apotheken bestellt werden. Im Falle impfstoffbedingter Gesundheitsstörungen hat der Geimpfte aber hier keinen gesetzlichen Entschädigungsanspruch. Bei schuldhafter Verletzung der ärztlichen Sorgfaltspflicht besteht jedoch weiterhin ein Haftungsanspruch gegen den Arzt.
Verhalten nach der Impfung
Bis zu 17 Tage nach einer Impfung kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Bereits bei ersten Anzeichen ist sofort ein Arzt aufzusuchen. Daher sollten sich geimpfte Personen zumindest in den ersten zehn Tagen nach einer Injektion in Gebieten aufhalten, wo medizinische Hilfe schnell erreichbar ist. Fernreisen sind zu vermeiden. In den ersten 48 Stunden nach einer Impfung ist zudem von übermäßigem Alkoholkonsum abzuraten.
Wer soll geimpft werden?
Die WHO empfiehlt die Impfung nur Asien-Reisenden, die sich einen Monat oder länger während mückenreichen Jahreszeiten in Gebieten aufhalten, wo die Japanische Enzephalitis gehäuft auftritt. Diese sind China, Indien, Japan, Kambodscha, Korea, Laos, Myanmar, Nepal, Teile Ozeaniens, auf den Philippinen, Sri Lanka, Thailand und Vietnam.
Wer soll nicht geimpft werden?
Wer an einer akuten, behandlungsbedürftigen Krankheit mit Fieber leidet, soll nicht geimpft werden. Nicht geimpft werden dürfen außerdem Personen mit bekannter oder vermuteter schwerer Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Impfstoffs etwa der Allergie gegen Nagetier-Protein oder Protein aus Nervenzellen sowie Personen, bei denen nach einer früheren Impfung gegen Japanische Enzephalitis eine allergische Erscheinung, hohes Fieber oder eine andere unerwünschte Reaktion aufgetreten ist. Hierzu gehören ein stark juckender Ausschlag am gesamten Körper, ein stark geschwollenes Gesicht oder Schwellungen und Wassereinlagerungen auch an Armen, Beinen oder Hals.
Bei folgenden Personen müssen Nutzen und Risiken der Schutzimpfung gegen Japanische Enzephalitis sorgfältig abgewogen werden: Schwangere und stillende Frauen, Kinder im ersten Lebensjahr, Personen, die schon einmal an Urtikaria (?) litten.
In diesen Fragen berät Sie der Impfarzt, wie Sie sich am besten gegen eine Infektion mit Japanischer Enzephalitis schützen können.
Diagnostik: Bei entsprechender Exposition kann die Verdachtsdiagnose aus dem klinischen Bild gestellt werden. Die weiterführende Diagnostik umfasst: Blutbild (Leukozytose), CT oder MRI, Liquoruntersuchung (lymphozytäre Pleozytose bei normalem Glucosespiegel), serologischer Antikörpernachweis (ELISA, IF, HHT, KBR), ggf. Virusnachweis aus Liquor mittels PCR.
Differentialdiagosen: Zerebrale Malaria, Bakterielle Meningitis, Reye-Syndrom
Vorbeugung: Basismaßnahme ist die Vermeidung von Stichen. Touristen sollten sich mit Repellents, Insektennetzen und langärmeliger Kleidung schützen. Bei längerem Aufenthalt in Endemiegebieten empfiehlt sich eine Schutzimpfung gegen JE, die nach dreimaliger s.c.-Injektion (0, 7, 14-28 Tage) einen sehr guten Schutz bietet. Bei einem längeren Aufenthalt in Endemiegebieten sollte die Impfung alle 2 Jahre aufgefrischt werden. Der Totimpfstoff kann in Deutschland über internationale Apotheken bezogen werden, er ist in Deutschland nicht offiziell zugelassen.
Therapie: Da zur Zeit (2004) keine wirksamen Virustatika gegen JE verfügbar sind, ist die Therapie rein symptomatisch. Sie umfasst u.a. die Kontrolle des Flüssigkeitshaushalts, die Verhinderung von Sekundärinfektionen und gegebenenfalls eine Beatmung.
Literatur und Weblinks:
St.-Louis-Enzephalitis-Virus
| St.-Louis-Enzephalitis-Virus | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||||
Die St. Louis-Enzephalitis ist eine der häufigsten durch Arboviren ausgelöste Erkrankung Nordamerikas und auch von reisemedizinischer Bedeutung.
Erreger: Die St. Louis-Enzephalitis wird durch das gleichnamige Virus ausgelöst. Es gehört zu den Flaviviren (Einzel(+)-Strang-RNA-Viren, Togaviridae).
Übertragung: Das Virus wird durch nachtaktive Stechmücken übertragen (Culex nigripalpus, Culex pipiens pipiens und Culex tarsalis). Während einer Blutmahlzeit an einem infizierten Tier nehmen die Stechmücken das Virus auf und können es zu einem späteren Zeitpunkt durch erneuten Stich auf Menschen oder andere Tiere übertragen. Reservoir sind Vögel und Fledermäuse. Der Mensch ist nur Zufallswirt, eine Übertragung von Mensch zu Mensch findet nicht statt.
Vorkommen: Endemiegebiete in den USA sind das Ohio-Mississippi-Becken, Texas, Florida, Colorado sowie Kalifornien, außerdem Jamaika. Das Virus ist auch in Kanada, in Mittel- und Südamerika endemisch, hat aber dort wohl keine Epidemien ausgelöst. Die Übertragung erfolgt, dem Lebenszyklus der Stechmücken entsprechend, am häufigsten zwischen Juli und Oktober.
Klinik: Die Erkrankung verläuft in den meisten Fällen inapparent und ohne Folgen Bei 1-5% der Infizierten kommt es jedoch nach einer Inkubationszeit von wenigen Tagen zu plötzlich einsetzendem hohem Fieber, begleitet von Kopf- und Gliederschmerzen, Lichtscheu und Schwindel. Insbesondere bei älteren Menschen können im Anschluss neurologische Symptome auftreten: Meningitis oder Enzephalitis. Die Rekonvaleszenz kann Wochen und Monate dauern, möglich sind auch bleibende neurologische Ausfälle, z.B. Gang- und Sprachstörungen. Die Letalität kann bis zu 20% betragen.
Therapie: Eine spezifische Therapie oder eine Impfung gibt es nicht. Für Reisende in Endemiegebiete empfiehlt sich daher als Vorbeugung ein Schutz vor Mückenstichen: Repellentien, Moskitonetze, helle, lange Kleidung, Vermeidung von Außenaufenthalten während und nach der Dämmerung.
West-Nil-Virus
Das West-Nil-Virus ist ein seit 1937 bekanntes, behülltes Einzel(+)-Strang-RNA-Virus der Flaviviridae-Familie, das sowohl in tropischen als auch in gemäßigten Gebieten vorkommt. Das Virus infiziert hauptsächlich Vögel, kann aber auch auf Menschen, Pferde und andere Säugetiere übergreifen.
Übertragung: Das Virus wird durch Stechmücken übertragen, in Nordamerika z.B. die gemeine kleine Hausmücke (Culex pipiens) und ein Vogel und Menschen mögender Hybrid aus Culex Pipiens und Culex molestus. In den Epidemien von 2003 und 2004 sind insbesondere auch die Arten Culex tarsalis und Culex quinquefasciatus als häufige Vektoren der Krankheit identifiziert worden. Da in Europa fast ausschließlich die sich nur von Menschen ernährende Art Culex molestus vorkommt, findet das Virus hier keine Verbreitung, da es von dieser Mückenart nicht von Vögeln auf Menschen übertragen wird.
| West-Nil-Virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
In einer im Januar 2006 im Magazin Journal of Experimental Medicine veröffentlichten Studie wird die Vermutung aufgestellt, dass die Anfälligkeit für das West-Nil-Virus durch eine Mutation des Gens CCR5 (genannt CCR5Δ32) massiv begünstigt wird. Diese Löschung von 32 Basenpaaren bewirkt auch eine beschränkte Resistenz gegen das an gewöhnliche CCR5-Rezeptoren andockende HIV. Die Mutation stellt daher seit Entdeckung 1996 die Grundlage für die Entwicklung neuer CCR5-Inhibitoren im Kampf gegen AIDS dar. Bisher waren keine negativen Auswirkungen bekannt. Es ist noch nicht geklärt, ob CCR5Δ32 neben der Anfälligkeit auch die Schwere des Krankheitsverlaufes nach Infektion mit dem West-Nil-Virus beeinflusst.
Symptome: Beim Menschen ergeben sich in 80% der Fälle keine Symptome durch die Infektion. In anderen Fällen ergeben sich Grippe-ähnliche Symptome, bekannt als West-Nil-Fieber. Das Virus ist in der Lage die Blut-Hirn-Schranke zu passieren und kann dadurch eine lebensbedrohliche Enzephalitis oder Meningitis auslösen (0,7% der Fälle). Personen über 50 Jahre haben ein erhöhtes Risiko, eine schwere Form der Krankheit zu entwickeln. Die Symptome entwickeln sich nach 3 bis 14 Tagen, eine wirksame Behandlung ist nicht bekannt.
Therapie: Aktuell sind Forscher der Washington University School of Medicine in St. Louis, USA, dabei, einen bei Mäusen entdeckten, gegen das Virus wirksamen Antikörper (E16) für die Anwendung beim Menschen weiterzuentwickeln.
Geschichte: Einer These folgend soll schon Alexander der Große vom West-Nil-Virus dahingerafft worden sein, da Plutarch berichtete, dass vor Alexanders Ableben Raben tot vom Himmel fielen.
Das West-Nil-Virus wurde zum ersten Mal 1937 im West-Nil-District von Uganda bei einer erkrankten älteren Frau isoliert und bekam daher diesen Namen. 1957 trat es in Israel auf und wurde weiterhin ab 1960 in Frankreich und Ägypten bei Pferden festgestellt. In den letzten Jahren sind epidemische Häufungen der vom West-Nil-Virus ausgelösten Enzephalitis in Algerien (1994), Rumänien (1996/97), der Tschechischen Republik (1997), der Demokratischen Republik Kongo (1998), Russland und Nordamerika (1999) und Israel (2000) dokumentiert worden.
Mit dem ersten Auftreten des West-Nil-Virus in Nordamerika 1999 rückte die Thematik in das mediale Rampenlicht. In den USA begann der Virusausbruch im Gebiet von New York City. Es gibt eindeutige Hinweise dafür, dass das Virus von einer infizierten Mücke aus einem israelischen Flugzeug der Linie Tel Aviv - New York eingeschleppt wurde. Die ersten Anzeichen waren Vögel, die tot von den Bäumen des Central Parks fielen. Bald darauf wurden ältere Menschen in der Gegend infiziert und erkrankten. Eine Ärztin aus der New Yorker Bronx mit Tropenerfahrung glaubte das West-Nil-Fieber zu erkennen und verständigte forschende Militärärzte, die den Verdacht bestätigen konnten. Es breitete sich seitdem auf dem ganzen nordamerikanischen Kontinent aus. Als Gegenmaßnahmen wurde und wird versucht, den Überträger des Virus, die Moskitos, mit Pestiziden zu bekämpfen. Auch die Anwendung von Insektiziden im Fracht- und Personenbereich von Interkontinentalflugzeugen vor der jeweiligen Landung wurde weltweit erheblich verstärkt.
Statistik: In den USA sind von 1999 bis 2001 149 Infektionen mit 18 Todesfällen dokumentiert. Im Jahr 2002 stieg diese Zahl auf 4156 Infektionen und 284 Tote; 2003 9.858 Infektionen und 262 Todesfälle.
Literatur und Weblinks:
- I. Stock: Das West-Nil-Virus. Chemotherapie Journal 13(4), S. 166 - 173 (2004), ISSN 0940-6735
- Helge Kampen: Vektor-übertragene Infektionskrankheiten auf dem Vormarsch? Wie Umweltveränderungen Krankheitsüberträgern und -erregern den Weg bereiten. Naturwissenschaftliche Rundschau 58(4), S. 181 - 189 (2005), ISSN 0028-1050
- Hermann Feldmeier: Bedrohung West-Nil-Virus. Naturwissenschaftliche Rundschau 58(6), S. 335 - 337 (2005), ISSN 0028-1050
- RKI - West-Nil-Fieber
- Van Epps HL. “CCR5 thwarts West Nile virus”. JEM, 203(1):4-4,. DOI:10.1084/jem2031iti6.
- CDC - Edward BH et al: Epidemiology and Transmission Dynamics of West Nile Virus Disease
Gelbfieber-Virus
| Gelbfieber-Virus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||
Das Gelbfieber-Virus ist ein 40–50 nm großes, behülltes RNA–Virus aus der Gruppe der Flaviviren und der Erreger des Gelbfiebers, auch Schwarzes Erbrechen genannt, das in tropischen und subtropischen Gebieten in Südamerika und Afrika, aber nicht in Asien vorkommt. Da das Virus auch Affen befällt, von denen es wieder durch Vektoren auf den Menschen übertragen werden kann, ist es nur sehr schwer auszurotten.
Übertragung: Das Gelbfieber-Virus wird durch den Stich der Gelbfiebermücke (Aedes aegypti oder Haemagogus) übertragen. Aedes sticht Tag und Nacht und kommt zum Brüten mit kleinsten Wassermengen aus.
Häufigkeit: Die offiziellen Zahlen belaufen sich auf ca. 200.000 Erkrankungen und ca. 30.000 Todesfälle pro Jahr weltweit (90% in Afrika).
Symptome und Krankheitsverlauf: Die Infektion äußert sich zunächst in einer fieberhaften Erkrankung mit Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost und Übelkeit, die dann vollständig ausheilen kann. In etwa 10% der Fälle folgt anschließend eine zweite ikterische Krankheitsphase mit Leberschädigung, die mit einer Letalität von ca. 50% behaftet ist.
Die Erkrankung hinterlässt, wenn überlebt, eine lebenslange Immunität.
Prophylaxe: Bei Reisen in betroffene Gebiete wird dringend eine Impfung empfohlen. Der Impfschutz setzt nach 10 Tagen ein und hält mindestens 10 Jahre an (man schätzt 30–40 Jahre). Der Lebendimpfstoff (Deutschland: Stamm D-17 nach Theiler) muss nur einmal injiziert werden (0,5ml s.c. oder i.m.) und führt recht häufig zu grippeähnlichen Symptomen in den Tagen danach, weswegen man nach der Impfung auf Alkohol und übermäßige körperliche Anstrengung verzichten sollte.
Nach einer Impfung wird das Virus nicht ausgeschieden oder an die Umgebung weitergegeben. In den vergangenen Jahren wurden aus den USA, Brasilien und Australien über wenige Fälle schwerer Krankheitsbilder, auch mit Todesfolge, bei einer solchen Immunisierung berichtet. Dabei scheint es sich überwiegend um Personen mit bestimmten Immundefekten gehandelt zu haben. Bezogen auf etwa 500 Mio. Geimpfter ist dieses Risiko im Vgl. zum Infektionsrisiko gering.
Der Impfstoff ist laut Hersteller nicht für Säuglinge unter 6 Monaten, laut WHO nicht unter 9 Monaten geeignet. Außerdem darf er wie andere Ganzkeimimpfstoffe auch nicht an Allergiker gegen Hühnereiweiß verimpft werden (Gelbfieber-Impfstoff ist die Vakzine mit dem höchsten Gehalt an Hühnereiweiß). Andere Kontraindikationen sind Schwangerschaft oder eine akute Erkrankung sowie verschiedene Formen von Immundefekten. Zu vorheriger Gabe von Immunglobulinen (passive Impfung) muss bei Impfungen allgemein ein Abstand von mindestens 3 Monaten eingehalten werden. Andere Lebendimpfstoffe (Mumps, Masern, Röteln) sollten entweder gleichzeitig oder im Abstand von 4 Wochen verabreicht werden. Zwei Wochen nach der Impfung sollte man kein Blut spenden, um das Impfvirus nicht an den Transfusionsempfänger weiterzugeben.

Impfpflicht: Einige Länder Asiens sind von Gelbfieber bedroht (Vorkommen von Überträgermücke und infizierbaren Affen), ohne dass die Krankheit dort bislang vorkommt. Um eine Einschleppung zu verhindern, verlangen diese Länder von allen ausländischen Besuchern eine vorherige Impfung. Sie muss durch eine Impfbescheinigung nachgewiesen werden.[17].
Geschichte: Der kubanische Arzt und Wissenschaftler Charles Finlay entdeckte 1881 den Moskito als Überträger des Gelbfiebers.
Die berühmteste historische Episode im Zusammenhang mit Gelbfieber ist der Bau des Panamakanals. Der Bau wurde unter Führung des französischen Ingenieurs Ferdinand de Lesseps, der schon den Sueskanal erfolgreich gebaut hatte, zunächst abgebrochen und dann von amerikanischer Seite fortgesetzt. Dabei kamen besonders Arbeiter aus Afrika zum Einsatz, weil man annahm, diese hätten bereits eine Immunität. Man schätzt, dass etwa auf jeden Meter Panamakanal ein toter Arbeiter kommt. Gelbfieber ist ursprünglich nur in Südamerika endemisch und breitete sich erst dann auch über Afrika aus. Man weiß nicht, warum Gelbfieber bis heute in Asien nicht vorkommt.
Der Gelbfieberimpfstoff wurde um 1937 von dem in Südafrika lebenden Mikrobiologen Dr. Max Theiler (1899-1972) am Rockefeller-Institut in Versuchen mit Affen und Mäusen entwickelt. Für diese Leistung erhielt er 1951 den Nobelpreis für Medizin.
Literatur und Weblinks:
Quellen
- ↑ RKI, Epidemiologisches Bulletin 13/2006
- ↑ RKI, Epidemiologisches Bulletin 46/2005
- ↑ Heinz, F. X. (1999): Tick-borne encephalitis virus: advances in molecular biology and vaccination strategy in the next century. Zentralbl. Bakteriol. 289, 506-510.
- ↑ Dumpis U, Crook D, Oksi J.: Tick-borne encephalitis (review). Clin Inf Dis 1999; 28: 882–90 PMID 10825054
- ↑ 5,0 5,1 http://www.rki.de/cln_006/nn_225576/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber__Mbl__FSME.html
- ↑ http://www.zecken.at/Zecken.aspx?target=49687#show_49687 www.zecken.at
- ↑ http://www.apotheker.or.at/.../FSME_%202005_Bilanz_Heinz.PDF
- ↑ http://www.rki.de/cln_006/nn_225576/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2006/17__06.html
- ↑ http://www.apotheker.or.at/.../FSME_Bundesland2005.jpg
- ↑ 10,0 10,1 Zur FSME in Europa. Epidemiologisches Bulletin 16 / 2005 des RKI
- ↑ Gleixner, Müller, Wirth: Neurologie und Psychiatrie. 4. Aufl. 2004/5, S. 116. ISBN 3929851539
- ↑ Kunz C.: TBE vaccination and the Austrian experience. Vaccine. 2003 Apr 1;21 Suppl 1:S50-5. PMID 12628814
- ↑ 13,0 13,1 http://www.bag.admin.ch/... - Empfehlungen zur Impfung gegen Zeckenenzephalitis, Eidgenössische Kommission für Impffragen des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit
- ↑ Rendi-Wagner P et al: Immunogenicity and safety of a booster vaccination against tick-borne encephalitis more than 3 years following the last immunisation. Vaccine. 2004 PMID 15530690
- ↑ Rendi-Wagner P et al: Persistence of protective immunity following vaccination against tick-borne encephalitis - longer than expected? Vaccine. 2004 Jul 29;22(21-22):2743-9. PMID 15246606
- ↑ http://www.rki.de/cln_011/nn_226862/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2005/30__05.html__nnn=true
- ↑ http://www.who.int/ith/countries/vaccination/en/
Togaviridae
Togaviren (Togaviridae) sind einzel(+)-strängige, behüllte RNA-Viren mit einem Durchmesser von 60-70nm. Die Reifung der Viren (Maturation) erfolgt an Plasmamembranen. Zu den Togaviren zählen die Gattungen der Alphaviren (bei denen die Krankheitserreger unter anderem durch blutsaugende Gliederfüßer auf den Mensch und Tiere übertragen werden) und Rubiviren (Erreger der Röteln).
Alphaviren
| Alphaviren | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Morphologie | ||||||||||||||||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||||||||||||||||
Das Alphavirus (früher: Arbovirus A) ist eine Virus-Gattung der Togaviridae. In diese Gattung sind etwa 20 umhüllte und positiv-einzelsträngige RNA-Viren mit einem Durchmesser von ca. 60 bis 70nm eingeordnet. Die Virushülle besitzt charakteristische Spikes aus Glycoproteinen. Sie vermehren sich im Zytoplasma und die Nukleinsäure allein ist bereits infektiös.
Alphaviren kommen weltweit vor. Die Krankheitserreger werden vor allem durch Stechmücken (z.B. Anopheles) übertragen (daher der alte Name Arbovirus als Akronym für arthropod(s) born viruses). Alphaviren können beim Menschen endemisch, epidemisch und sporadische Erkrankungen hervorrufen. Dabei überwiegen gutartige fieberhafte Infekte, die zum Teil mit Exanthem und Gelenkentzündung (Polyarthritis) einhergehen. Bei Tieren kommen aber auch letale Infektionen mit Beteiligung des Zentralnervensystems vor (Enzephalomyelitis-Viren der Pferde, deren Krankheitsbilder zu den anzeigepflichtigen Tierseuchen gehören).
Humanpathogene Alpha-Viren Viren sind das Chikungunya-Virus, das Ross-River-Virus, das O'Nyong-nyong-Virus, das Mayaro-Fieber-Virus, das Sindbis-Virus, das Semliki-Forest-Virus, das Mucambo-Virus und das Everglades-Virus.
Tierpathogene Viren sind (bei Pferden) das das Eastern Equine Encephalomyelitis Virus (EEE-Virus), das Western Equine Encephalomyelitis Virus (WEE-Virus), das Venezuelan Equine Encephalomyelitis Virus (VEE-Virus) und bei Nagetieren und Vögeln das Highlands J-Virus.
Chikungunya-Virus
Chikungunya-Fieber ist ein durch Viren ausgelöstes endemo-epidemisches tropisches Hämorrhagisches Fieber. Chikungunya heißt "der gekrümmt Gehende" und ist ursprünglich Kisuaheli. Im Deutschen wird die Krankheit auch „Gebeugter Mann“ genannt. Diese Erkrankung ist bislang nicht meldepflichtig.
Erreger: Das Chikungunya-Fieber wird durch das Chikungunya-Virus (CHIKV) ausgelöst. Das krankheitverursachende Virus ist ein behülltes Einzel(+)-Strang-RNA-Virus und gehört zur Gattung Alphavirus aus der Familie der Togaviridae. Außerdem gehört das Virus zur Gruppe der Arboviren und ähnelt denen, welche das Denguefieber und Gelbfieber auslösen und ist eng mit dem das O'nyong'nyong-Fieber verursachendem O'nyong'nyong-Virus verwandt.[1]. Als Reservoirwirte sind bislang Meerkatzen, Paviane und Nager festgestellt.[2]
Vorkommen: Das Chikungunya-Fieber ist erstmals 1952 in Tansania bekannt geworden. Später ist dieses Fieber sowohl in Westafrika wie auch in Indien, Südostasien und auf den Philippinen ausgebrochen. Die Bevölkerung in diesen Regionen hat sich jedoch als weitgehend immun gegen diesen Krankheitserreger erwiesen. Mittlerweile hat es sich zusammen mit der Asiatischen Tigermücke Aedes albopictus auf nahezu allen Kontinenten ausgebreitet. Seit etwa zehn Jahren sind auch Europa und Inseln im Pazifik und im Indischen Ozean betroffen. Im letzten Auftrittsgebiet der Inseln vor Ostafrika fehlt den dortigen Bewohnern und den Urlaubern aus Europa eine Immunität.
Übertragung: Das Chikungunya-Fieber kann nach Expertenmeinung theoretisch durch den Stich verschiedener Stechmücken der Gattungen Anopheles, Aedes, Culex und Mansonia übertragen werden. Als eindeutiger Vektor ist allein die ursprünglich aus Ostasien stammende Asiatische Tigermücke Aedes albopictus (seit neuerem auch Stegomyia albopicta) nachgewiesen.[3] Auch diese nur etwa 5mm große, schwarz-weiß gestreifte und sehr aggressive Mücke, die am Tage sticht und dies teilweise sogar durch die Kleidung hindurch, hat sich weltweit ausgebreitet und überträgt neben dem Chikungunya-Fieber auch noch das Dengue-Fieber, Gelbfieber, West-Nil-Fieber und weitere Krankheiten. Diese Mückenart kommt mittlerweile nur in den heißen Sommermonaten auch in Südeuropa vor, doch sind hier bislang noch keine mit dem Chikungunya-Virus infizierten Exemplare festgestellt worden.
Das Chikungunya-Fieber kann nicht direkt von Mensch zu Mensch weitergegeben werden.
Diagnose: Ein serologischer Test für Chikungunya ist von der Universität Malaya in Kuala Lumpur, Malaysia erhältlich.
Krankheitsverlauf und Symptome: Nach einer Inkubationszeit von zwei bis zehn Tagen entwickeln die Betroffenen in der Regel hohes Fieber mit Kopf- und schweren Gelenkschmerzen mit hoher Berührungsempfindlichkeit, so dass sie sich kaum noch aufrecht halten können. Andere häufige Symptome sind Erschöpfung, Hautausschlag und Atembeschwerden. Normalerweise klingt diese Erkrankung nach etwa zwei Wochen von selbst wieder ab und es bleiben auch keine Schäden zurück. Nach überstandener Krankheit kommt es zu lebenslanger Immunität.
Komplikationen: Die oben geschilderten Symptome können gelegentlich wiederkehren und bis zu neun Monate anhalten. Weiterhin können durch das hohe Fieber gelegentlich starke neurologische Störungen, Hirnhautentzündungen oder sogar Gehirnschäden verursacht werden. Ein schwerer Krankheitsverlauf kann auch zu einer paraviralen Arthritis führen. Auf La Réunion kam es durch diese Erkrankung sogar zu mehreren Todesfällen (siehe unten).
Therapie: Bisher gibt es keine kausale Therapie. Schmerzen können z.B. mit Paracetamol behandelt werden.
Vorbeugung: Es existiert bislang kein Impfstoff. Einzig wirksame vorbeugende Gegenmaßnahmen sind die Bekämpfung der Mücken, geschlossene Kleidung und Moskitonetze bei Nacht. Die Mückenbekämpfung in tropischen Regionen ist schwierig, da diese Insekten besonders zur Regenzeit dort auftreten, wo eine chemische Bekämpfung kaum möglich ist, ohne die Fauna nachhaltig zu schädigen.
Geschichte: Die Krankheit wurde das erste Mal im Jahre 1952 in Tansania und Uganda beschrieben.
Im Jahre 1999 gab es einen Ausbruch von Chikungunya in Malaysia, bei dem 27 Personen betroffen waren. Seit Dezember 2005 grassiert auf der französischen Insel La Réunion eine Chikungunya-Epidemie. Es sind dort nach Angaben der Behörden bislang 186.000 Personen infiziert und es gab bis Anfang März 2006 bereits 93 Todesfälle. Dies wird dadurch begünstigt, dass das Virus dort bislang unbekannt war und die Bevölkerung keine Immunität besitzt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie auf die vom Tourismus abhängige Insel können schwerwiegend sein. In Mauritius waren im Jahre 2005 3.500 Personen betroffen. Es gab auch Fälle auf der Komoreninsel Mayotte und in Madagaskar und auf den Seychellen.
In Deutschland wurden bereits Patienten ärztlich behandelt, die sich zuvor im Urlaub in einer entsprechenden Region infiziert hatten. Die Erkrankung kann in Deutschland allerdings nicht übertragen werden, da die Überträgermücke hierzulande noch nicht vorkommt und das Chikungunya-Fieber wie oben schon erwähnt nicht direkt von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann.
Ross-River-Virus
Das Ross-River-Virus (RRV) ist ein Arbovirus aus der Familie der Togaviridae (Genus Alphavirus). Es ist in Australien, auf Papua Neu-Guinea und den benachbarten Inseln endemisch und führt jährlich zu mehreren tausend Erkrankungen (sog. epidemische Polyarthritis).
Geschichte: Das Krankheitsbild ist seit den 1930er Jahren bekannt, die erste Isolation des Virus erfolgte in den 1960er Jahren. Seitdem hat sich das Virus weiter ausgebreitet, vermutlich weil durch verstärkte Migration neue und damit nicht immune Bevölkerungsgruppen betroffen waren. Endemische Gebiete finden sich in South Australia, im Northern Territory, in Queensland, Victoria und New South Wales. Eine weitere Ausbreitung ist theoretisch möglich, da die das Virus verbreitenden Vektoren (Stechmücken) auch auf anderen Kontinenten vorkommen.
Infektionsweg: Die Übertragung erfolgt durch Stechmücken der Familien Aedes, Culex und Mansonia. Das Reservoir sind vermutlich Kleinsäuger.
Klinik: Nach einer Inkubationszeit von 3 bis 9 Tagen kommt es zu plötzlich einsetzenden, symmetrischen Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Gelenksteifigkeit, leichte Temperaturerhöhung, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Lethargie, Hautausschläge und Kopfschmerzen. Die Erkrankung ist selbstlimitierend, Symptome können jedoch auch Monate bis Jahre andauern.
Therapie: Eine Impfung oder spezifische Therapie gibt es nicht, die Therapie ist symptomatisch. In den betroffenen Gebieten ist Schutz vor Stechmücken ratsam.
O'Nyong-nyong-Virus
Das O´nyong-nyong-Fieber wird durch das gleichnamige Virus ausgelöst. Das ss(+)RNA-Virus gehört zur Gattung der Alphaviren aus der Familie der Togaviren. Es besteht eine Verwandtschaft zum Chikungunya-Virus. Der Name bedeutet "Gelenkbrechen".
Vorkommen: Ost- und Zentralafrika. Das Virus wurde in Kenia, Malawi, Mozambique, Tansania, Uganda, Senegal und in der Zentralafrikanischen Republik festgestellt. Auch Touristikgebiete sind betroffen. Die Krankheit tritt sporadisch als Epidemie auf. Zwischen den Epidemien können oftmals 10 bis 20 Jahre liegen, dabei liegt die Durchseuchung in der Bevölkerung bei bis zu 80%. Das Virus wurde erstmals während einer großen Epidemie zwischen 1959 und 1962 in Uganda nachgewiesen. Damals erkrankten zwei Millionen Menschen. Es wird ein extrahumanes Reservoir vermutet.
Übertragung: O'nyong-nyong ist eine Arbovirusinfektion. Die Übertragung erfolgt durch Stechmücken (Anopheles gambiae und Anopheles funestus). Die Mücken sind dämmerungsaktiv, ihre Verbreitung ist an das Vorhandensein von stehenden Gewässern gebunden.
Diagnose: Typische Reiseanamnese, Antikörpernachweis im Blut, Klinik. Verwechslungen mit Chikungunya sind möglich.
Krankheitsverlauf und Symptome: Die Inkubationszeit beträgt 8–11 Tage. Die Krankheit beginnt plötzlich mit Schüttelfrost, hohem Fieber, Kopfschmerzen und Lymphadenitis. Es besteht eine Leukopenie mit relativer Lymphozytose. Charakteristisch sind die ausgeprägten, symmetrischen Gelenkschmerzen (Polyarthralgien), die über mehrere Wochen bestehen können. Nachfolgend makulopapulöser Ausschlag in ca. 60% der Fälle. Enantheme der Wangen- und Gaumenschleimhaut können auftreten. Die Symptome bilden sich nach 2 Wochen zurück. Inapparente Infektionen (ohne Krankheitsgefühl) sind häufig. Es bleibt eine lang anhaltende Immunität zurück. Tödliche Verläufe sind nicht bekannt.
Therapie: Eine kausale Therapie oder Impfung gibt es nicht, die Behandlung erfolgt symptomatisch.
Vorbeugung: Konsequenter Schutz vor Mückenstichen: Repellentien, Moskitonetze, helle, lange Kleidung, Vermeidung von Außenaufenthalten während und nach der Dämmerung.
Mayaro-Fieber-Virus
Sindbis-Virus
Das Sindbis-Virus löst das Sindbis-Fieber (Karelisches Fieber, Okelbokrankheit, Pogosta-Krankheit) aus. Die Übertragung erfolgt durch nachtaktive Stechmücken (Culicidae). Das Virusreservoir sind Vögel, eine Übertragung von Mensch zu Mensch durch Stechmücken ist möglich.
Vorkommen: Afrika, Asien, Nord- und Osteuropa
Klinik: Grippeähnlich, Inkubationszeit 4 Tage, Fieber, Kopf- und Gelenkschmerzen, Exanthem vor allem an Hand- und Fußsohlen. Der Verlauf ist gutartig.
Weblinks: Medizin.de - Ockelbo´sche Krankheit: Arbovirose Skandinaviens (28.10.2005)
Semliki-Forest-Virus
Mucambo-Virus
Everglades-Virus
Rubiviren
Rubellavirus
| Rubellavirus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Morphologie | ||||||||||
| umhüllt, ikosaedrisch | ||||||||||
Das Rötelnvirus (Rubella-Virus) ist der Erreger der als harmlosen Kinderkrankheit bekannten "Röteln" und der Verursacher der gefürchteten Rötelnembryopathie bei Infektion in den ersten Schwangerschafts-Wochen.
Der Erreger gehört zur Familie der Togaviridae. Es handelt sich um ein genetisch stabiles, behülltes, einzel(+)-strängiges RNA-Virus mit einer Größe von 50–70nm, dessen Kapsid von einer weiten, faltigen Lipidhülle mit Strukturproteinen (der Toga) umgeben ist. Der einzige Wirt des weltweit verbreiteten Virus ist der Mensch. Die Übertragung erfolgt mittels Tröpfcheninfektion.
Häufigkeit: Die Rötelninfektionskrankheit ist weltweit verbreitet mit eher niedriger Ansteckungsgefahr. Da der Mensch der einzige Wirt des Virus ist, bekommt sie in dichteren Populationsgebieten hohe Bedeutung. Die unvollständige Durchimpfung der Bevölkerung kann zu sporadischen und epidemischen Infektionen bei Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen führen. Bei Vorschuluntersuchungen von 2000 bis 2002 waren rund 86% der Kinder geimpft. Vor der Verfügbarkeit von Röteln-Impfungen behalf man sich zum Teil mit so genannten Rötelnpartys, damit sich die eingeladenen jungen Mädchen vor einer möglichen Schwangerschaft ansteckten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Schutzimpfung aller Kinder ab dem zwölften Lebensmonat, eine Wiederholungsimpfung möglichst im zweiten Lebensjahr, der Mindestabstand zur ersten Impfung beträgt einen Monat, außerdem eine Impfung aller seronegativen Erwachsenen (kein IgG nachweisbar).
Übertragung: Das Virus wird per Tröpfcheninfektion übertragen. Eine Woche vor Ausbruch des Exanthems bis eine Woche nach Exanthemausbruch ist der Patient infektiös.
Symptome: Nach einer Inkubationszeit von 14 bis 16 Tagen bilden sich bei 50% der Infizierten zunächst im Gesicht gerötete, einzelstehende Hauteffloreszenzen, die sich als kleinfleckiges makulöses oder makulopapulöses Exanthem auf den Stamm und die Extremitäten ausbreiten und den Masern ähneln, allerdings sind sie blasser und konfluieren kaum. Die Hauterscheinungen bilden sich meist nach etwa drei Tagen zurück. Begleitend tritt oft eine erhöhte Temperatur bis 39°C auf. Hinzu kommen eventuell Gliederschmerzen, Arthritis, Lymphknotenschwellung am Hinterkopf, Nacken und hinter den Ohren sowie eine Vergrößerung von Leber und Milz.

Die Symptome der Röteln bei Erwachsenen sind häufig stärker ausgeprägt als bei einer Rötelninfektion in der Kindheit, unterscheiden sich aber nicht wesentlich. Vor allem Gelenkbeteiligungen kommen bei Erwachsenen häufiger vor.
Komplikationen: Eine Rötelninfektion während der ersten Wochen der Schwangerschaft kann zu schweren Fehlbildungen des Ungeborenen führen (Rötelnembryopathie). Daher gehört die Untersuchung auf Röteln zur Mutterschaftsvorsorge. Mögliche Fehlbildungen sind Innenohrschwerhörigkeit, Rötelnkatarakt, Herzfehler, Gefäßfehlbildungen (offener Ductus Botalli, Septumdefekte und Fallot'sche Tetralogie), Spina bifida aperta und Enzephalomeningitis.
Diagnostik: Die Diagnostik in Bezug auf die Immunität gegenüber einer Rötelninfektion wird über den Nachweis von ausreichenden Titern an spezifischen Antikörpern im Serum durchgeführt. Der Nachweis des Rötelnvirus erfolgt durch die Isolation von Viren oder durch den Nachweis von viraler RNA. Man unterscheidet drei Möglichkeiten des Infektionszustandes:
- Immunität liegt vor, wenn eine Infektion durchgemacht wurde – diese führt zumeist zu einer lebenslangen Immunität – oder eine Impfung erfolgte und ausreichend hohe IgG-Antikörper in zwei verschiedenen Labortests (z.B. ELISA oder HAH) nachweisbar sind.
- Eine Primärinfektion liegt bei entsprechenden klinischen Symptomen und dem Nachweis von IgM-Antikörpern vor.
- Von einer Reinfektion spricht man, wenn IgM-Antikörper in zwei methodisch verschiedenen Labortests nachweisbar sind und gleichzeitig IgG-Antikörper für eine früher abgelaufene Rötelninfektion sprechen, diese Infektion verläuft überwiegend harmlos.


Differentialdiagnose: Masern, Scharlach, Infektiöse Mononukleose, Drei-Tage-Fieber, Ringelröteln u.a.m. Die Unterscheidung anhand des Exanthems ist oft schwierig.
Behandlung: Keine kausale Therapie. Bei starkem Fieber können fiebersenkende Mittel verabreicht werden, bei starkem Krankheitsgefühl wird Bettruhe empfohlen.
Prophylaxe: Die aktive Lebend-Impfung wird zumeist in der Kombination mit dem Masern-Mumps-Rubella (MMR)-Impfstoff durchgeführt. Eine postexpositionelle passive Impfung bei Schwangeren ist möglich.
Krankheitsbild Rötelnembryopathie: Bei der Rötelnembryopathie (auch Embryopathia rubeolosa, Congenitales Rubella-Syndrom (CRS) oder Gregg-Syndrom) handelt es sich um mögliche Folgeerkrankungen einer Röteln-Infektion während der Schwangerschaft. Die Infektion der Mutter kann auch subklinisch verlaufen. Die Wahrscheinlichkeit von kindlichen Schäden beträgt dabei 90%(!) bei einer Infektion in den ersten 8 Schwangerschaftswochen und 25%–35% bei einer Infektion während des zweiten Trimesters.
Der australische Augenarzt Sir Norman McAllister Gregg (1892-1966) beschrieb 1941 erstmals ein Fehlbildungssyndrom bei Neugeborenen, das, wie er erkannte, auf eine Rötelninfektion der Mutter während der Schwangerschaft zurückzuführen war. Man findet Innenohrschwerhörigkeit, Katarakt, Mikrophthalmie, Angiokardiopathien und intrauteriner Wachstumsretardierung (IUGR) auch psychomotorische Entwicklungsstörungen, welche häufig kombiniert mit der Mikrozephalie auftreten, sowie hypo- und aplastische Milchzahnanlagen. Die Infektion der Frucht im ersten Trimenon kann eine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch sein. Dieses Fehlbildungssyndrom gilt auch für andere pränatale Virusinfektionen (Mumps, Varizellen).
Außer dem genannten Syndrom kann es zur Fehl- und Frühgeburt kommen.
Pathogenese und Infektionsweg: Das Virus wird von der erkrankten Mutter diaplazentar auf den Embryo/Feten übertragen. Eine Rötelnerkrankung während der Schwangerschaft kommt nur zustande, wenn die Schwangere keinen ausreichenden IgG-Antikörper-Titer besitzt.
Epidemiologie: In Deutschland beträgt die Anzahl seronegativer Frauen im gebärfähigen Alter 4 bis 7%, sodass bei durchschnittlich 800.000 Geburten pro Jahr 30.000 Neugeborene durch eine pränatale Rötelninfektion gefährdet sind. Bei einer Rötelninfektion in den ersten zehn SSW besteht eine 90%ige Gefahr der Schädigung des Kindes, bis zur 17. SSW sinkt das Risiko auf 11 bis 33% und nach der 17. Woche auf ca. 4%.
Prophylaxe und Diagnostik: Bei geplanter Schwangerschaft sollte der Impfstatus, beziehungsweise IgG-Ak-Titer gegen Röteln überprüft werden, gegebenenfalls sollte eine Impfung erfolgen. Häufig ist die Schwangerschaft jedoch nicht geplant. Im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge werden Röteln-Antikörper bei allen Schwangeren bestimmt. Als grenzwertig werden Titer von 1:8 und 1:16 angesehen, bei 1:32 oder höher nimmt man einen ausreichenden Schutz an. Sind keine Antikörper nachweisbar, sollte die werdende Mutter den Kontakt zu rötelninfizierten Personen meiden. Bei Personen, die aufgrund ihres Berufs (Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen etc.) vermehrt mit Viren in Kontakt kommen könnten, ist evtl. auch eine mehrfache Immunglobulingabe in der Frühschwangerschaft angezeigt. Liegt ein unzureichender IgG-Ak-Titer vor und bestand Rötelnkontakt beziehungsweise der Verdacht auf eine Infektion, kann mit dem Einverständnis der Schwangeren eine pränatale Diagnostik durch eine Amniozentese oder eine Nabelschnurpunktion erfolgen. Im Blutserum eines rötelninfizierten Fetus lassen sich zu 94% IgM-Antikörper ab der 22. SSW nachweisen.
Ab der Geburt sind bei allen Neugeborenen mit Rötelnembryopathie selbst gebildete IgM-Antikörper und auch größtenteils von der Mutter stammende IgG-Antikörper vorhanden. Im Blut der Neugeborenen sind Viren vorhanden, die Kinder sind somit ansteckend. IgM-Antikörper können nicht über die Plazenta von der Mutter auf das Kind übertragen werden, sie sind deshalb immer Ausdruck einer konnatalen Infektion (Nachkommen werden bereits infiziert geboren).
Therapie: Nach einer Rötelnexposition sollte sofort der IgM/IgG-Immunstatus (HHT, ELISA) geprüft werden. Wenn nach einer Woche (maximal 10 Tage) bereits Röteln-Antikörper nachweisbar sind, dann bedeutet dies, dass die Schwangere eine früher erworbene Immunität besitzt und dass es zu keiner akuten Infektion kommt. Exponierte schwangere Frauen, die keine Antikörper besitzen können innerhalb von 48 Stunden nach Kontakt mit dem Virus ein Röteln-IgG-Ak-Serum (Röteln-Hyperimmunglobulin) erhalten. Danach ist die Wirkung unsicher, ab dem 5. Tag nach Exposition wirkungslos. Da die Röteninfektion eine Inkubationszeit von etwa 2-3 Wochen hat, ist die passive Immunisierung beim Auftreten von Symptomen (Rötelnexanthem) nicht mehr möglich.
Weblinks: RKI - Röteln
Quellen
- ↑ PMID 15891138
- ↑ http://arbmed.med.uni-rostock.de/bkvo/m3104.htm
- ↑ http://zdf.de/ZDFheute/inhalt/7/0,3672,3905287,00.htm
Was sind Bakterien?

Bakterien (Bacteria) (altgriechisch bakterion – Stäbchen) bilden neben den Eukaryonten (Lebewesen mit echtem Zellkern (Nucleus)) und Archaeen eine der drei grundlegenden Domänen, in die heute alle Lebewesen eingeteilt werden.
Traditionell wird die Bezeichnung "Bakterien" in der Mikrobiologie für alle mikroskopisch kleinen, meistens einzelligen Organismen gebraucht, die keinen echten Zellkern besitzen und deshalb zu den Prokaryoten gehören. Hierzu zählen auch die Archaeen, die heute einer separaten Domäne zugeordnet werden. Zur Abgrenzung von dieser Gruppe spricht man manchmal auch von Eigentlichen Bakterien oder Echten Bakterien. Früher wurden sie zur Unterscheidung von den dann Archaebacteria genannten Archaeen mit wissenschaftlichem Namen auch Eubacteria genannt. Dies war eine unglückliche Benennung, weil es auch eine Bakteriengattung Eubacterium gab. Da alle humanpathogene Bakterien echte Bakterien sind, ist mit "Bakterien" in diesem Buch immer die Domäne Bacteria gemeint.
Bei Bakterien bzw. Prokaryoten ist die DNA nicht in einem vom Zytoplasma durch eine Doppelmembran abgegrenzten Zellkern (Nucleus) enthalten wie bei Eukaryonten, sondern sie liegt als Kernäquivalent bzw. Nucleoid frei im Zytoplasma vor. Weiterhin besitzen Prokaryoten keine membranumschlossenen Zellorganellen wie Mitochondrien, Chloroplasten (Pflanzen), Endoplasmatisches Retikulum, Golgi-Apparat usw.
Bakterien wurden erstmalig 1676 von Antoni van Leeuwenhoek mit Hilfe eines selbstgebauten Mikroskops in Gewässern und im menschlichen Speichel beobachtet und von ihm in Berichten an die Royal Society of London beschrieben.
Im Jahr 1999 wurde das größte bislang bekannte Bakterium entdeckt: Die so genannte Schwefelperle von Namibia, Thiomargarita namibiensis, ist mit einem Durchmesser von bis zu einem dreiviertel Millimeter ein bereits mit bloßem Auge sichtbares Schwefelbakterium.
Morphologie

Nach der äußeren Form lassen sich Bakterien in Kokken (kugelförmige Bakterien z. B. Staphylokokken), Stäbchen, wendelförmige („spiralige“) Stäbchen (z. B. Treponema, Helicobacter) und Mycelbildner (Mycel = umfangreiches Gebilde aus meistens verzweigten Fäden, z. B. Actinomyces, Streptomyces) einteilen. Daneben gibt es noch fusiforme Bakterien (Stäbchen mit zugespitzten Enden, z. B. Fusobakterien), semmelförmige Stäbchen (z. B. Vibrionen), keulenförmige Stäbchen (Corynebakterien) und einige andere Formen. Manche Bakterien ordnen sich in typischer Gruppierung an, z. B. in Zweierpärchen (Diplokokken wie z. B. Pneumokokken), in Haufen (z. B. Staphylococcus aureus) oder Ketten (z. B. Streptokokken). Einige Bakterien weisen auch eine Schleimkapsel auf, mit der sich die Bakterien vor der Phagozytose schützen, so z. B. Pneumokokken, Meningokokken und Haemophilus influenzae.

Die Art der Begeißelung - sofern vorhanden - lässt sich als peritrich (rundum begeißelt), lophotrich (mehrere Geißeln an einem Bakterienpol), amphitrich (an jedem Pol eine oder mehrere Geißeln) oder monotrich (eine Geißel) begeißelt beschreiben. Geißeln dienen aktiver Bewegung.
Sporenbildner (z. B. Bacillus, Clostridien) lassen sich aufgrund der Lage (zentral, terminal, extern) und Verformung des Bakteriums durch die Spore (mit oder ohne Auftreibung) sowie anhand des Aussehens freier Sporen unterscheiden.
Färbungsverhalten


Die Gram-Färbung ist eine Methode zur differenzierenden Färbung von Bakterien. Sie ist nach dem dänischen Arzt und Bakteriologen Hans Christian Gram benannt, der sie am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte. Verschiedene Bakterien reagieren auf diese Färbung unterschiedlich. Daraus folgt eine Einteilung in sog.
- grampositive Bakterien, die nach dem Färbegang dunkelblau erscheinen, und
- gramnegative Bakterien, die ungefärbt sind. Sie können nachträglich mittels Fuchsin rot gefärbt werden (bei Verwendung der Phasenkontrastmikroskopie ist dies nicht mehr notwendig.)
Dies ist ein wichtiges Kriterium für die Unterscheidung verschiedener Bakterien nach der Struktur ihrer Zellwand.
Bedeutend ist das Färbeverfahren beispielsweise bei der Diagnostik von Infektionskrankheiten. „Grampositive“ und „gramnegative“ Bakterien reagieren unterschiedlich auf Antibiotika. Mit dieser schnellen diagnostischen Methode kann man in kurzer Zeit (in etwa fünf Minuten) anhand eines Abstriches das „Gramverhalten“ der Bakterien bestimmen. Damit hat man die Möglichkeit, sofort mit einer oft lebensrettenden antibiotischen Therapie zu beginnen, bevor das Ergebnis der oft mehrere Tage dauernden definitiven Identifizierung der bakteriellen Erreger vorliegt.
siehe auch weiter unten den Abschnitt über die Bakterienwand.
So einfach ist die Methode nicht. "Der Kritische Vorgang bei der Gram-Färbung ist die Entfärbung mit Alkohol. Zu kurze Alkoholeinwirkung hat zur Folge, daß gramnegative Keime positiv erscheinen; zu lange Alkoholbehandlung führt zu Entfärbung grampositiver Keime. Eine nicht optimale Entfärbung ist auch an den Zellen, z.B. Leukozyten zu erkennen. Bei ungenügender Entfärbung erscheinen Zellkerne und Zellplasma tiefblau, bei zu starker Entfärbung sind hingegen beide rot." Seeliger,H, G.Schröter. Medizinische Mikrobiologie,Urban und Schwarzenberg, 1990, S 19.--Meta-kaercher 13:21, 25. Jul. 2012 (CEST)
Stoffwechsel
Energie- und Stoffaufnahme
Einige Bakterien sind zur Photosynthese fähig, also phototroph, zum Beispiel die früher auch Blaualgen genannten Cyanobakterien, die meisten sind dagegen chemotroph. Von den Chemotrophen sind die meisten heterotroph (auf organische Verbindungen angewiesen), einige jedoch chemoautotroph, und zwar lithoautotroph.
Aerob - Anaerob
Lebensweise und Stoffwechsel der Bakterien können sehr verschieden sein. So gibt es Bakterien, die Sauerstoff benötigen (aerobe Bakterien oder Aerobier), Bakterien, auf die Sauerstoff meist wegen des Fehlens der O2-Radikal-Eliminatoren Katalase und Superoxiddismutase toxisch wirkt (obligat anaerobe Bakterien bzw. obligate Anaerobier), und Bakterien, die sowohl Sauerstoff als auch Sauerstoffmangel aushalten (fakultative Anaerobier).
Lebensraum
- freilebend
- intrazellulär lebend
Aufbau
Erbgut
Nucleoid
Nucleoide bestehen aus der frei im Zytoplasma liegenden meist zirkulären DNA des Bakteriums. Das Genom des Darmbakteriums Escherichia coli besteht aus knapp 4,7 Millionen Basenpaaren, deren Sequenz vollständig bekannt ist. Das DNA-Molekül ist etwa 1,4 mm lang, was etwa dem Tausendfachen des Zelldurchmessers entspricht, aber nur 2 nm breit und enthält rund 4.400 Gene. Die nach rechts gewundene DNA-Doppelhelix ist durch Verdrillung nach links stark verkürzt und in einem Bereich von etwa der Hälfte des Zelldurchmessers komprimiert (Nucleoid). Die Verdrillung wird durch das bakterielle Enzym Gyrase gewährleistet. Letzteres ist auch das pharmakologische Target der Antibiotikaklasse der 4-Chinolone wie z.B. Ciprofloxacin.
Plasmide
Plasmide sind kleine, ringförmige, zusätzliche DNA-Moleküle, die für das Überleben des Bakteriums nicht unbedingt notwendig sind. Sie kodieren z.B. Resistenzgene, Toxine u.ä. und werden unabhängig vom Bakterienchromosom vervielfältigt und bei der Fortpflanzung weitergegeben oder von einem Individuum auf ein anderes übertragen.
Zytoplasma
Das Zytoplasma besteht hauptsächlich aus Wasser und enthält u.a. Proteine und kleinmolekulare Substanzen wie Salze, Glucose, Speicherstoffe u.ä.
Ribosomen
Bakterielle 70S-Ribosomen bestehen aus einem 30S- und einem 50S-Teil. An ihnen findet die Translation der mRNA in die Aminosäurekette, also die Proteinbiosynthese statt. Der Translationsprozess am bakteriellen Ribosom lässt sich durch zahlreiche Antibiotika blockieren, so z.B. mit Aminoglykosiden, Makroliden, Ketoliden, Lincosaminen, Tetracyclinen, Chloramphenicol, Streptograminen und Oxazolidonen.
Zellmembran
Die Zellmembran, auch als Zytoplasmamembran bezeichnet, besteht aus einer Phospholipiddoppelschicht, in die zahlreiche Proteine, z.B. Porine, Transportproteine, Enzyme der Atmungskette, Mureinsyntheseproteine und Signalproteine integriert sind.
Zellwand
Murein



Sowohl Gram-positive als auch Gram-negative Bakterien (Domäne Bacteria) besitzen in ihrer Zellwand eine Festigkeit verleihende Schicht aus Murein, einem Peptidoglycan (PGN). Der Unterschied zwischen beiden Gruppen besteht u.a. in der Dicke der Hülle (Gram-positiv: 20-80 nm; Gram-negativ: < 10 nm).
Murein besteht aus Strängen der zwei miteinander verknüpften Zuckerderivatmoleküle N-Acetylglucosamin und N-Acetylmuraminsäure, die das Rückgrat bilden. Von jedem N-Acetylmuraminsäure-Molekül geht - an dessen Pyruvatgruppe gebunden - eine Oligopeptidkette zu einem N-Acetylmuraminsäure-Molekül eines benachbarten Stranges. Die parallel angeordneten Stränge sind auf diese Weise quervernetzt. Das Murein bildet so ein flächiges Netz, das die Oberfläche der Bakterienzelle umspannt.
Ein Bakterium ist also von einem einzigen Murein-Molekül umgeben. Es können mehrere Mureinnetze übereinander angeordnet sein. Dann sind die Murein-Schichten durch Oligopeptide verbunden. Vielschichtig ist das Murein insbesondere bei grampositiven Bakterien. Murein ist nicht bei allen Bakterien gleich aufgebaut, es variieren die Aminosäuren der Oligopeptide, aber das Rückgrat ist im Wesentlichen immer gleich. Grampositive Bakterien variieren stärker.
Die Mureinhülle hält den Bakterienprotoplasten gegen den osmotischen Binnendruck zusammen. Wird der Murein-Sacculus aufgelöst, zum Beispiel durch das Enzym Lysozym (Tränenflüssigkeit), platzt das Bakterium. Beim Wachstum eines Bakteriums muss deshalb das Mureinnetz erweitert werden, ohne dass eine größere Lücke entsteht. Mureinbausteine werden im Cytoplasma synthetisiert und mit Hilfe des Enzyms Bactoprenol exportiert. In dem außerhalb der Cytoplasmamembran gelegenen Mureinnetz werden durch spezifische lytische Enzyme lokal begrenzt Bindungen in den Rückgratsträngen und in den Oligopeptiden gelöst und die vorgefertigten und exportierten Mureinbausteine durch spezifische Enzyme wie z.B. der Peptidyltransferase (=Penicillin-bindende Proteine) integriert. Die Erweiterung des Mureins erfordert also ein genaues Zusammenspiel verschiedener Enzyme. Wird dieses Zusammenspiel gestört, platzt das Bakterium. Antibiotika wie z.B. β-Lactam-Antibiotika, Glycopeptide und Fosfomycin greifen in dieses Zusammenspiel störend ein.
Die Zellwand Gram-positiver Bakterien
Gram-positive Bakterien besitzen eine 20-80nm dicke Mureinschicht aus bis zu 40 Mureinlagen, in der verschiedene Lipoteichon- und Teichonsäuren eingelagert sind, die in die Umgebung ragen und z.B. das Komplementsystem oder Makrophagen aktivieren. Daneben können verschiedene Proteine in der Zellwand eingelagert sein, die für die Adhärenz (Clumping-factor und Fibronektin-Bindeprotein von S. aureus) oder Pathogenität (M-Protein von S. pyogenes) verantwortlich sind.
Die Zellwand Gram-negativer Bakterien
Die Zellwand Gram-negativer Bakterien besteht aus einer dünnen bis 10 nm dicken Mureinschicht, die von einer Lipiddoppelschicht, der sogenannten Äußeren Membran, bedeckt ist. Letztere ist mit der Mureinschicht über die outer membrane poteins (OmpA) und das Mureinlipoprotein verbunden. In der Äußeren Membran Gram-negativer Bakterien finden sich Lipopolysaccharide (LPS), die als Endotoxine wirken. Sie bestehen aus dem Lipoid A (der Zytokininduktor), dem Kern-Polysaccharid (Core) und der O-spezifischen Polysaccharidkette (das O-Antigen), mit deren Hilfe z.B. Salmonellen typisiert werden.
Kapsel
Manche Bakterien schützen sich mit einer Polysaccharid-Kapsel vor Phagozytose, so z.B. Pneumokokken, Meningokokken und Haemophilus influenzae. Aufgrund der antigenen Eigenschaften lassen sich verschiedene Kapseltypen differenzieren.
Geißeln (Flagellen)

Geißeln (Flagellen) dienen der Fortbewegung. Sie bestehen aus Flagellin und sind mit einem Motorkomplex in der Zellmembran (bzw. den Zellmembranen) und der Zellwand verankert. Der Motorkomplex setzt einen Konzentrationsunterschied an Protonen zwischen den beiden Seiten der inneren Zellmembran in eine Drehbewegung des auf einem gekrümmten "Haken" sitzenden Filamentes um und folgt damit einem ähnlichen Bauprinzip wie die ATP-Synthase.
Nach Anordnung und Anzahl der Flagellen unterscheidet man verschiedene Begeißelungstypen (in der Reihenfolge steigender Schwimmgeschwindigkeit):
- peritrich: Viele Flagellen sind gleichmäßig über die Zelloberfläche verstreut.
- polytrich-bipolar: Die Flagellen stehen in zwei gegenüberliegenden Gruppen an den Zellpolen.
- polytrich-monopolar: Die Flagellen stehen in einer Gruppe an einem der Zellpole (auch als lophotrich bezeichnet).
- amphitrich: Die Zelle hat nur zwei Flagellen, die an gegenüberliegenden Zellpolen stehen.
- monotrich: Die Zelle hat nur eine einzige Flagelle.
- lateral, seitliche Begeißelung: Geißeln stehen seitlich, nicht an den Polen der Zelle.
Geißelantigene (H-Gene; H für hauchförmiges Wachstum auf Agar) dienen neben den genannten O-Antigenen (O: ohne Hauch) bei Enterobakterien der Typisierung.
Weblink: Animation des Flagellenmotors (Eine Homepage der Intelligent-Design-Bewegung)., The Bacterial Flagellar Hook: A Molecular Universal Joint
Fimbrien und Konjugationspili
Einige Bakterien besitzen Pili, auch als Fimbrien bezeichnet. Das sind verschieden lange und in verschiedener Anzahl auf Bakterien vorkommende fädige Anhänge aus Protein, mit denen sich die Bakterien an Grenzflächen anheften können.
Konjugationspili (Sexpili) dienen der Verbindung zwischen zwei Bakterien zum Zweck eines Gentransfers.
Sporen
Sporen sind gegenüber Wärme, Kälte und Trockenheit hochresistente und langlebige Dauerformen, in die die Bakterien bei widrigen Umweltbedingungen übergehen. Man unterscheidet verschiedene Typen von Sporen. Endosporen werden im Inneren von Bakterien gebildet, sie kommen z.B. bei Clostridium- und Bacillus-Arten vor. Meistens wird je Zelle nur eine Endospore gebildet, die durch Zerfall der Mutterzelle freigesetzt wird. In dem Fall dienen sie also nicht der Vermehrung, sondern nur der Überdauerung und Verbreitung. Als Arthrosporen (auch Oidiosporen) bezeichnet man Sporen, die unter Zergliederung von Hyphen mycelbildender Mikroben gebildet werden. Sie kommen z.B. bei Streptomyceten und Actinomyceten vor und dienen nicht nur der Überdauerung, sondern auch der Vermehrung und Verbreitung. Chlamydosporen werden durch Umhüllung einer speziellen Hefenart mit einer dicken, resistenten Sporenhülle gebildet, wobei beispielsweise Candida albicans in einen Ruhezustand übergeht. Chlamydosporen haben nichts mit Chlamydien zu tun, dies sind gramnegative Bakterien ohne Sporenbildung. Die Bezeichnung Chlamydosporen ist nach heutiger Sicht taxonomisch falsch und führt zu vielen Verwirrungen. Pilze haben noch mehrere andere Formen von Sporen: Konidiosporen entstehen durch Abschnürung, Zoosporen sind begeißelt (und damit beweglich), Ascosporen ein haploides Meioseprodukt.
Biofilmbildung
Einige Bakterien können eine extrazelluläre glycosidische Matrix bilden, in der sie vor dem Immunsystem und Antibiotika geschützt sind. Biofilmbildung stellt ein Problem bei allen Arten von künstlichen Implantaten dar. Nachdem der Körper die Implantate mit Fibrinogen u.a. körpereigenen Substanzen überzogen hat, können sich Bakterien dort anheften, vermehren und eine bis zu mehrere Millimeter dicke Schleimschicht aufbauen.
Genetik
Bakterielle DNA
Die bakterielle Desoxyribonukleinsäure ist meist zirkulär und stark verdrillt organisiert und liegt frei im Plasma (Nucleosid). Weitere kleine und für die Zelle nicht essentielle Nucleinsäurenringe liegen als Plasmide vor. Im Ggs. zur eukaryontischen DNA enthält die bakterielle DNA keine Introns.
Replikation
Die Replikation verläuft ähnlich wie bei Eukaryonten ab, z.T. aber deutlich schneller. Der DNA-Doppelstrang wird entwunden und trennt sich an den origins of replication in zwei Einzelstränge auf. An diesen Stellen wird die neue DNA durch die DNA-Polymerase komplementär synthetisiert und es entstehen "semikonservativ" zwei identische Tochter-DNA-Doppelhelix-Moleküle, die jeweils einen neuen und einen alten (konservierten) Strang enthalten.
Transkription
 |
 |
 |
Die Information auf der DNA wird in die komplementäre mRNA, rRNA und tRNA umgeschrieben. Die Genabschnitte werden von Regulatorgenen (Promotoren) und Terminationssequenzen flankiert. Mehrere Gene, die an den gleichen Stoffwechselprozessen beteiligt sind können einem gemeinsamen Regulator unterstehen und bilden ein Regulon. Sind diese Gene auf dem Chromosom direkt hintereinander angeordnet spricht man von einem Operon. Beispiel (siehe Bild): Enzyme des Lactoseabbaus werden sinnvollerweise dann abgelesen, wenn auch Lactose vorhanden ist. Dies geschieht, indem Lactose den zuständigen Transkriptionsrepressor (kodiert vom Regulatorgen) inaktiviert und dadurch den Operator freigibt.
Translation
Die mRNA wird an den 70S-Ribosomen in die Aminosäurensequenz des zukünftigen Proteins übersetzt. Die mRNA kann dabei von mehreren Ribosomen gleichzeitig abgelesen werden.
Regulation der Genexpression
Die Genexpression wird über verschiedene Transkriptionsfaktoren (Regulatorgene) reguliert, die wiederum von anderen Effektoren angesteuert werden.
Mechanismen der Vielfalt
Mutation
Punktmutationen und Leserasterverschiebungen durch Additionen und Deletionen können spontan auftreten oder durch mutagene Agentien (radioaktive Strahlung, UV-Strahlung, Alkylantien) induziert werden.
Rekombination
Unter Rekombination versteht man den Austausch von Genabschnitten innerhalb des Bakteriengenoms an Stellen von Sequenzübereinstimmungen. Man unterscheidet die homologe Rekombination, bei der korrespondierende Sequenzen homologer Gene exakt ausgetauscht werden (Bsp.: Durch Austausch verschiedener Genkassetten des Pilins kann Neisseria gonorrhoae seine Antigenität ständig verändern und damit der Wirtsabwehr entgehen). Zum zweiten gibt es die ortsspezifische Rekombination bei der nur kurze Basensequenzen übereinstimmen müssen. Dieser Mechanismus liegt z.B. der Integration von Phagen-DNA in das Bakterienchromosom zugrunde.
Transposition
Transposition ist die "Rekombination" zwischen Genabschnitten, die keine Homologien aufweisen. Die mobilen DNA-Abschnitte heißen Transposons.
Gentransfer
Bakterien können über verschiedene Mechanismen Genmaterial untereinander austauschen.
Transformation
Bakterien können freie DNA aufnehmen und in das eigene Genom integrieren.
Transduktion
Bei der Transduktion wird die DNA durch einen Bakteriophagen von einem Donor auf den Rezeptor übertragen.
Konjugation
Konjugation ist der Austausch von Genmaterial zwischen zwei Bakterien durch direkten Zell-Zell-Kontakt z.B. mittels Konjugationspili.
Vermehrung
Die Vermehrung der Bakterien erfolgt meistens asexuell durch Zellteilung, bei zylindrischen durch Querteilung, bei einigen durch Knospung. Mycelbildende Bakterien vermehren sich oft durch Sporenbildung.
Übertragung von genetischen Informationen
Wird Genommaterial durch direkten Kontakt (Konjugation) von einer Bakterienzelle auf eine andere übertragen, bezeichnet man das als horizontalen Gentransfer. Für den direkten Kontakt produzieren einige Bakterien so genannte F-Pili (Fertilitätspili, Proteinröhren), mit deren Hilfe DNA von einer Zelle zur anderen übertragen werden kann. Die DNA-Übertragung kann auch ohne diese Pili erfolgen, wenn sich zwei Bakterienzellen eng aneinander legen.
Wachstum
Bakterienwachstum und -vermehrung folgt im nahrungstechnisch und räumlich abgeschlossenen System einer Bakterienkultur einer charakteristischen Wachstumskurve:
- Lag-Phase: Am Anfang sind Wachstum und Vermehrung gering, die Bakterien "akklimatisieren" sich an das herrschende Milieu.
- Beschleunigungsphase: Wachstum und Vermehrung beginnen und werden immer schneller.
- Exponentielle Phase: Die Bakterien vermehren sich exponentiell.
- Verzögerungsphase: Wachstum und Vermehrung werden langsamer.
- Stationäre Phase: Die Population bleibt stabil, Bakterienmasse und -anzahl nehmen nicht mehr zu, die Ressourcen werden voll ausgeschöpft, Wachstum und Absterben halten sich die Waage.
- Absterbephase: Durch Nahrungsverknappung, Anhäufung toxischer Stoffwechselendprodukte und dergleichen sterben die Bakterien ab.
Resistenz
Unter dem Begriff Antibiotika-Resistenz werden Eigenschaften von Mikroorganismen (Bakterien, Protozoen, Pilze) zusammengefasst, die es ihnen ermöglichen die Wirkung von antibiotisch aktiven Substanzen abzuschwächen oder ganz zu neutralisieren. Resistenz gegen Antibiotika tritt meist in Kombination oder als Anpassung an extreme Umweltbedingungen auf. So sind Streptomyceten als bodenbewohnende Bakterien nicht nur resistent gegen viele Umwelttoxine sondern auch gegen praktisch alle aktuell eingesetzten antibiotischen Wirkstoffe. Antibiotikaproduzenten wie Streptomyceten besitzen in den meisten Fällen Resistenzen gegen die von ihnen selbst erzeugten Stoffe.
Resistenzmechanismen
- Bakterielle Penicillinasen inaktivieren Penicillin
- Bakterielle β-Lactamasen spalten β-Lactam-Antibiotika
- Bakterielle modifizierte Penicillin-bindende-Proteine (PBP) mit geringer Affinität zu β-Lactam-Antibiotika
- Veränderung anderer Zielmoleküle
- Veränderung der Zellpermeabilität
- Synthese von Transportermolekülen (Effluxmechanismen), dazu gehören die sog. Multi Drug Resistance (MDR)-Proteine.
Entstehung
Bakterien besitzen oft eine sehr kurze Generationszeit, ihre Biomasse verdoppelt sich unter günstigen Bedingungen schon innerhalb von 20-30 Minuten. Vorteilhafte Mutationen können so relativ schnell entstehen. Verstärkt wird diese Tendenz durch eine Reihe von „mobilen Elementen“. Das sind DNA-Abschnitte, die im (Bakterien)-Chromosom oder außerhalb davon als Plasmide, Integrons, Transposons vorkommen. Sie übertragen "Resistenzkassetten" selbst zwischen wenig verwandten Arten.
Gegen manche Antibiotika bilden sich schneller Resistenzen als gegen andere. So bilden sich z.B. gegen Makrolide schnell Resistenzen, weil sie nur ein bestimmtes Enzym hemmen (Einschritt-Resistenzmuster). Ist das Bakterienenzym mutiert, wirken sie unter Umständen nicht mehr. Deshalb gibt es gegen Makrolide bereits zunehmend Resistenzen, obwohl sie erst in den 90er Jahren entwickelt wurden. Dagegen greift Penicillin an sechs verschiedenen sogenannten Penicillin-Binding-Proteins an. Es wird heute noch für viele Indikationen verwendet, obwohl es schon seit Jahrzehnten existiert.
Bisweilen setzt man Kombinationen von Antibiotika ein, um die Entwicklung von Resistenzen unwahrscheinlicher zu machen und die Wirkung zu verstärken. Daneben kann es auch sinnvoll sein, denselben Stoffwechselweg an unterschiedlichen Stellen zu hemmen.
Resistenzbestimmung
Es werden in der Regel automatisierte und in jedem Fall standardisierte Verfahren angewendet. Nach der Resistenzbestimmung werden die nachgewiesenen Keime als
- S - sensibel,
- I - Intermediär oder
- R - resistent
bezeichnet. Die Resistenzbestimmung dient dem Mikrobiologen und dem behandelnden Arzt zur Auswahl einer gezielten antibiotischen Therapie.
Arten der Antibiotikaresistenz
Je nach Ursprung der Resistenz lassen sich diese in verschiedene Klassen einteilen.
- Primäre Resistenz: Als primär wird eine Resistenz bezeichnet, wenn ein Antibiotikum bei einer bestimmten Gattung eine Wirkungslücke besitzt. So wirken beispielsweise Cephalosporine nicht bei Enterokokken und Ampicillin nicht bei Pseudomonas aeruginosa
- Sekundäre oder erworbene Resistenz: Diese Form der Resistenz zeichnet sich durch den Verlust der Wirksamkeit eines Antibiotikums bei einem primär nicht resistenten Bakterium aus. Sie kann spontan durch Mutation oder durch Übertragung entstehen.
- Resistenz durch Mutation: Mutationen im Genom finden natürlicherweise in einer Größenordnung von ca. 10-7 statt. Die Mutationsrate kann sich jedoch sprunghaft erhöhen, wenn durch spezifische Faktoren das Korrekturlesen ("proof reading"), der DNA-Polymerase deaktiviert wird. Das kann ein Weg sein schneller Resistenzen oder günstige Eigenschaften zu erwerben. Sie können zur Resistenz gegen ein Antibiotikum führen, welche sodann bei Exposition zum entsprechenden Antibiotikum zu einem Selektionsvorteil führt.
- Resistenz durch Übertragung: Bakterien können untereinander genetische Informationen übertragen, die auf Plasmiden, Transposons und Integrons lokalisiert sind.
Vorkommen
In den USA sind etwa 70% der in Krankenhäusern erworbenen infektiösen Keime resistent gegen mindestens ein Antibiotikum. Oft sind Patienten mit Bakterienstämmen infiziert, die gegen mehrere Antibiotika resistent sind ( Multiresistenz).
Sogenannte Problemkeime sind dabei vor allem
- der Methicillin-resistente S. aureus (MRSA),
- Pseudomonas,
- Escherichia coli und
- Mycobacterium tuberculosis.
Bakteriophagen - die Viren der Bakterien
 |
 |
Bakteriophagen werden nach ihrer morphologischen Struktur, ihrem Erbmaterial und ihrem Wirt eingeteilt. So unterscheidet man DNA-Phagen mit einsträngiger DNA, so genannte ss-DNA-Phagen (von engl. single-stranded) und doppelsträngiger DNA, sogenannte ds-DNA-Phagen (von engl. double-stranded). Die hier exemplarisch behandelten Escherichia coli-Phagen der T-Reihe werden zu letzterer Gruppe gezählt. Sie zeichnen sich gegenüber anderen Bakteriophagen durch einen relativ komplexen Aufbau aus. Grundlegend setzen sich die sogenannten T-Phagen aus einer Grundplatte, einem Injektionsapparat und einem Kopf, dem so genannten Capsid zusammen. Die Grundplatte (die wie Capsid und Injektionsapparat aus Proteinen aufgebaut ist) ist mit Schwanzfibern und spikes besetzt, die der Adsorption auf der Wirtszellwand dienen. Der Injektionsapparat besteht aus einem dünnen Rohr, auch Schwanzrohr genannt, durch das die Phagen-DNA in die Wirtszelle injiziert wird. Das Rohr wird von einer kontraktilen Schwanzscheide umhüllt, die sich während der Injektion zusammenzieht. Das Capsid ist aus 20 gleichartigen, dreieckigen Proteinplatten, den Capsomeren, zu einem Ikosaeder aufgebaut und enthält die DNA des Phagen. Aufgrund dieses Aufbaus zählen die E. coli-T-Phagen zu den strukturell komplexesten Viren. Phagen mit einsträngiger DNA sind dagegen meist klein, sphärisch und schwanzlos oder filamentös. Die ebenfalls auftretenden RNA-Phagen bestehen meist (soweit bis zu diesem Zeitpunkt beschrieben) aus einer Proteinhülle, die ein einsträngiges RNA-Molekül umschließt. Der Durchmesser dieser Phagen beträgt etwa 25 nm, sie gehören also zu den kleinsten Phagen.
Viren benötigen mangels eines eigenen Stoffwechsels zur Reproduktion einen Wirt, im Falle der Bakteriophagen eine lebende (geeignete) Bakterienzelle. Die Reproduktion lässt sich in fünf Phasen untergliedern:
- Adsorption an spezifische Zellwandrezeptoren,
- Injektion der Phagen-DNA in die Wirtszelle,
- Transkription des Virusgenoms, Translation der viralen mRNA, Replikation der Virusnukleinsäure und Entstehung von Virusbauteilen,
- Zusammenbau zu reifen Phagenpartikeln, dem assembly,
- Freisetzung der fertigen Viruspartikel durch Lysis der Wirtszelle.
Die beschriebene Vermehrung von Phagen nennt man lytischen Vermehrungszyklus bzw. Infektionszyklus, da sie mit der Zerstörung der Wirtszelle einhergeht. Daneben gibt es den lysogenen Vermehrungszyklus, bei dem nicht der Phage, sondern nur sein Bauplan als DNA kodiert im Bakteriengenom vorliegt und nicht transkribiert wird. Die latent in das Bakteriengenom integrierte (oder als Plasmid vorliegende) und ruhende Phagen-DNA nennt man Prophage. Der lysogene Prophage repliziert sich zusammen mit der Bakterien-DNA und kann unter bestimmten Bedingungen wieder in das lytische Stadium übergehen.
Bakteriophagen können für den Austausch von Genmaterial wie Virulenz- und Resistenzgene innerhalb einer Bakterienart und zwischen verwandten Bakterienarten verantwortlich sein.
Endosymbiontentheorie
Aufgrund biochemischer Untersuchungen nimmt man heute an, dass einige Organellen, die in den Zellen vieler Eukaryonten vorkommen, ursprünglich eigenständige Bakterien waren (Endosymbiontentheorie); dies betrifft die Chloroplasten und die Mitochondrien. Diese Organellen zeichnen sich durch eine Doppelmembran aus und enthalten eine eigene zirkuläre DNA auf der je nach Art ca. 5-62 Gene codiert sein können.
Phylogenetische Taxonomie

Eine phylogenetische Klassifikation anhand morphologischer und stoffwechselphysiologischer Merkmale ist bei den Bakterien in der Regel nicht möglich, sie muss auf der Basis der molekularen Struktur dieser Organismen aufgebaut werden. Die Klassifizierung erfolgt hauptsächlich mit Hilfe phylogenetischer Marker. Solche Marker sind zelluläre Makromoleküle, deren Zusammensetzung sich mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad verschiedener Organismen immer mehr unterscheidet. Zu den wichtigsten Molekülen dieser Art zählt derzeit die 16S-Untereinheit der ribosomalen RNA. Die Basensequenz dieser RNA soll die tatsächlichen evolutionären Beziehungen unter den Organismen widerspiegeln.
Das derzeit "gültige" phylogenetische System der Bakterien ist das nach Garrity, G. M.; J. A. Bell und T. G. Lilburn: "Taxonomic Outline of the Prokaryotes. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology", Second Edition, Release 5.0, Springer-Verlag, New York, 2004 (DOI: 10.1007/bergeysoutline200405), das gleichzeitig eine Klassifikation der Archaeen vornimmt. Nachstehend wird dieses System, beschränkt auf die Bakterien im eigentlichen Sinne (Domäne Bacteria) bis auf Ordnungsebene wiedergegeben.
| Phylum (Stamm) | Klasse | Ordnung |
|---|---|---|
| Aquificae | Aquificae | Aquificales |
| Thermotogae | Thermotogae | Thermotogales |
| Thermodesulfobacteria | Thermodesulfobacteria | Thermodesulfobacteriales |
| Deinococcus-Thermus | Deinococci | Deinococcales |
| Thermales | ||
| Chrysiogenetes | Chrysiogenetes | Chrysiogenales |
| Chloroflexi | Chloroflexi | Chloroflexales |
| Herpetosiphonales | ||
| Anaerolineae | Anaerolineales | |
| Thermomicrobia | Thermomicrobia | Thermomicrobiales |
| Nitrospira | Nitrospira | Nitrospirales |
| Deferribacteres | Deferribacteres | Deferribacterales |
| Cyanobacteria | Cyanobacteria | Subsectionen I - V |
| Chlorobi | Chlorobia | Chlorobiales |
| Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales |
| Rickettsiales | ||
| Rhodobacterales | ||
| Sphingomonadales | ||
| Caulobacterales | ||
| Rhizobiales | ||
| Parvularculales | ||
| Betaproteobacteria | Burkholderiales | |
| Hydrogenophilales | ||
| Methylophilales | ||
| Neisseriales | ||
| Nitrosomonadales | ||
| Rhodocyclales | ||
| Procabacteriales | ||
| Gammaproteobacteria | Chromatiales | |
| Acidithiobacillales | ||
| Xanthomonadales | ||
| Cardiobacteriales | ||
| Thiotrichales | ||
| Legionellales | ||
| Methylococcales | ||
| Oceanospirillales | ||
| Pseudomonadales | ||
| Alteromonadales | ||
| Vibrionales | ||
| Aeromonadales | ||
| Enterobacteriales | ||
| Pasteurellales | ||
| Deltaproteobacteria | Desulfurellales | |
| Desulfovibrionales | ||
| Desulfobacterales | ||
| Desulfarcales | ||
| Desulfuromonales | ||
| Syntrophobacterales | ||
| Bdellovibrionales | ||
| Myxococcales (3 Unterordn.) | ||
| Epsilonproteobacteria | Campylobacterales |
| Firmicutes | Clostridia | Clostridiales |
| Thermoanaerobacteriales | ||
| Haloanaerobiales | ||
| Mollicutes | Mycoplasmatales | |
| Entomoplasmatales | ||
| Acholeplasmatales | ||
| Anaeroplasmatales | ||
| Incertae sedis | ||
| Bacilli | Bacillales | |
| Lactobacillales | ||
| Actinobacteria | Actinobacteria | Acidimicrobiales |
| Rubrobacterales | ||
| Coriobacteriales | ||
| Sphaerobacterales | ||
| Actinomycetales (17 Unterordn.) | ||
| Bifidobacterales | ||
| Planctomycetes | Planctomycetacia | Planctomycetales |
| Chlamydiae | Chlamydiae | Chlamydiales |
| Spirochaetes | Spirochaetes | Spirochaetales |
| Fibrobacteres | Fibrobacteres | Fibrobacterales |
| Acidobacteria | Acidobacteria | Acidobacteriales |
| Bacteroidetes | Bacteroidetes | Bacteroidales |
| Flavobacteria | Flavobacteriales | |
| Sphingobacteria | Sphingobacteriales | |
| Fusobacteria | Fusobacteria | Fusobacteriales |
| Verrucomicrobia | Verrucomicrobiae | Verrucomicrobiales |
| Dictyoglomi | Dictyoglomi | Dictyoglomales |
| Gemmatimonadetes | Gemmatimonadetes | Gemmatimonadales |
Einteilung nach praktischen Gesichtspunkten
Aus praktischen Gründen werden Bakterien nach ihrer Form und ihrer Organisation unterteilt. Dabei werden kugelige Bakterien als Kokken, längliche, zylindrische Bakterien als Stäbchen und spiralige, wendelförmige Bakterien als Spirillen bezeichnet. Diese Grundformen können einzeln auftreten oder sich zu typischen Formen zusammenfinden (Haufenkokken = Staphylokokken, Kettenkokken = Streptokokken, Doppelkokken = Diplokokken). Des Weiteren bilden vor allem Stäbchenbakterien häufig, Spirillen immer eine oder mehrere Geißeln, so genannte Flagellen, aus, mit deren Hilfe sie sich fortbewegen können. Anzahl und Anordnung der Geißeln sind Unterscheidungsmerkmale. Einige Bakterien bilden Schleimhüllen, "Kapseln", aus, einige verschiedenartige Sporen. Weiterhin wichtig für die Klassifikation ist die Lebensweise, besonders der Stoffwechseltyp (Aerobier, fakultative Anaerobier, Anaerobier), sowie die Möglichkeit, die Bakterien auf bestimmte Weise zu färben. Die so genannte Gram-Färbung (eingeführt vom dänischen Bakteriologen Gram) lässt Rückschlüsse auf die Zusammensetzung und Struktur der Zellwand zu; die so genannten Gram-positiven Bakterien bilden wahrscheinlich sogar eine natürliche Verwandtschaftsgruppe, ein monophyletisches Taxon.
Serologisch unterscheidbare Variationen von Bakterien nennt man Serotypen.
Eine mögliche Einteilung der humanpathogenen Bakterien nach praktischen Gesichtspunkten finden Sie auf der nächsten Seite (gleichzeitig Inhaltsverzeichnis).
- Grampositive Kokken
- Grampositive Stäbchen
- Gramnegative Kokken
- Gramnegative Stäbchen
- Atypische Bakterien
Systematik und Inhaltsverzeichnis der Bakterien unter labortechnischen Gesichtspunkten:
- Gram-positive Bakterien
- Grampositive Kokken
- Anaerobe Gram-positive Kokken - Peptostreptokokken
- Aerobe Gram-positive Kokken
- Katalase-positive Kokken - Staphylokokken
- Koagulase-positive Staphylokokken - Staphylococcus aureus
- Koagulase-negative Staphylokokken (CONS) - Staphylococcus epidermidis u.a.
- Katalase-negative Kokken
- Streptokokken
- Nicht-hämolysierende Streptokokken
- S. mutans-gruppe
- α-hämolysierende Streptokokken (vergrünende Streptokokken)
- S. mitis-Gruppe mit S. pneumoniae - S. pneumoniae ist Optochin-empfindlich
- S. milleri-Gruppe
- S. mutans-Gruppe
- β-hämolysierende Streptokokken
- Gruppe A: S. pyogenes - Bacitracin-empfindlich
- Gruppe B: S. agalactiae
- Nicht-hämolysierende Streptokokken
- Enterokokken
- Streptokokken
- Katalase-positive Kokken - Staphylokokken
- Grampositive Stäbchen
- Aerobier
- Nicht verzweigte Aerobier
- Corynebakterien - Tinsdale-Agar, Neisser-Färbung
- Listeria - keine Hämolyse, Katalase positiv
- Bacillus - Sporenbildner
- Lactobacillus
- Erysipelothrix rhusiopathiae
- Verzweigte Aerobier
- Aktinomyzeten
- Nocardien - partiell säurefest
- Mycobakterien - säurefest
- Nicht verzweigte Aerobier
- Obligate Anaerobier
- Clostridien - Sporenbildener, Toxinbildner
- C. perfringens - Doppelhämolyse
- Propioni-Bakterien
- Clostridien - Sporenbildener, Toxinbildner
- Aerobier
- Grampositive Kokken
- Gram-negative Bakterien
- Gramnegative Kokken
- Anaerobe Kokken - Veillonella
- Aerobe Kokken - Oxidase-positiv
- Neisseria - Diplokokken
- Gonokokken
- Meningokokken
- Moraxella
- Neisseria - Diplokokken
- Gramnegative Stäbchen - Wachstum auf MacConkey-Agar
- Ernährungstechnisch anspruchsvolle Gram-negative Stäbchen
- Bordetella
- Brucella
- Campylobacter (Oxidase-positiv, Katalase-positiv)
- Helicobacter
- Legionella
- Pasteurella
- HACEK-Gruppe
- Haemophilus - Wachstum auf Kochblut, auf Blutagar nur mit S. aureus-Amme, kein Wachstum auf MacConkey-Agar.
- Actinobacillus
- Cardiobacterium
- Eikenella
- Kingella
- Ernährungstechnisch weniger anspruchsvolle Gram-negative Stäbchen
- Anaerobier
- Bacteroides
- Porphyromonas
- Prevotella
- Fusobacterium
- Aerobier
- Glucosestoffwechsel oxidativ
- Oxidase-positiv -> Pseudomonas - Kultur metallisch glänzend, beta-Hämolyse
- Oxidase-negativ -> Acinetobacter, Stenotrophomonas
- Glucosestoffwechsel fermentativ (aerobe und anaerobe Substratverwertungswege)
- Oxidase-positiv -> Aeromonas, Vibrionen
- Oxidase-negativ -> Enterobacteriaceae
- Escherichia coli - Rote Kultur auf MacConkey-Agar, Lactose-spaltend
- Shigella - helle Kultur auf MacConkey-Agar, nicht Lactose-spaltend
- Klebsiella - Lactose-spaltend
- Proteus - Schwärmphänomen, nicht Lactose-spaltend
- Enterobacter - Lactose-spaltend
- Citrobacter
- Serratia
- Enteritische Salmonellen - nicht Lactosespaltend
- Typhöse Salmonellen - nicht Lactose-spaltend
- Yersinien
- Glucosestoffwechsel oxidativ
- Anaerobier
- Ernährungstechnisch anspruchsvolle Gram-negative Stäbchen
- Gramnegative Kokken
- Atypische Bakterien
- Intrazelluläre Erreger
- Chlamydien
- Mycoplasmen - zellwandlos
- Rickettsien
- Rickettsia
- Bartonella
- Coxiella
- Ehrlichia
- Tropheryma Whippelii
- Spirochäten
- Borellia
- Leptospira
- Treponema
- Intrazelluläre Erreger
Grampositive Kokken
Anaerobe Gram-positive Kokken
Peptostreptococcus spp.
| Peptostreptococcus spp. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Peptostreptococcus spp. sind eine Gattung anaerober, Gram-positiver, nicht-sporen-bildender Bakterien. Die Bakterien sind klein, rund und können einzeln, paarweise oder in kurzen Ketten vorliegen. Peptostreptococcus wächst langsam und gewinnt zunehmend Resistenzen gegen Antibiotika.
Vorkommen: Peptostreptokokken leben als Kommensalen der Normalflora im Mund, Darm und Genitaltrakt. Sie kommen weltweit vor.
Krankheitsbilder: Unter opportunen Bedingungen wie Immunsuppression oder Trauma (Wundinfektionen) können sie endogene, eitrige Infektionen der Haut, Weichteile, Gelenke, Knochen, Gehirn und inneren Organe hervorrufen.
Therapie: Die Bakterien sprechen meist auf Penicillin G und Aminopenicilline an, alternativ können Clindamycin (ein Lincosamid), Carbapeneme oder Glycopeptide (Vancomycin) angewendet werden.
Staphylokokken (Katalase-positive Kokken)
Koagulase-positive Staphylokokken
Staphylococcus aureus
| Staphylococcus aureus | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Etymologie: Staphylococcus ist der latinisierter Singular des griechischen σταφυλόκοκκος, d.h. „die Traubenkugel“, aus älterem Griechisch σταφυλή, staphylé, „die Weintraube“ und κόκκος, kókkos, „das Kügelchen“, aureus lateinisch „der goldene“.
Morphologie und Eigenschaften: Staphylokokken sind kugelförmige, Gram-positive Bakterien, häufig in Haufen bzw. Trauben angeordnet. Sie sind unbeweglich und bilden keine Sporen. Die Größe des Bakteriums liegt bei 0,8 - 1,2 µm. S. aureus ist fakultativ anaerob, Katalase- und Koagulase-positiv. Auf z.B. Blutagar wachsen gelb-weißliche Kulturen, meist mit β-Hämolyse.
Vorkommen: S. aureus kommt fast ubiquitär in der Natur vor, auch als Kolonisationskeim bei vielen Menschen auf der Haut und in den oberen Atemwegen.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Adhäsine wie Clumping Factor A und B, Fibronectin-Bindungsprotein A und B sowie ein Kollagen-Bindungsprotein
- Polysaccharidkapsel mit Protein A -> Phagozytoseschutz
- Protein A bindet Fc-Teile von Ak -> Ak-Inaktiverung (statt Fab bindet Fc)
- Koagulase (Coa, bildet mit Prothrombin Staphthrombin) und Clumping Faktor (Clf, ein Fibrinogenbindungsprotein) -> Fibrinwall -> Schutz vor Immunsystem des Wirts
- Fibrinolysin zur Auflösung des Fibrinwalls bei Vermehrung
- Invasine: Hyaloronidase, DNAasen, Lipasen, Hämolysin, Exfoliatine A und B (5% der Staph. aureus) -> Eindringen ins Gewebe
- Leukocidin -> Abwehr gegen Granulozyten und Makrophagen
- TSST-1 (Toxic Shock Syndrome Toxine 1)
- PVL (Panton Valentin Leukocidin) ist ein Toxin welches von einer neuen und aggressiven Variante des Methicillin-resistenten S. aureus, dem cMRSA (community-associated MRSA) produziert wird.
Krankheitsbilder:
- Pyogene Infektionen, z.B. Furunkel, Karbunkel, Osteomyelitis, Pneumonie, Endokarditis, Abszesse, Empyeme, Sepsis
- Intoxikation (Lebensmittelvergiftung): Hitzebeständige Enterotoxine (Superantigene) führen nach kurzer Inkubationszeit zu Brechdurchfall (Toxinbedingte Fernwirkung).
- Exfoliatine A und B (5 % der Staph. aureus):
- Impetigo contagiosa - Blasenbildung am Ort der Infektion, bei immunkompetenten Patienten mit Antikörpern gegen Exfoliatine.
- Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (Morbus Ritter von Rittershain, Pemphigus neonatorum, Syndrom der verbrühten Haut) - Blasenbildung im Bereich der Haut, Rötung, Juckreiz, Lethargie, Fieber oder Hypothermie, Schleimhäute nicht mitbetroffen (im Gegensatz zum Lyell-Syndrom), Blasen ohne Erreger, hauptsächlich bei Kleinkindern und immunsupprimierten Erwachsenen über 60 Jahre. Das Toxin stammt aus lokalen Infektionen (Toxinbedingte Fernwirkung). Therapie: symptomatisch, Flüssigkeit, Haut wie bei Brandverletzten (ITS), Clindamycin als Antibiotikum der Wahl
 |
 |
 |
 |
 |
- Toxic Shock Syndrome - Toxinbedingte Fernwirkung. Früher bei Frauen aufgetreten, die eine neue Langzeittamponsorte verwendet hatte. Heutige Tampons sind sicher. Das Toxin wirkt als Superantigen (massive T-Zellaktivierung). Klinisch äußert sich das TSS durch Fieber über 38,5°C, diffuses makuläres Exanthem, Blutdruckabfall und nach ein bis zwei Wochen Hautschuppung. Zusätzlich sind definitionsgemäß drei weitere Organsysteme betroffen z.B. als Erbrechen/Diarrhoe, Anstieg der Retentions- und Leberwerte, Thrombozytopenie, psychiatrisch-neurologische Störungen und hyperämische Schleimhaut.
Staphylococcus aureus zählt zu den wichtigsten Erregern nosokomialer Infektionen. Der Erreger ist äußerst widerstandsfähig gegen Einflüsse wie Austrocknung und kann eine Reihe von Resistenzen gegenüber Antibiotika aufweisen.
Therapie: Häufig β-Lactamase-Bildung, zunehmend Mehrfach- und Multiresistenzen. Penicillin G oder Amoxicillin plus β-Lactamase-Hemmer (BLI). Bei Penicillinresistenz Isoxazolylpenicilline ("Staphylokokkenpenicillin") oder parenterale Cephalosporine der 1. (und 2.) Generation. Bei MRSA siehe unten.
Epidemiologie: Staphylokokken verursachen in den Industrieländern ca. 20 % der ambulant und 40% der nosokomial erworbenen Infektionen. In den USA verursacht S.aureus pro Jahr mehr als 1 Million invasive Infektionen, davon sind etwa 170.000 lebensbedrohlich und mehr als 30.000 enden tödlich.
MRSA und Antibiotika-Resistenzen:
MRSA ist die Abkürzung für Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. Methicillin ist ein β-Lactam-Antibiotikum und ein Indikatorantibiotikum für die Antibiotika-Sensitivität von Bakterien. Methicillinresistenz ist gleichbedeutend mit Resistenz gegenüber allen β-Lactam-Antibiotika. MRSA wird oft auch als multiresistenter S. aureus übersetzt. Synonym wird ORSA verwendet mit O für Oxacillin.
Resistenzmechanismen:
- Resistenzgen mecA, das für ein modifiziertes Penicillin-Bindungsprotein (PBP2a, syn. PBP2´) kodiert - Dieses PBP, die bakterielle Transpeptidase, ist für die Verknüpfung der Bausteine der Zellwand (Murein) verantwortlich und Zielmolekül der β-Lactam-Antibiotika. Das modifizierte PBP bindet keine β-Lactam-Antibiotika und bedingt die Resistenz. Charakteristisch für MRSA war bis vor kurzem, dass sie auch gegen weitere Antibiotikaklassen (beispielsweise Tetracycline, Aminoglykoside, Makrolide) Resistenzen erworben haben und damit eine Multiresistenz aufweisen. Seit wenigen Jahren beobachtet man zusätzlich eine neue Gruppe von MRSA, die diese Multiresistenz nicht aufweisen und als sog. community-acquired MRSA (auch community onset MRSA) bezeichnet werden.
- β-Lactamasen - Penicillinabbauende bakterielle Enzyme.
Entstehung, Vorkommen und Häufigkeit von MRSA:
Entstehung und Verbreitung durch klassische Selektion im evolutionsbiologischen Sinn in Bereichen mit hohem Antibiotikaeinsatz wie z.B. Krankenhäusern, bes. auf Intensivstationen. MRSA werden zunehmend auch außerhalb des Krankenhauses gefunden. Im englischen Schriftgut werden diese Keime als Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus bezeichnet. Darunter gibt es Keime mit besonders aggressiven Verhalten, die den sogenannten Panton-Valentine Leukozidin Faktor aufweisen.
Häufigkeit: In Deutschland liegt die MRSA-Rate in Krankenhäusern derzeit bei etwa 20% mit starken lokalen Unterschieden.
cMRSA: cMRSA (CA-MRSA, community-associated MRSA) ist eine neue und aggressive Variante des Methicillin-resistenten S. aureus. Die Variante infiziert auch gesunde Menschen und führt zu einer nekrotisierenden Pneumonie, die binnen weniger Tage letal enden kann. Neben Adhäsionssteigernden Proteinen soll für die Virulenz insbesondere das porenbildende Toxin PVL (Panton Valentin Leukocidin) verantwortlich sein, das die Zellmembranen von Epithelzellen und Immunozyten durchlöchert und eine hyperinflammatorische Immunreaktion induziert. Der Erreger scheint noch auf die meisten Antibiotika (außer Methicillin) anzusprechen, allerdings ist die Zeit für eine erfolgreiche Behandlung kurz. [1]
Therapie: Reserveantibiotika wie Linezolid (Empfehlungswert) Fosfomycin, Vancomycin und Streptogramine (i.v.) nach Antibiogramm.
Prophylaxe: Rationaler Einsatz von Antibiotika, hygienische Maßnahmen (bes. Händehygiene!), Isolierung bei Keimnachweis (Wirksamkeit umstritten).
Weblinks:
Koagulase-negative Staphylokokken (CONS)
Beispiele für CONS: S. capitis, S. cohnii, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis, S. lugdunensis, S. saprophyticus, S. schleiferi, S. simulans, S. warneri
Staphylococcus epidermidis
| Staphylococcus epidermidis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Kugelförmige, Gram-positive Bakterien, unbeweglich und keine Sporenbildung. S. epidermidis ist aerob, Katalase-positiv und Koagulase-negativ.
Vorkommen: Physiologischer Hautkeim
Pathogenitätsfaktoren:
- Adhäsine
- Biofilmbildung (Polysaccharide) -> Schutz vor Immunsystem des Wirts und Antibiotika
Krankheitsbilder:
- Generalisierte opportunistische und neonatale Infektionen (Sepsis)
- Fremdkörper-assoziierte Infektionen (z.B. an künstlichen Herzklappen, Kathetern, Shunts, Endoprothesen usw.)
Therapie: Penicillin G, bei Penicillin-Resistenz Isoxazolylpenicilline, ORSE: Vancomycin.
Staphylococcus saprophyticus
Krankheitsbilder: Harnwegsinfekte bei jungen Frauen
Streptokokken (Katalase-negative Kokken)
Morphologie und Eigenschaften: Streptokokken sind unbewegliche, kugelig bis oval geformte, Gram-positive Bakterien von etwa 0,5-1,5 µm Größe, die oft in Paaren oder Ketten gelagert sind. Sie lassen sich nach Hämolyseverhalten, Lancefield-Gruppierung und M-Fimbrienprotein einteilen:
- Hämolyseverhalten auf Blutagar:
- α-Hämolyse = Vergrünung durch unvollständige Hämolyse auf Blutagar mit Bildung grünlicher Zwischenprodukte (Methämoglobinbildung aus Hämoglobin)
- β-Hämolyse = Vollständige Hämolyse
- Lancefield-Gruppierung: Erfolgt anhand von Polysaccharid-Antigenen der Zellwand, gebräuchlich bei β-hämolysierenden Streptokokken (Gruppe A, B,...)
- M-Fimbrienprotein (über 80 Varianten): Wichtiger Adhärenz- und antiphagozytotischer Faktor bei β-A-Streptokokken.
β-hämolysierende Streptokokken
| Streptococcus pyogenes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Streptococcus pyogenes

Morphologie und Eigenschaften: Streptococcus pyogenes gehört zu den β-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe A (GAS) und ist ein Gram-positives, Katalase-negatives und kettenbildendes, fakultativ-anaerobes Bakterium. Es ist unbeweglich und bildet keine Sporen. Die einzelne Zelle ist rundlich und hat eine Größe von 0,6 bis 1 µm. Auf Blutagar wächst es in grauweißlichen schleimigen Kolonien. Zudem ist es Bacitracin-empfindlich.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Das M-Protein vermittelt sowohl die Adhärenz an Blut und Interzellularbestandteile als auch den Phagozytoseschutz durch Kreuzreaktivität mit Wirtsantigenen.
- Die Fibronectin-bindenden Proteine F1 und SfbI dienen dem Bakterium zum Anheften an die Endothelzellen.
- Streptolysin O und S
- C-Polysaccharidschicht der Zellwand: direkt gewebetoxisch
- Invasine wie DNase, Hyaluronidase, Streptokinase, Proteinase
- Scharlachtoxine (Bakteriophagen-kodiert): Erythrogene Toxine A, B und C
Krankheitsbilder:
- Tonsillitis, Pharyngitis, Sinusitis, Otitis media
- Scharlach - Infektion mit einem der drei toxinbildendenden Stämmen (lysogene Bakteriophagen).
- Klinik: Maximal eine Woche nach Infektion beginnt die Erkrankung akut mit Fieber, Erbrechen und zervikaler Lymphadenopathie. Typisch sind das feinfleckige Scharlachexanthem mit perioraler Blässe und die im Verlauf (nach Abschuppung der Beläge im Mund) auftretende "Himbeerzunge", sowie die abschuppende Haut im Bereich der Handinnenflächen. Nach fünf bis sechs Tagen kommt es zur Entfieberung mit Eosinophilie und Schuppung der vom Exanthem betroffenen Hautareale.
- Epidemiologie: In Deutschland erkranken ca. 30.000 Menschen pro Jahr, v.a. Kinder.
- Therapie: Antibiotika sind obligat wegen den drohenden Komplikationen (Rheumatisches Fieber, Nierenbeteiligung).
- Impetigo contagiosa (Kleinblasige Form)
- Erysipel (Entzündung der Lymphspalten)
- Fasciitis necrotisans (Zellulitis, Fourniersche Gangrän): Tiefe, rasch sich ausbreitende Kolliquationsnekrose der Faszie und Unterhaut mit einer Letalität um die 30-50 %. (Boulvardpresse: „Fleischfressende Bakterien“) Die Diagnose wird durch Probeexzision (Kolliquationsnekrose) und MRT gesichert. Therapeutisch ist ein radikales Debridement, oft auch die Amputation unausweichlich, um das Leben des Patienten zu retten.
- Sepsis
- Folgeerkrankungen:
- Rheumatisches Fieber durch kreuzreagierende Antikörper (Anti-Streptolysin O, ASL): Karditis und Polyarthritis zwei bis drei Wochen nach Streptokokkeninfekt.
- Glomerulonephritis durch Ablagerung von Immunkomplexen ein bis zwei Wochen nach Infektion.
Epidemiologie: Die Trägerquote ist im Kindesalter am höchsten (15 bis 20 %).
Diagnose: Klinik, Schnelltest bei Angina, Kultur, serologischer Nachweis von Anti-Streptolysin O (ASL) und Anti-DNase B.
Therapie: Indikation ist hauptsächlich die Prophylaxe von Folgeerkrankungen. Geeignete Antibiotika sind Penicillin G und V, Cephalosporine der 1. und 2. Generation und Makrolide.
Weblinks: RKI - Scharlach
| Streptococcus agalactiae | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Streptococcus agalactiae
Morphologie und Eigenschaften: Streptococcus agalactiae gehört zu den β-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe B. Das rundliche Bakterium ist aerob, katalase-negativ, unbeweglich und bildet keine Sporen.
Vorkommen: Besiedelung des Gastrointestinal- und Genitaltrakts (sexuelle Übertragung).
Krankheitsbilder: Sepsis und Meningitis beim Neugeborenen (Häufigkeit: 1/1.000 Geburten)
Therapie: Penicillin G, Cephalosporine 3. Generation, Erythromycin.
Prophylaxe: Empfohlenes Schwangerenscreening in der 35. bis 37. SSW (Selbstzahlerleistung).
α-hämolysierende Streptokokken (Vergrünende Streptokokken)

Viridans-Gruppe

Vorkommen: Physiologisch im Mundrachenraum (über 20 Spezies)
Krankheitsbilder:
- Karies - S. mutans, S. sangius, S. mitis
- Endokarditis lenta (50 bis 70 % der bakteriellen Endokarditiden, v.a. bei Herzfehlern, künstlichen Herzklappen, chronischen Infektionsherden im Mundrachenraum)
Prophylaxe der Endokarditis: Bei bekannten Herzfehlern (außer ASD), künstlichen Herzklappen usw. sollte vor medizinischen und zahnärztlichen Eingriffen eine Antibiotikaprophylaxe durchgeführt werden. Generell sind gesunde Zähne und Zahnfleisch von Vorteil (Zahnpflege, regelmäßige zahnärztliche Kontrolle.)
Endokarditisprophylaxe: Bsp.:
- Amoxicillin p.o.: 3g 1h vor und 1,5g 6h nach dem Eingriff
- Clarithromycin p.o.: 1g 2h vor und 0,5g 6h nach dem Eingriff
- Ampicillin i.v.: 2g 0,5h vor und 1g 6h nach dem Eingriff
- Clindamycin i.v.: 0,3g 0,5h und 0,15g 6h nach dem Eingriff
Therapie: 1.Wahl: Penicillin G und V, Amoxicillin, 2.Wahl: Cephalosporine der 1. und 2. Generation, Makrolide, Clindamycin, Vancomycin.
Streptococcus pneumoniae
| Streptococcus pneumoniae | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
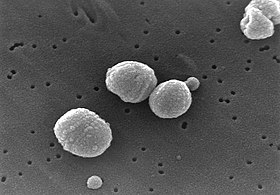 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Pneumokokken sind Gram-positive bis Gram-labile oft bekapselte Diplokokken. Sie sind rundlich, unbeweglich, bilden keine Sporen, sind Optochin-empfindlich sowie Katalase-negativ. Auf Blutagar wachsen sie in α-hämolysierenden, grüngelben und eingedellten, bei Bekapselung in schleimigen Kolonien.
Epidemiologie: Oft asymptomatische Besiedlung des Nasenrachenraumes. Etwa 30% der jungen Erwachsenen und etwa 60% der Vorschulkinder sind asymptomatisch besiedelt. Mit zunehmendem Alter nimmt die Trägerrate ab. Pneumokokken sind der häufigste Erreger der ambulant erworbenen Pneumonie und ein häufiger Erreger der Meningitis bei Erwachsenen.Schätzungen zufolge sterben 4.000 bis 8.000 Menschen in Deutschland pro Jahr an invasiven Pneumokokkeninfektionen.
Infektionsweg: Übertragung durch Tröpfcheninfektion, Infektionen sind meist endogener Natur.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Polysaccharidkapsel -> Phagozytoseschutz
- Pneumolysin O
- Resistenzen gegen Penicillin bzw. β-Lactam-Antibiotika durch verändertes PBP (Deutschland: ca. 10 %).
Faktoren zur Überwindung der Bluthirnschranke (Meningitis)[2]:
- H202 und Pneumolysin -> Apoptoseinduktion in den Endothelzellen, die die BHS aufbauen (unabhängig von TLR2 und TLR4).
- Zellwandbestandteile -> Apoptoseinduktion über den klassischen Caspase-Weg (TLR2-abhängig).
Krankheitsbilder: Pneumonie und Atemwegsinfekte, akute Otitis media, akute Sinusitis, Konjunktivitis, Meningitis (zweithäufigste Ursache für bakterielle Menigitiden bei Kindern unter fünf Jahren). Gefährdet sind v.a. Kleinkinder, Alte und Immunkompromitierte sowie Splenektomierte. Meist handelt es sich um endogene Infektionen.
Diagnose: Abgrenzung gegen andere α-hämolysierende Streptokokken mit Optochin-Test oder Gallelöslichkeit, serologischer Nachweis von Antikörpern gegen Kapselantigen.
Therapie: Penicillin G und V, Amoxicillin, bei Penicillinase-Bildern: Cephalosporine der 1. und 2. Generation, Vancomycin, Makrolide oder Clindamycin.
Prophylaxe: Schutz vor Pneumokokken bieten zwei Impfstoffe: Ein 23-valenter Polysaccharid-Impfstoff (Kapselantigen), der 90% der Pneumokokkentypen abdeckt steht seit vielen Jahren für ältere Kinder und Erwachsene zur Verfügung. Ein 7-valenter Konjugat-Impfstoff wurde im Februar 2001 zugelassen und ist für Säuglinge und Kleinkinder bestimmt.
Weblinks: RKI - Pneumokokkeninfektionen
Enterokokken
| Enterococcus spp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Enterokokken (Enterococcus spp.) werden zu den Milchsäurebakterien gerechnet. Es handelt sich um grampositive, teilweise in kürzeren Ketten, gepaart oder einzeln gelagerte, Katalase-negative und fakultativ-anaerobe Kokken mit variablem Hämolyseverhalten. Enterokokken zeichnen sich durch ihre hohe Umweltresistenz aus. So vermehren sie sich auch in 10-prozentiger Kochsalzlösung und sind Galle-resistent (Esculin-Test). Darüberhinaus exprimieren Enterokokken das Lancefield-D-Antigen weshalb sie früher auch als "Streptokokken der Gruppe D" bezeichnet wurden.
Vorkommen und Epidemiologie: Enterokokken gehören zur normalen Darmflora von Menschen, Säugetieren, Vögeln und Insekten. Als Umweltkeime können sie z.B. in Bodenproben oder (Ab-)Wasserproben nachgewiesen werden. Enterokokken gelten als opportunistische Infektionserreger und bedingen ca. 10 % der nosokomialen Infektionen. Infektionskrankheiten beim Menschen werden vor allem durch die beiden Spezies E.faecium und E.faecalis verursacht. Während bis vor wenigen Jahrzehnten das Verhältnis E.faecalis zu E.faecium bei 10:1 lag, verschiebt sich das Verhältnis derzeit insbesondere bei nosokomialen Infektionen zunehmend in Richtung E.faecium.
Krankheitsbilder: Opportunistische Infektionen (nosokomiale Infektionen): Zweithäufigster Erreger von Harnwegs- und chirurgischen Infektionen, dritthäufigster Erreger der Sepsis beim Erwachsenen, 5-15 % der Endokarditiden.
Diagnostik: Biochemie (Sherman-Kriterien)
Therapie: Die Therapie von Enterokkeninfektionen ist aufgrund zahlreicher intrinsischer und erworbener Resistenzen äußerst schwierig. Während E.faecalis in der Regel sensibel gegenüber Aminopenicillen ist, zeigen sich klinische Isolate von E.faecium in der Regel resistent gegenüber dieser Substanzklasse. Enterokokken sind grundsätzlich resistent gegenüber Cephalosporinen, man spricht deshalb auch von der "Enterokokkenlücke" der Cephalosporine. Häufig stellen Reserveantibiotika wie Vancomycin oder Linezolid die einzige Therapieoption bei Enterokokken dar. Insbesondere bei Endokarditiden oder anderen Blustroinfektionen wird häufig eine Kombination aus Aminopenicillinen oder Vancomycin mit einem Aminoglykosid (Synergismus)eingesetzt.
Literatur und Weblinks:
- Constanze Wendt, Henning Rüden, Michael Edmond: Vancomycin-resistente Enterokokken: Epidemiologie, Risikofaktoren und Prävention. Deutsches Ärzteblatt (Köln) 95(25), S. A1604 - A1611 (1998), ISSN 0012-1207
- M. Kolbert, P.M. Shah: Multiresistente Enterokokken: Epidemiologie, Risikofaktoren, Therapieoptionen. Arzneimitteltherapie 17(4), S. 133 ff. (1999), ISSN 0723-6913
- G. Schulze, W. Schott, G. Hildebrandt: Vancomycin-resistente Enterokokken - Krankenhausküche als Vektor? Bundesgesundheitsblatt 44(7), 732 – 737 (2001), ISSN 0007-5914
- A. Simon, N. Gröger, S. Engelhart, G. Molitor, M. Exner, U.Bode, G. Fleischhack: Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) - Übersicht zu Bedeutung, Prävention und Management in der Pädiatrie. Hygiene und Medizin 29(7/8), S. 259 ff. (2004), ISSN 0172-3790
Quellen
- ↑ Labandeira-Rey M et al. “Staphylococcus aureus Panton Valentine Leukocidin Causes Necrotizing Pneumonia”. Science, Epub: Jan 18 2007. DOI:10.1126/science.1137165. PMID:17234914
- ↑ Bermpohl D et al. “Bacterial programmed cell death of cerebral endothelial cells involves dual death pathways”. J Clin Invest, 115(6):1607-15, Jun 2005 Epub: May 2 2005. DOI:10.1172/JCI23223. PMID:15902310
Grampositive Stäbchen
Nicht-verzweigte aerobe Stäbchen
Corynebacterium diphtheriae
| Corynebacterium diphtheriae | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|

Morphologie und Eigenschaften: C. diphteriae sind Gram-positive, aerobe, schlanke und keulenförmige Stäbchen. Das Bakterium ist unbeweglich und bildet weder Kapsel noch Sporen. Mit der Neisser-Färbung lassen sich die für C. diphteriae und C. pseudodiphteriticum (!) charakteristischen Polkörperchen darstellen, bei denen es sich um die endständigen Auftreibungen aus Polyphosphaten und Calcium handelt und an deren Anzahl sich auch verschiedene Biotypen festmachen lassen. Unter dem Mikroskop lagern sich die einzelnen Stäbchen häufig V- oder Y-förmig an und erinnern so an chinesische Schriftzeichen. Die Isolierung von C. diphteriae gelingt auf Selektiv-Indikator-Medien, die die Begleitflora unterdrücken, z.B. auf dem Tellurithaltigen Clauberg-Agar. Das Toxin kann durch Elek-Test oder PCR nachgewiesen werden.
| Biotyp | Anzahl Polkörperchen |
| Corynebacterium diphtheriae gravis | 1 bis 2 |
| Corynebacterium diphtheriae intermedius | 3 bis 4 |
| Corynebacterium diphtheriae mitis | 5 bis 6 |
Übertragung: Die Übertragung erfolgt duch engen Kontakt (face-to-face) mit infizierten Personen, meistens durch Tröpfcheninfektion, seltener auch über kontaminierte Gegenstände.
Pathogenese: Der Erreger der Diphtherie gelangt über die Schleimhaut, Konjunktiven oder Wunden in den Körper und vermehrt sich dort. Das phagencodierte Diphtherietoxin, das nur von infizierten C. diphtheriae gebildet wird, schädigt lokal die Zellen (Rachen-, Haut-, Augen-, Nasen-, Kehlkopfdiphtherie). Bei der oropharyngealen Infektion finden sich im Nasen-Rachenraum und auf den Tonsillen die charakteristischen diphtherischen Pseudomembranen aus abgestorbenen Zellbestandteilen. Der Befall des Larynx führt zu Dyspnoe und Tod durch Ersticken, der Hals ist typischerweise stark geschwollen ("Cäsarenhals"). Die Erkrankung (bzw. das Toxin) kann sich obstruierend auf die tieferen Atemwege ausbreiten und systemisch Herz, Nieren, Nebennieren, Leber und motorische Nerven schädigen.


Das Diphtherietoxin: Das Gen dtxR für das Diphtherietoxin wird von einem lysogenen Prophagen kodiert, mit dem C. diphtheriae oft infiziert ist. dtxR wird durch tox+ reguliert, welches im Bakteriengenom zu finden ist. Das Diphtherietoxin setzt sich aus einem größeren B- und einem kleineren A-Teil zusammen. Der B-Teil bindet an das Protein HB-EGF-precursor (heparin binding epidermal growth factor precursor) auf der Oberfläche der Zielzelle. Das Toxin wird dann in einer Vakuole in die Zelle aufgenommen, wo sich der A-Teil abspaltet. Der A-Teil inaktiviert den Elongationsfaktor EF2 durch Übertragung eines ADP-Ribosyl von NAD auf EF2. Dadurch kommt die RNA-Synthese zum Erliegen und die Zelle stirbt ab.
Epidemiologie: Bis zum ersten erfolgreichen Impfversuch 1891 starben in Deutschland ca. 50.000 Kinder pro Jahr. In Mitteleuropa beträgt die Inzidenz heutzutage ca. 0,001/100.000/Jahr. In den ersten Jahren nach dem Ende der UdSSR gab es in den Nachfolgestaaten einen massiven Anstieg der Erkrankungen. In vielen Entwicklungsländern bleibt die Diphtherie weiterhin endemisch. Aufgrund der Trägerquote von etwa 2 % besteht die Gefahr sich bei Auslandsaufenthalten mit dem Toxin-codierenden Prophagen zu infizieren und zu erkranken. Die Erkrankung ist meldepflichtig!
Diagnostik: Die Diagnose wird klinisch gestellt! Eine Erregerbestimmung kann nicht abgewartet werden. Zur Diagnosesicherung kulturelle Untersuchung von Sputen, Magensaft, Kehlkopfabstricht, Harn, Ejakulat, Menstrualblut oder anderen Gewebsproben möglich. Außerdem Nachweis durch Mykobakterien-DNA.
Therapie: Heterologes Antiserum vom Pferd (schon bei Verdacht bestellen!), Antibiose (Penicillin, Erythromycin).
Prophylaxe: Aktive Immunisierung mit formalinbehandeltem Diphtherietoxin (Toxoid) im Rahmen der Grundimmunisierung.
Literatur und Weblinks:
- RKI - Diphtherie
- CoryneRegNet - Database of Corynebacterial Transcription Factors and Regulatory Networks
Weitere Corynebakterium spp.
Spezies und Krankheitsbilder:
- C. jeikeium - Sepsis, Katheterinfektionen
- C. minutissimum - Erythrasma
- C. kutscheri - Lokale Infektionen
- C. pseudodiphtheriticum - apathogen
- C. urealyticum - Harnwegsinfekte
Listeria monocytogenes
| Listeria | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Etymologie: Listerien haben ihren Namen vom britischen Chirurgen Joseph Lister.
Morphologie und Eigenschaften: Listerien sind Gram-positive, aerobe, begeißelte, differentiell bewegliche und fakultativ intrazelluläre, nicht verzweigte und oft kokkoide Stäbchen, die auch noch bei 4°C wachsen. Sie bilden kleine graue Kolonien mit β-Hämolyse und sind Katalase-positiv. Die Identifizierung erfolgt biochemisch, mittels PCR und Überprüfung der Beweglichkeit bei 10 bis 25°C.
Vorkommen: Listerien sind in der Umwelt nahezu ubiquitär verbreitet und kommen weltweit vor. Schätzungsweise 1 bis 10 % der Menschen tragen Listerien im Darm und scheiden sie im Stuhl aus. Gleiches gilt auch für viele andere Säugetiere. Listerien kommen vor allem in unerhitzten tierischen Lebensmitteln vor, insbesondere in rohen Fleischwaren und Geflügel, Meeresfrüchten, durch Verschleppung auch in Kochschinken oder Räucherlachs, sowie in unerhitzter Milch und Rohmilchkäse und in der Rinde von Weichkäsen und Schimmelkäse. Salat und Gemüse können durch organische Düngung belastet sein.
Übertragung: Hauptsächlich über kontaminierte Lebensmittel.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Hämolysin (Listeriolysin)
- Aktin-polymerisierendes Protein (ActA) -> Fortbewegung innerhalb der Zelle und in die Nachbarzellen hinein durch Aktinpolymerisierung am hinteren Pol des Bakteriums (analog "Raketenantrieb")
Krankheitsbilder: Die Listeriose verläuft bei Gesunden meist leicht oder subklinisch. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Opportunistische Infektionen umfassen Sepsis, Meningitis und Meningoenzephalitis, granulomatöse Hepatitis und in der Schwangerschaft Aborte und granulomatöse Neonatalerkrankungen. Die Letalität bei letzteren beträgt 20 bis 30 %, die konnatale Granulomatosis infantiseptika endet fast immer tödlich.
Epidemiologie: Schätzungsweise 1 bis 10 % der Menschen sind asymptomatische Träger von Listerien. Die Inzidenz an Erkrankungen beträgt nur etwa 0,5/100.000 in Europa, allerdings ist das Erkrankungsrisiko deutlich erhöht bei alten Menschen (3x), bei Schwangeren (17x) und bei AIDS-Kranken (>100x).
Diagnose: Anamnese (Urlaub, Nahrungsmittel). Der direkte Nachweis der Listerien in Blut, Liquor oder anderen Punktaten gelingt nicht immer.
Therapie: Ausreichend lange und hochdosierte Antibiotikatherapie: 1. Wahl ist Amoxicillin, daneben können Carbapeneme, Makrolide, Doxycyclin und Cotrimoxazol eingesetzt werden.
Prophylaxe: Kochen, Braten, Sterilisieren und Pasteurisieren tötet die Bakterien sicher ab.
Literatur und Weblinks:
- Glaser P. et al. (2001) Comparative genomics of Listeria species. Science 294:849-52.
- Vazquez-Boland JA et al. (2001) Listeria pathogenesis and molecular virulence determinants. Clin Microbiol Rev. 14:584-640.
- RKI - Listeriose
- YouTube: Listeria monocytogenes
Bacillus anthracis
| Bacillus anthracis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Bacillus anthracis ist der Erreger des Milzbrandes (int.: Anthrax).
Etymologie: Anthrax (griech.): Kohle
Morphologie und Eigenschaften: Bacillus anthracis ist ein Gram-positives, relativ großes (1–6μm), obligat aerobes, Katalase-positives, unbewegliches Stäbchenbakterium, welches sich vor allem über Sporen verbreitet. Die Sporen selbst bilden sich in der leicht verjüngten Mitte des Stäbchens, die Bakterien schließen sich typischerweise zu nichtverzweigten Ketten oder Fäden zusammen, die als bambusartig imponieren. In vivo bildet das Bakterium eine Kapsel aus Poly-D-Glutaminsäure aus, die es vor Phagozytose durch das MPS schützt. In der Kultur auf Blutagar fehlt diese Kapsel meist.
Übertragung: Die Bakterien überdauern in Sporenform jahrzehntelang im Boden. Werden sie von pflanzenfressenden Säugetieren, etwa Rinder, Schafe und Schweine beim Fressen aufgenommen, beginnen sie sich im Tier zu vermehren, töten das Tier und vermehren sich im Kadaver weiter, um, wenn die Vermehrungssituation ungünstig wird, schließlich wieder ins Sporenstadium überzugehen. Daher dürfen an Milzbrand verendete Tiere nicht vergraben werden, sondern müssen verbrannt werden. Die Sporen können auch im Fell oder auf der Haut der Tiere lange überleben. Epidemien der Krankheit stehen dabei häufig in direktem Zusammenhang mit der Tierhaltung oder der Verarbeitung von Tierprodukten. Kürschner, Melker und Tierärzte sind besonders gefährdete Berufsgruppen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch kommt in der Regel nicht vor, dennoch besteht Isolierungspflicht!
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
Die pathogenen Eigenschaften des Bakteriums lassen sich auf zwei Plasmide zurückführen.
- pX01 kodiert für das Toxin (pX01-negativ = apathogen)
- pX02 ist für die Bildung der Poly-D-Glutaminsäure-Kapsel verantwortlich (pX02-negativ = attenuiert)
Komponenten des Toxin:
- Die B-Untereinheit wird auch als protektives Antigen bezeichnet, da immunisierte Tiere gegen diese Untereinheit wirksame Antikörper bilden. Sie bindet an die Oberfläche von Körperzellen. Eine körpereigene Protease spaltet nun einen Teil dieser B-Untereinheit ab, woraufhin die verbleibenden 63kDa großen Teile sich zu Heptameren zusammenlagern und eine Pore bilden.
- Die A-Untereinheit ist variabel. Sie kann ein Ödem-Faktor (EF, edema factor) oder ein Letalitäts-Faktor (LF) sein. Beide Faktoren binden an das Heptamer aus B-Untereinheiten und iniziieren die Endozytose. Der niedrige pH-Wert im Endosom führt zu einer Konformationsänderung des Toxins. Dies bildet eine Pore, durch die die A-Untereinheit in das Zytosol gelangen kann.
- Der EF übernimmt nun die Funktion einer Adenylatcyclase und bildet cAMP. Die exzessiv erhöhten cAMP-Spiegel vermitteln einen Efflux von Wasser aus der Zelle und führen zum Ödem.
- Der LF beeinflußt auf nicht geklärte Weise die Mitogen aktivierten Protein-Kinasen (MAPK), die an der Regulation des Zellzyklus beteiligt sind. Dies führt zum Tod der Zelle und ist für die nekrotischen Läsionen des Milzbrandes verantwortlich.
 |
 |
 |
Krankheitsbilder:
- Lungenmilzbrand - Inhalativer Anthrax (selten), stadienhafter Verlauf: 1) Sporenstadium (Inhalation -> Phagocytose -> Transport in die mediastinalen Lymhknoten -> Germination (bis zu 60d nach Infektion), 2) Vegetatives Stadium (Toxin-vermittelte Erkrankung mit hämorrhagischer Lymphadenitis, Mediastinitis, Meningitis, keine Bronchopneumonie). Klinisch ebenfalls zwei Phasen: 1) Unspezifische grippaler-Infekt-ähnliche Symptome (kein Naselaufen!), 2) Rapide Verschlechterung mit Lymphadenopathie, Mediastinalverbreiterung und Schock. Komplikationen: Störungen des Elektrolyt- und Säuren-Basen-Haushalts, respiratorische Insuffizienz. Verlauf umso schlechter, je kürzer die Inkubationszeit (3 bis 60 Tage). Diagnose: selten rechtzeitig, wenn kein begründeter Anfangsverdacht besteht.
- Hautmilzbrand - Kutaner Anthrax (Inzidenz ca. 2.000/Jahr, Zimbabwe), Klinik: Allgemeinsymptome, als Pustula maligna bezeichnete Papel oder Pustel, die in eine schmerzlose Nekrose mit braunrotvioletter Umgebung übergeht, später zentral schwarzer Schorf
- Darmmilzbrand - Gastrointestinaler Anthrax (selten)
Epidemiologie: Milzbrand ist als Zoonose von Pflanzenfressern endemisch in Iran, Irak, Türkei und in der Sub-Sahara.
Diagnostik: Probentransport und Aufbereitung unter BSL-3-Bedingungen! Material: Blutkultur, Wundabstrich. Diagnose: Mikroskopie, Kultur, PCR
Therapie: Frühzeitige antibiotische Therapie bei begründetem Verdacht z.B. mit Penicillin G, Ciprofloxacin (Chinolon Gruppe 2), Makroliden oder Tetrayzyklinen. Chirurgische Massnahmen sind beim Hautmilzbrand kontraindiziert!
Prophylaxe: Als Vakzine steht seit 1930 ein attenuierter (Kapsel-defizienter) Impfstamm zur Verfügung: Lebendimpfstoff (vitale Bakterien), Totimpfstoff (zellfreier Überstand).
Geschichte: In den letzten Jahren hat sich B. anthracis einen Namen als potentielle biologische Waffe im internationalen Terrorismus gemacht. Mehrere Tote einer Anschlagsserie im Jahr 2001 in den USA konnten auf Briefe mit Anthraxsporen zurückgeführt werden. Allerdings bedarf es einer recht großen Menge von Sporen, um Anthrax als Biowaffe effektiv einzusetzen. Im Jahr 2002 wurde das Genom des Bakterium vollständig entschlüsselt.
Bacillus anthracis war das erste Bakterium, an dem Robert Koch 1877 eine krankmachende Wirkung nachwies. Ferdinand Julius Cohn vermutete bereits zwei Jahre zuvor, dass Milzbrand eine durch Bakterien verursachte Erkrankung sei.
Literatur und Weblinks:
- RKI - Anthrax
- Weitere Bilder des kutanen Anthrax bei CDC: [1], [2], [3]
- CDC - Anthrax
Weitere Bacillus spp.


- B. subtilis - Auf Blutagar wächst er in mattgrauen Kolonien mit β-Hämolyse. Erkrankungen: Endophthalmitis. Therapeutischer Einsatz bei intestinalen Störungen möglich.
- B. cereus - Nahrungsmittelvergiftungen mit Übelkeit, Erbrechen (emetisches Toxin) oder Durchfall und Bauchschmerzen (nekrotisierendes Enterotoxin). Die Sporen sind hitzeresistent. Epidemiologie: B. cereus verursacht etwa 1 % der Lebensmittelvergiftungen in den USA und etwa 11 % in den Niederlanden.
Therapie: Ciprofloxazin, Clindamycin, Vancomycin, Imipenem, Aminoglykoside u.a. Resistenz gegenüber Penicillinen und Cephalosporinen (β-Lactamase)
Erysipelothrix rhusiopathiae
Morphologie und Eigenschaften: Erysipelothrix rhusiopathiae ist ein grampositives, nichtsporenbildendes, aerobes, stäbchenförmiges Bakterium, das bei vielen Tieren in der Normalflora gefunden werden kann. Die Zoonose verursacht bei Schweinen den Schweinerotlauf, der für die Tiere oft tödlich endet.
Gefährdete Personengruppen: Landwirte, Schlachter, Veterinäre. (Berufskrankheit!)
Krankheitsbild: Erysipeloid (lokale (Hände) evtl. auch streuende schmerzhafte Hautrötungen meist ohne Allgemeinreaktion). Verlauf über zwei bis drei Wochen, i.d.R. selbstlimitierend. Die Infektion hinterlässt keine Immunität.
Inkubationszeit: Bis zu einer Woche.
Diagnose: Mikroskopie, Kultur.
Therapie: Symptomatisch, ggf. Antibiose (Betalactame).
Verzweigte aerobe Stäbchen
Aktinomyzeten
| Aktinomyzeten | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Aktino- und Streptomyzeten sind grampositive, nicht säurefeste, filamentöse und verzweigt wachsende Bakterien mit hohem GC-Gehalt. Sie bilden zwei artenreiche Gattungen innerhalb der Klasse der Actinobacteria. In der älteren Fachliteratur werden sie auch als

"Strahlenpilze" bezeichnet: Das myzelartige Wachstum dieser Bakterien lässt sie wie eine Pilzkolonie erscheinen. Actino- und Streptomyceten sind oft in der Lage, Sporen zu bilden, im Gewebe bilden sie sog. Drusen. Actinomyces spp. sind Fermenter, während andere Gattungen obligat aerob leben. Aktinomyzeten haben sehr große Genome, wobei die DNA im Gegensatz zu den meisten anderen Bakterien nicht in einem zirkulären, sondern in mehreren linearen Chromosomen angeordnet ist. Das Genom von Streptomyces coelicolor wurde vollständig sequenziert und 2002 veröffentlicht. Es beinhaltet die meisten Gene aller bisher untersuchten Bakterien.
Vorkommen: Aktino- und Streptomyceten stellen einen wesentlichen Bestandteil der Bodenmikroflora dar, nur wenige Arten leben aquatisch. Große Bedeutung haben die apathogenen Streptomyces spp. als Produzenten von Antibiotika (Bsp.: Chloramphenicol, Polyene, Makrolide, Tetracycline oder Aminoglycoside wie Streptomycin oder Neomycin, Streptomyces achromogenes produziert Streptozotozin). A. israelii der die Schleimhäute oft asymptomatisch besiedelt, ist an mehr als 50% der invasiven Aktinomykosen ist beteiligt.
Krankheitsbilder: Die sporadisch auftretenden Aktinomycosen sind fast immer aerob-anaerobe Mischinfektionen durch Actinomyces sp., die sich als Fisteln, Abszesse, Canaliculitis (lacrimalis) oder intrauterine Infektionen äußern. Je nach Lokalisation spricht man von orofazialer, thorakaler oder abdominaler Aktinomykose.
Therapie: Chirurgische und antibiotische Kombinationstherapie (anaerobe Begleitflora!). Gutes Ansprechen auf β-Lactam-Antibiotika, bei zervikofazialer Aktinomykose ist Amoxillinin/Clavulansäure Mittel der Wahl. Alternativen sind Makrolide, Doxycycline, evtl. auch Cephalosporine der 1. und 2. Generation.
Literatur und Weblinks:
- S. coelicolor Genome homepage (Sanger Institute)
Nocardien
Spezies: N. asteroides, N. farcinica, ...
Morphologie und Eigenschaften: Nocardien sind grampositive, obligat aerobe, verzweigt wachsende und partiell säurefeste Stäbchen. Charakteristisch ist der Geruch nach Erde/Kartoffel-Keller
Krankheitsbilder: Nokardiosen wie Subakute Bronchopneumonie, Endokarditis und Hirnabszesse bes. bei Immunsupprimierten
Übertragung: aus der Umwelt
Therapie: Tetrazykline und Cotrimoxazol, ferner eignen sich Carbapeneme und parenterale Cephalosporine 3a (z.B. Cefotaxim, Ceftriaxon).
Mykobacterien
Wichtigste Spezies sind die obligat pathogenen Mykobakterien M. tuberculosis, M. bovis und M. africanum, die zusammen als Mycobacterium tuberculosis complex bezeichnet werden und M. leprae, der Erreger der Lepra. Daneben existieren die ubiquitär vorkommenden und fakultativ pathogenen sog. atypischen Mykobakterien bzw. MOTT (mycobacteria other than tubercle bacilli) wie M. avium-intracellulare-Komplex, M. marinum, M. scrofulaceum und M. ulcerans. Weiterhin gibt es noch den Impfstamm Bacille Calmette-Guérin (BCG), der sich von M. bovis ableitet.
Mycobacterium tuberculosis
| Mycobacterium tuberculosis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Mycobacterium tuberculosis ist der Erreger der Tuberkulose (Tbc) des Menschen (entdeckt 1882 von Robert Koch).
Morphologie und Eigenschaften: Mycobakterien sind grampositive, verzweigt wachsende, aerobe Stäbchen, die aufgrund der wachsartigen Zellwand (hoher Gehalt an Mycolsäuren und sauren Lipiden) bestimmte Farbstoffe auch durch Säure- und Alkoholbehandlung nicht mehr abgeben und deshalb als säurefest bezeichnet werden. Der wichtigste Erreger der Tuberkulose, Mycobacterium tuberculosis wächst sehr langsam (Generationszeit 6 bis 20 Stunden), weswegen der kulturelle Nachweis einige Zeit beansprucht. Die Bakterien lassen sich mit der Ziehl-Neelsen-Färbung darstellen. Der Nachweis gelingt weiterhin durch Fluoreszenzmikroskopie und durch die Auramin-Rhodamin-Färbung. In der Gram-Färbung stellen sich Mykobakterien kaum dar, der Zellwandaufbau ähnelt jedoch stark dem grampositiver Bakterien, so dass Mycobacterium tuberculosis formal als grampositiv klassifiziert wird.
Epidemiologie: Heute ist etwa jeder dritte Mensch auf der Erde mit M. tuberculosis infiziert, von den 22 Millionen Tbc-Erkrankten leben 95 % in Entwicklungsländern. Pro Jahr kommen 9 Millionen Neuerkrankungen dazu und 3 Millionen Menschen sterben an Tbc, davon ca. 300.000 Kinder. Die Erkrankung ist ein Indikator für die Lebensverhältnisse (Wirtsabwehr) in den betroffenen Ländern.
In Deutschland liegt die Inzidenz bei etwa 13.000 pro Jahr (15/100.000). Etwa 1.000 sterben jährlich an der Krankheit (vierthäufigste Infektionsbedingte Todesursache). Disponiert sind Asyl-Suchende aus Afrika und Südostasien, Drogenabhängige, Alkoholiker und Obdachlose, aber auch AIDS-Kranke.
MDR (multi-drug-resistent)-Tuberkulosefälle sind im Zunehmen begriffen. In Deutschland sowie in vielen anderen Ländern ist die Tbc meldepflichtig.
Übertragung: In der Regel durch Tröpfcheninfektion. Die Infektionsdosis (ID50) liegt bei unter 10 Keimen! Sind Keime im Sputum nachweisbar, spricht man von "offener" Tbc was gleichbedeutend ist mit akut kontagiös, was etwa bei jeder zweiten frisch diagnostizierten aktiven Tbc der Fall ist. Durch Husten entsteht dann ein infektiöses Aerosol, wobei die Erreger stundenlang in der Raumluft verbleiben. Da Rinder ebenfalls an der Tuberkulose erkranken können, war früher nicht-pasteurisierte Milch eine verbreitete Infektionsquelle. Wegen der Übertragbarkeit von Tieren auf Menschen zählt die Tbc zu den Zoonosen. Weitere Übertragungswege sind über die Haut, die sogenannte Inokulations-Tbc, fetal durch erregerhaltiges Fruchtwasser und diaplazentar-hämatogen.
 |
 |
 |
 |

Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- M. tuberculosis: Cordfactor (Trehalose-Dimykolat, ein oberflächenaktives Glykolipid) und stark sauere Lipide bilden eine wachsartige Kapsel -> Hemmung der Phagosomen-Lysosomen-Fusion im Makrophagen.
- Langsames Wachstum
- Antibiotikaresistenzen
Krankheitsbilder: Die Tuberkulose (kurz TBC oder Tbc, früher auch die Schwindsucht oder der Morbus Koch, umgangssprachlich „die Motten“) ist eine chronische, in Stadien ablaufende Infektionskrankheit. Die Erreger der Tuberkulose sind Bakterien des Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis und M. africanum) mit der namensgebenden und bedeutendsten Art M. tuberculosis. Nur etwa 5-10% der mit M. tuberculosis Infizierten erkrankt an Tuberkulose, betroffen sind besonders Menschen mit geschwächtem Immunsystem.
Die Primärinfektion der Lungen führt zur Granulombildung mit Befall der zugehörigen regionären Lymphknoten (Primärkomplex oder Gohn-Komplex). Die exogene Zweitinfektion oder endogene Reaktivierung führt zur Postprimär- oder Sekundär-Tbc. Manifestationen umfassen Granulome, käsige Pneumonie, Kavernenbildung und bei fulminantem Verlauf massive Streuung tuberkulöser Herde in sämtliche Organe (Miliartuberkulose). Die Patienten klagen über Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust (B-Symptome, DD.: Malignom!), Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Gliederschmerzen, Husten, Dyspnoe, allgemeine Schwäche und Magendarm-Beschwerden.
Unterernährte und geschwächte Menschen sind besonders anfällig für die Erkrankung.
Krankheitsbilder bei Tieren: Tiere infizieren sich stets durch an offener Tuberkulose erkrankte Menschen. Beobachtet wurde eine Erkrankung bei Rind, Schwein, Pferd, Schaf und Ziege. Hühner sind weitgehend resistent gegen M. tuberculosis. Bei erkrankten Tieren entwickelt sich meist nur ein schnell abheilender örtlicher Prozess. In solchen Fällen ist es angeraten, die die Tiere betreuenden Menschen auf Tuberkulose zu untersuchen. Wesentlich ernster ist die Infektion von Haustieren, die mit dem Menschen in enger häuslicher Gemeinschaft leben. Hunde, Katzen und evtl. Papageien werden zuerst von offen tuberkulösen Menschen angesteckt, entwickeln selbst eine meist offene Tuberkulose und bilden dadurch eine gefährliche Ansteckungsquelle für Menschen, die mit ihnen in Kontakt kommen.
Atypische Mycobakterien (MOTT): Weitere durch Mycobakterien (MOTT) verursachte Erkrankungen sind Haut- und Weichteilinfektionen (M. marinum, M. chelonei), pulmonale Infektionen (M. kansasii, M. xenopi), Lymphadenitis (M. avium-intracellulare, M. scrofulaceum) und systemisch-miliare Infektionen (M. avium-intracellulare, M. kansasii, M. genevensae). AIDS-Kranke erkranken relativ oft an M. avium. Atypische Mycobakterien spielen insbesondere bei AIDS-Patienten eine Rolle.
Diagnostik:
- Tuberkulin-Haut-Tests (Tine-Test, Mendel-Mantoux-Test) sind nur eingeschränkt verlässlich.
- Bakteriologischer Nachweis und/oder mittels PCR im Bronchialsekret oder Magensaft bei offener Tuberkulose mit Resistenzbestimmung
- Röntgenuntersuchung oder CT der Lunge, die oft das charakteristische, mottenfraßartige Bild des Lungenbefalls der Tuberkulose erkennen lassen.
- Lymphknotenbiopsie (nativ, nicht in Formalin werfen!)
Therapie: Die Kombinationstherapie erfolgt mit Antituberkulotika wie Isoniazid (INH), Rifampicin (RMP), Ethambutol (EMB), Streptomycin (SM) und/oder Pyrazinamid (PZA). Für Deutschland wird als kalkulierte Standardtherapie die Einnahme einer Vierfach-Kombination von Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamid plus Ethambutol und/oder Streptomycin über zwei bis drei Monate und anschließend einer Zweierkombination von Isoniazid und Rifampicin für mindestens vier weitere Monate empfohlen. Nach Anzüchten und Resistenzbestimmung gezielte Antibiose. Probleme machen erstens Resistenzen (Therapiedauer dann mindestens 18 Monate), die Compliance, auch hinsichtlich der notwendigen langen Therapiedauer und des bevorzugt erkrankten Klientels sowie die Nebenwirkungen der Antituberkulotika und die Behandlung erkrankter schwangerer Frauen.
MOTT sind häufig resistent, weswegen kein Standardtherapieregime existiert, zur Anwendung kommen Kombinationen z.B. mit Makroliden, Clarithromycin oder Azithromycin.
Prophylaxe:
- Eine Schutzimpfung Bacillus Calmette-Guérin (BCG) gegen die Tbc wird heute von der Ständigen Impfkommission nicht mehr empfohlen, wegen eher unzureichender Wirkung und erschwerter Diagnostik bei Erkrankungsverdacht (Tuberkulin-Test positiv nach BCG-Impfung).
- Chemoprophylaxe nach Kontakt mit Tbc-Erkrankten oder Tuberkulinkonversion
Geschichte der Tbc:
Tuberkulose ist seit dem Altertum bekannt. Skelettüberreste von prähistorischen Menschen (4000 v.Chr.) zeigten Spuren der Krankheit. Tuberkulöse Zerstörung wurde auch in Knochen ägyptischer Mumien von 3000-2400 v.Chr. gefunden. Es gab Hinweise auf Tuberkulose in Indien und Amerika um 2000 v.Chr.
Um 460 v.Chr. kennzeichnete Hippokrates von Kós die "Phthisis" (griech. φϑίσις = Schwund) als die weitestverbreitete Krankheit aller Zeiten, die fast immer tödlich war.
Wegen der Vielzahl ihrer Symptome wurde die Krankheit bis in die 1820er Jahre nicht als einheitliche Krankheit erkannt und erst 1839 von Johann Lukas Schönlein "Tuberkulose" genannt.
Das Bakterium M. tuberculosis wurde am 24. März 1882 durch Robert Koch beschrieben. Er erhielt 1905 für diese Entdeckung den Nobelpreis in Physiologie. Koch glaubte nicht, dass sich die bovine und menschliche Tuberkulose ähnlich waren, was die Erkennung infizierter Milch als Quelle der Erkrankung verzögerte. Später wurde diese Quelle durch Pasteurisierung beseitigt. Koch benannte 1890 einen Glycerin-Extrakt der Tuberkelbazillen als "Hilfsmittel" zur Erkennung der Tuberkulose und nannte ihn Tuberkulin. Es war nicht wirkungsvoll, aber wurde später von Pirquet für einen Test der latenten Tuberkulose angepasst.
Der erste echte Erfolg bei der Immunisierung gegen Tuberkulose wurde von Albert Calmette und Camille Guerin 1906 mit ihrem Bacillus Calmette-Guérin (BCG)-Impfstoff erreicht. Es wurde zuerst am 18. Juli 1921 in Frankreich am Menschen angewendet. Nationalistische Strömungen verhinderten den weitverbreiteten Gebrauch bis nach den Zweiten Weltkrieg.
Tuberkulose verursachte im 19. und frühen 20. Jahrhundert allgemeines Interesse als "die" endemische Krankheit der städtischen Armen. 1815 war in England einer von vier Todesfällen und 1918 ein Sechstel der Todesfälle in Frankreich durch Tuberkulose verursacht. Das erste Tuberkulose-Sanatorium wurde 1859 in Polen geöffnet; später 1885 in den Vereinigten Staaten. Nach der Erkennung der Krankheit als ansteckend wurde die Tuberkulose in den 1880ern eine meldepflichtige Krankheit in Großbritannien. Es gab Kampagnen gegen des Ausspucken auf öffentlichen Plätzen und die Armen wurden angehalten, in Sanatorien zu gehen, die eher Gefängnissen ähnelten. Trotz des behaupteten Nutzens der Frischluft und der Arbeit im Sanatorium verstarben 75% der Insassen innerhalb von fünf Jahren (1908).
In Europa verursachte die Tuberkulose 1850 500 von 100.000 und 1950 50 von 100.000 Todesfällen. Verbesserungen im öffentlichen Gesundheitswesen verringerten Zahl der Erkrankungen schon vor Einführung der Antibiotika.
1946 mit der Entwicklung des Antibiotikums Streptomycin wurde neben der Prävention die aktive Behandlung möglich. Davor war nur die chirurgische Behandlung bekannt, insbesondere die Pneumothorax-Technik. Die kollabierte Lunge sollte durch die Ruhigzustellung ausheilen. Diese Methode wurde nach 1946 wegen des geringen Nutzens zunehmend verlassen.
Hoffnungen, dass die Krankheit vollständig besiegt werden könnte, sind seit dem Auftreten von antibiotikaresistenten Stämmen in den achtziger Jahren zerschlagen. So gab es um 1955 50.000 Tuberkulose-Fälle in Großbritannien. 1987 waren es 5.500, aber im Jahre 2001 wieder über 7.000 bestätigte Fälle. Wegen dem Nachlassen der Bemühungen des öffentlichen Gesundheitswesens in New York in den siebziger Jahren gab es ein Wiederaufflammen in den achtziger Jahren mit Zunahme resistenter Stämme. Die WHO erklärte 1993 die Tuberkulose zur globalen Katastrophe. Ein weiterer Grund für die erneute Zunahme der Tuberkulose-Fälle in der westlichen Welt ist die steigende Zahl an Menschen mit Migrationshintergrund aus Ländern mit hoher Prävalenz.
Die WHO hat den 24. März im Jahr 1982 zum Welttuberkulosetag erklärt.
Weblinks: RKI - Tuberkulose
Mycobacterium leprae
Mycobacterium leprae wurde 1869 durch den Norweger G. Armauer Hansen entdeckt und ist der Erreger der Lepra (Aussatz), an der in den Tropen immer noch sehr viele Menschen erkrankt sind.
Morphologie und Eigenschaften: Ähnlich wie bei anderen Mycobakterien. M. leprae lässt sich allerdings nicht auf Nährböden anzüchten.
Krankheitsbild: Mycobacterium leprae ist der Erreger der Lepra, einer seit der Antike bekannten Infektionskrankheit. Sie wird auch als Hansen-Krankheit, Aussatz oder Miselsucht (engl. leprosy) bezeichnet. Die Inkubationszeit beträgt mehrere Monate, manchmal auch Jahre. Für die Übertragung bzw. Infektion mit dem Erreger bedarf es eines längerfristigen Kontakts mit einem Infizierten.
Pathogenese: Die Leprabakterien zerstören die Nerven. Die resultierende Polyneuropathie mit Sensibilitätsverlust führt zu unbemerkten Verletzungen, Verstümmelungen und Infektionen.
Die Symptome der Lepra variieren stark. Auf dem VI. Internationalen Lepra Kongress 1953 in Madrid wurde folgende Einteilung vorgschlagen:
- Indeterminierte Lepra (Frühstadium)
- Tuberkoloide Lepra
- Lepromatöse Lepra
- Borderline
Indeterminierte Lepra (Frühstadium)
Im Frühstadium spricht man von indeterminierter Lepra. Sie äußert sich in unscharf abgegrenzten Flecken auf der Haut. Bei dunkelhäutigen Menschen sind diese heller als die gesunde Haut, bei hellhäutigen sind sie gerötet. Die Flecken selbst fühlen sich für den Erkrankten taub an. In dieser Phase kann die Krankheit stagnieren, spontan abheilen oder zur tuberkoloiden, lepromatösen oder Borderline Lepra weiterentwickeln.


Tuberkoloide Lepra Die asymmetrischen Hautflecken sind hier erhaben und rau. An den betroffenen Stellen fallen die Haare aus. Neben der Haut sind vor allem die peripheren Nerven knotig verdickt. Der Befall ist auch hier asymmetrisch. Mit fortschreitender Krankheit nimmt der Tastsinn bis zur Empfindungslosigkeit ab. Die Folge sind oft schwere Verletzungen und daraus resultierend weitere Verstümmelungen. Der Befall motorischer Nerven äußert sich in Muskelatropie und Paresen.
Borderline Lepra Die Borderline Lepra gilt als instabile Krankheitsvariante, die sich je nach Immunitätslage weiterentwickelt. Bei intaktem Immunsystem bildet sich die bakterienarme, tuberkoloide Form heraus. Bei geschädigtem Immunsystem vermehren sich die Bakterien nahezu ungestört und es kommt zur Ausbildung der bakterienreichen, ansteckenden lepromatösen Form. Die Symptome im Borderline Stadium können sowohl denen der tuberkoloiden Lepra ähneln als auch deutlich Abweichungen zeigen. So können die Hautflecken symmetrisch sein, auch der Befall der Nerven kann symmetrisch erfolgen.
Lepromatöse Lepra Die lepromatöse Lepra ist die schwerste Form der Krankheit. Die sich ungehemmt vermehrenden Bakterien verbreiten sich über Blutbahn, Nervengewebe, Schleimhäute und Lymphsystem im ganzen Körper. Die Haut ist stark verändert und von Knoten und kleinen Flecken überzogen. Charakteristisch sind die hellroten bis braunen Leprome, die das Gesicht und andere Körperteile zersetzen. Besonders im Gesicht verschmelzen diese zu einem "Löwengesicht" (Facies leonina). Im weiteren Verlauf kann ein geschwüriger Zerfall mit Befall von Knochen, Muskeln und Sehnen und einem Befall der inneren Organe erfolgen.
Der Tod tritt nicht unmittelbar durch den Erreger ein, sondern durch Sekundärinfektionen.
Geschichte:
Lepra ist eine der ältesten bekannten Krankheiten und wird schon in den frühesten Schriften erwähnt. Neuesten Forschungsergebnissen zufolge liegt die Wiege der Lepra wahrscheinlich in Ostafrika. Mit den Völkerwanderungen vor Zehntausenden von Jahren hätten sich die Bakterien von dort aus nordwestwärts nach Europa und Richtung Osten nach Indien und Asien ausgebreitet.
Im Alten Testament wird im 3. Buch Mose (Levitikus) Kapitel 13 Vers 1–46 ausführlich beschrieben, woran Aussatz zu erkennen ist und wie mit den Erkrankten zu verfahren sei. Allerdings wird nicht streng zwischen Lepra und anderen Hautkrankheiten unterschieden. Aufgrund des damals unvollständigen medizinischen Wissens wurden viele Hautkrankheiten als Lepra bezeichnet, die tatsächlich vorliegende Krankheit ist nicht immer nachvollziehbar. In Griechenland und in Italien zu Ciceros Zeiten scheint Lepra häufig vorgekommen zu sein. Später, im 7. und 8. Jahrhundert, war sie unter den Langobarden sehr verbreitet, und in Bremen wurden schon im 9. und in Würzburg im 11. Jahrhundert Hospitäler für Leprakranke gegründet. Das Leprosorium Aachen-Melaten wurde lt. Ausgrabungsergebnis im 8. Jh. an der Königsstraße nach Maastricht gegründet. Die allgemeinere Verbreitung des Aussatzes in Europa im Mittelalter wird oft den Kreuzzügen zugeschrieben. Sie erreichte ihren Höhepunkt im 13. Jahrhundert und verschwand mit dem Ende des 16. Jahrhunderts fast ganz aus der Reihe der chronischen Volkskrankheiten in Mitteleuropa.

Allerdings weist Meyers Konversationslexikon von 1888 darauf hin, dass Lepra in Skandinavien, auf Island und der Iberischen Halbinsel, in der Provence und an den italienischen Küsten, in Griechenland und auf den Inseln des Mittelmeers regelmäßig vorkommt. Im Verlauf der Kolonialisierung gelangte der Erreger nach Westafrika und Amerika und durch den weiteren Sklavenhandel in die Karibik und nach Brasilien. Am verbreitetsten jedoch sei die Krankheit im 19. Jahrhundert in Norwegen gewesen, wo man 1862 noch 2.119 Aussätzige bei nicht ganz 2 Millionen Einwohnern zählte. In Deutschland wurden zur gleichen Zeit nur vereinzelte Fälle registriert. Insgesamt hat sich der Lepraerreger in der Zeit seiner weltweiten Ausbreitung genetisch kaum verändert, was für Bakterien extrem ungewöhnlich ist. Dennoch ließ sich mit den winzigen genetischen Unterschieden der Verbreitungsweg der Lepra nachträglich mit hoher Genauigkeit feststellen.
Andere neue Forschungen gehen davon aus, dass die Lepra hauptsächlich durch die Tuberkulose zurückgedrängt wurde. Die von der Lepra geschwächten Patienten wurden oft auch von der Tuberkulose befallen, welche die Patienten wesentlich schneller tötete als die Lepra und so eine Ausbreitung der Lepra verhinderte.
Therapie früher:
Ein erster großer Fortschritt im Kampf gegen die Lepra war die Entdeckung des Krankheitserregers M. leprae durch den norwegischen Arzt Gerhard Armauer Hansen im Jahr 1873. Der deutsche Dermatologe Eduard Arning begann am 28. September 1884 ein vierjäriges Menschenexperiment an dem damals 48jährigen gesunden Polynesier Keanu, das den Nachweis der Übertragbarkeit der Lepra erbrachte.
Erste wenngleich wenig erfolgreiche Therapieansätze gab es schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Sulfonamidtherapie brachte der Lepratherapie in den 40er Jahren einen Durchbruch. 1947 führte Archie Cochrane Dapson (DDS) in die Therapie ein, das bis heute bedeutsamste Sulfonamid.
Therapie:
Die Heilungsaussichten sowie die geeignete Therapieform hängen ab von der Erscheinungsform und dem Fortschritt der Erkrankung. Zur Klärung wird hierzu ein Lepromintest durchgeführt. In Abhängigkeit von der Diagnose ist eine monate- bis jahrelange Kombinationstherapie mit den Medikamenten Dapson, Clofazimin (ab 1962) und Rifampicin (ab 1971) erforderlich. Es kommt vor, dass ein Wechsel der Immunitätslage zu einer Verschlechterung des Zustandes führt. Diese Veränderung wird Lepra-Reaktion genannt und erforderte eine gute Therapieführung.
In den 70er Jahren wurden Kombinationstherapien mit mehreren Antibiotika entwickelt und in einem mehrjährigen Feldversuch auf Malta erfolgreich getestet. Daraufhin empfiehlt die WHO seit 1982 die Polychemotherapie in einer bis heute kaum abgewandelten Form.
Obwohl es immer noch Versorgungsschwierigkeiten mit den benötigten Medikamenten in armen Ländern gibt, konnte die Lepra in den 1990er Jahren weiter zurückgedrängt werden. Die WHO hat sich die Ausrottung der Seuche zum Ziel gesetzt.
Sonstiges: Eine Anzüchtung des Erregers in vitro ist bis heute noch nicht gelungen. Seit 1960 gelang es jedoch M. leprae in Mäusepfoten zu züchten. Wegen ihrer ungewöhnlich niedrigen Körpertemperatur sind seit 1971 neunbändige Gürteltiere die für die Anzüchtung des Erregers geeignete Tiergruppe. Dies macht sie auch unverzichtbar bei der Erforschung von Impfstoffen.
Literatur und Weblinks:
- RKI - Lepra
- Dissertation über Lepra im Mittelalter
- Lepramuseum Münster - Gesellschaft für Leprakunde e. V.
Obligat anaerobe Stäbchen
Clostridien
Während alle anderen Anaeobier eher eitrige und/oder septische Erkrankungen hevorrufen, lösen die sporenbildenden Clostridien schwere toxinvermittelte Krankheitsbilder aus.
Clostridium tetani
| Clostridium tetani | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Clostridium tetani ist ein keulenförmiges, grampositives Stäbchen, obligat anaerob und bildet terminale Endosporen aus.
Vorkommen: Im Darm von Tieren und ubiquitär im Erdreich
Virulenzfaktoren: Das Bakterium bildet vor allem die Toxine Tetanospasmin (Nervengift) und Tetanolysin (Hämolysin).
Krankheitsbilder: Wundstarrkrampf (Tetanus) (von τετανος (griech.): Krampf).
Pathogenese: Das für die Krankheitserscheinungen ursächliche Toxin, das Tetanospasmin, wird entlang von Nervenbahnen oder über das Blut zur grauen Substanz des Rückenmarks transportiert. Dort spaltet es das Synaptobrevin (VAMP), welches an der Ausschüttung von Neurotransmittern beteiligt ist. Hierdurch werden inhibitorische Synapsen an Motoneuronen blockiert, wodurch das Nervensystem nicht mehr hemmend auf den betroffenen Muskel einwirken kann.
Klinik: Klinische Krankheitszeichen beginnen mit Kopfschmerzen und gesteigerter Reflexauslösbarkeit, die Krämpfe nehmen häufig an Kau- und Schlundmuskulatur ihren Ausgang. Schrittweise folgt die Ausbildung des Trismus (Kieferklemme durch Tonuserhöhung der Kaumuskulatur) und des Risus sardonicus (Teufelsgrinsen, bewirkt durch die Kontraktion der mimischen Muskulatur). Im Endstadium treten generalisierte und äußerst schmerzhafte Krampfanfälle, die den Kranken in überstreckter Rückenlage nur noch auf Kopf und Fersen ruhen lässt (Opisthotonus) mit typischer Stellung der Arme. Die Letalität liegt trotz Intensivtherapie bei 10 bis 20%.

Epidemiologie: In Deutschland erkranken 10 bis 15 Menschen pro Jahr. Nach Schätzungen der WHO sterben weltweit pro Jahr über eine Million Menschen am Tetanus.
Diagnostik: Die Diagnose wird v.a. klinisch gestellt.
Therapie: Isolierung in einem schallisolierten dunklen Raum, Sedierung, Muskelrelaxantien, hochkalorische parenterale Ernährung und Volumentherapie, chirurgische Herdsanierung, frühzeitige Antitoxingabe, Antibiose (Penicillin G, Metronidazol), Intubation und Beatmung.
Prophylaxe: Aktive Immunisierung, bei Exposition und unklarem Impfstatus kombinierte Aktiv-Passiv-Impfung.
Weblinks: RKI - Tetanus
Clostridium botulinum
| Clostridium botulinum | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Clostridium botulinum bildet das Botulinumtoxin und löst die Krankheit Botulismus aus.
Morphologie und Eigenschaften: C. botulinum ist ein grampositives, obligat anaerobes und sporenbildendes Stäbchenbakterium.
Vorkommen: Das Bakterium kann sich unter Sauerstoffabschluss, z.B. in geschlossenen Konserven oder im Zentrum von großvolumigen Lebensmitteln, wie z.B. Rohschinken, wenn das Lebensmittel nicht gekühlt wird, vermehren und Toxine bilden, die eine Lebensmittelintoxikation auslösen können (Lebensmittelbotulismus). Eine sehr seltene Form des Botulismus ist der sogenannte Wundbotulismus. Dabei wird eine Wunde mit Sporen von C. botulinum kontaminiert. In der anaeroben Wundumgebung können diese in die vegetative Form übergehen und Toxine bilden.
Virulenzfaktoren: Das Bakterium produziert sieben verschiedene Toxine, wovon 5 humantoxisch sind. Botulinustoxine (Botox) sind die stärksten bekannten Gifte mit LD50-Werten um die 0,1-1ng/kg.
Das präformierte, hitzelabile Toxin gelangt nach Ingestion über den Blutweg an die motorische Endplatte (und die vegetativen Ganglien) und wird durch rezeptorvermittelte Endozytose in die Nervenzelle aufgenommen. Toxinwirkung: Die Verschmelzung des ACh-Vesikels mit der Membran erfordert verschiedene Proteine (Synaptobrevin, Syntaxin, SNAP-25), die durch Botulinumtoxin gespalten werden. Die ACh-Freisetzung kommt dadurch zum Erliegen.
Die Sporen sind meist harmlos, da sie sich im Darm wegen der übrigen anaeroben Flora nicht ausbreiten können. Ausnahme ist der Säuglingsbotulismus (Honig).
Krankheitsbilder: Der Botulismus ist gekennzeichnet durch zunehmende schlaffe Lähmungen (Frühsymtom Doppelbilder) und anticholinerge Symptome (Mundtrockenheit, Schwindel, Mydriasis, Obstipation).
C. botulinum kann sich anders als bei Erwachsenen im Darm von Säuglingen auch vermehren und zum tödlichen Säuglingsbotulismus führen. Säuglinge im ersten Lebensjahr sollten daher keinesfalls Bienenhonig erhalten, da dieser nicht selten mit C. botulinum belastet ist. Erstes Symptom ist eine hartnäckige Verstopfung.
Diagnostik: Die Diagnose wird primär klinisch gestellt.
Therapie: Trivalentes Antitoxin vom Pferd (gegen A, B, E), Intensivtherapie, Antibiotika nutzlos (präformiertes Toxin)! Die Erkrankung ist meldepflichtig!
Weblinks: RKI - Botulismus
Clostridium perfringens (C. septicum, C. histolyticum)
| Clostridium perfringens | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
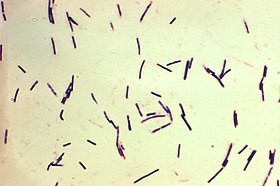 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|

Clostridium perfringens, C. septicum, C. histolyticum und C. novyi sind die wichtigsten Erreger des Gasbrandes.
Morphologie und Eigenschaften: Clostridium perfringens ist ein stäbchenförmiges, grampositives, sporenbildendes Bakterium. Das Tierchen ist ein strikter Anaerobier, der das kurzzeitige Aussetzen in sauerstoffreicher Atmosphäre problemlos überlebt. Auf Blutagar macht C. perfringens eine Doppelhämolyse (durch die zwei unterschiedlich schnell wandernden Bakterientoxine α-Toxin (eine Phospholipase C) und τ-Toxin = Perfringolysin O, ein Thiol-aktiviertes Zytolysin). In Flüssigkultur beobachtet man eine starke Gasbildung. Histologisch findet sich eine Kolliquationsnekrose mit dem typischen Fehlen von Entzündungszellen, da sie durch das Toxin sofort abgetötet werden.
Vorkommen: Der Organismus kann im Boden (anaerobe Zonen), in Wasser, Staub und Lebensmitteln, aber auch im Darm von Mensch (zu 90 %) und Tier nachgewiesen werden (1000-10.000 Keime/g Fäzes). Im Boden zählen Clostridien zu den wichtigsten anaerob Cellulose-abbauenden Mikroorganismen. Das Temperaturoptimum von C. perfringens liegt bei ca. 43 bis 47°C (mit Generationszeiten von 8 bis 12min) mit Extrembereichen zwischen minimal 10 bis 18°C und maximal 50 bis 52°C. Die Sporen können, abhängig von diversen Umweltfaktoren, Temperaturen von 60°C überleben. Die Hitzeresistenz ist je nach Stamm sehr variabel und kann bei 100°C bis zu 60 Minuten betragen. Das Toxin ist hitzelabil (4min bei 60°C). Als D-Wert werden 15 bis 145min bei 90°C und 0,31 bis 38min bei 100°C angegeben.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- C. perfringens bildet für den Menschen pathogene Exotoxine (Enterotoxine) der Serotypen A, B, C, D und E. Gasbrandbazillen bilden mindestens 12 verschiedene Toxine, die als Proteasen, Kollagenasen, Desoxyribonukleasen und Phospholipasen wirken. Die Enzyme bauen entsprechend Gewebe ab und führen zu liquiden Nekrosen im betroffenen Gewebe. Serotyp C verursacht die sogenannte Enteritis necroticans (Darmbrand).
- Polysaccharidkapsel
Krankheitsbilder: Der Gasbrand entsteht bevorzugt in sauerstoffarmem Mileu, z.B. in stark traumatisierten Wunden mit zerfetzten Wundrändern, Quetschwunden, Bisswunden u.ä.. Charakteristisch sind ein fühlbares Knistern unter der Haut, eine ödematös geschwollene, dunkelrot bis livide verfärbte, sezernierende Wunde bzw. Extremität und eine rasche Zustandsverschlechterung des Patienten.
Weitere Erkrankungen sind die Enteritis necroticans und Nahrungsmittelvergiftungen.
Epidemiologie: In Deutschland gibt es etwa 100 Gasbrandfälle pro Jahr.
Diagnostik: Klinische Diagnose!
Therapie: Die großzügige chirurgische Eröffnung und Reinigung der Wunde zur Verbesserung des Sauerstoffeintritts ist die wichtigste Massnahme, nachfolgend offene Wundbehandlung, Antibiose (Penicillin G, evtl. plus Clindamycin, alternativ Tetrazykline, Carbapeneme), polyvalentes Antiserum, Schocktherapie. Die Prognose ist ungünstig.
Nahrungsmittelvergiftungen sind selbstlimitierend, eine Antibiose ist nicht notwendig.
Prophylaxe: Adäquate Wundtherapie, perioperative Antibiotikaprophylaxe („single shot“).
Clostridium difficile
| Clostridium difficile | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|

Morphologie und Eigenschaften: Clostridium difficile ist ein anaerobes, grampositives und sporenbildendes Stäbchenbakterium.
Vorkommen: Die Sporen von Clostridien kommen überall auf der Erde im Boden, in Schmutz oder Staub vor. 1 bis 4 % der gesunden erwachsenen Bevölkerung tragen C. difficile unbemerkt im Darm, aber 15 bis 25 % der Erwachsenen, die mit Antibiotika behandelt werden und 25 bis 60 % der Kleinkinder. Letztere erkranken allerdings trotzdem selten, da die Toxinrezeptoren euf den Enterozyten noch unzureichend ausgebildet sind.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren: Enterotoxin TcdA (Endotoxin A) und Zytotoxin TcdB (Endotoxin B -> Mikrofilamentdepolymerisation) führen zur Zerstörung der Darmzellen. Als weiterer Virulenzfaktor konnte das binäre Toxin CDTA/B, eine ADP-Ribosyltransferase identifiziert werden.
Besonders der neue und aggressive Stamm PCR-Ribotyp 027 bildet alle 3 Toxine (Toxinotyp III) und diese in hohen Mengen, was man mit einer 18-bp-Deletion im Gen tcdC in Verbindung bringt, das den negativen Regulator TcdC kodiert.[1]
Krankheitsbilder: Antibiotika-assoziierte Colitis und Antibiotika-assoziierte pseudomembranöse Colitis, zusammengefasst als Clostridium difficile assoziierte Durchfallerkrankungen (CDAD). Durch die Beeinträchtigung der normalen Darmflora unter Antibiotikatherapie kann C. difficile einen Wachstumsvorteil gewinnen und zur Erkrankung führen.
Seit dem Jahre 2000 beobachtet man in den USA und Kanada kleinere CDAD-Epidemien mit einer Zunahme der Inzidenz um das 5-20-fache und einer 3- bis 5-fach erhöhten Letalität von 14 bis 22 % durch den PCR-Ribotyp 027. Auch in Europa wurde Ribotyp 027 schon mehrfach gesichtet. In Deutschland nimmt die Zahl der Fälle von CDAD stark zu.[1][2]
Klinik: Das typische Krankheitsbild der C. difficile-Infektion ist die Colitis mit Diarrhoe, Fieber und Bauchkrämpfen mit meist mildem bis mittelschweren Krankheitsverlauf. Der schwere Verlauf bildet die sog. pseudomembranöse Colitis. Dabei kommt es zu einer Ausschwitzung von Fibrin aus der entzündeten Darmwand, das sich zusammen mit Granulozyten und zerstörten Darmzellen zu einer weissen Schicht auf der Darmwand verbindet. Komplikationen sind das toxische Megacolon, die Darmperforation und die Sepsis.
Diagnostik: Kultur auf Selektivmedium, Toxinnachweis (EIA) im Stuhl, Coloskopie
Therapie: Volumentherapie und Elektrolytausgleich, Absetzen der laufenden Antibiose. Clostridien-Antibiose: keine oder Metronidazol, Vancomycin oral oder Fidaxomicin. Aufbau einer normalen Darmflora z.B. mit Saccharomyces-Präparaten oder einer Stuhltransplantation von einem gesunden Spender.
Literatur und Weblinks:
- RKI - Informationen zu Clostridium difficile
- CDC - Clostridium Difficile Infections
- Clostridium difficile Support (UK)
- Mylonakis E et al. “Clostridium difficile--Associated diarrhea: A review”. Arch Intern Med, 161(4):525-33, Feb 26 2001. PMID:11252111
Propionibacterium spp.
Propionibakterien wie P. acnes, P. avidum und P. granulosum sind obligat anaerobe, Gram-positive Stäbchen und Teil der Normalflora. Unter Umständen können sie eine pathogene Rolle bei schweren Formen der Akne und Fremdkörper-assoziierten Infektionen spielen.
Therapie: Tetrazykline und Makrolide, ferner eignen sich Cotrimoxazol und Vancomycin. Gegen Metronidazol sind Propionibakterien resistent.
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 RKI - Epidemiologisches Bulletin Nr. 36, 8. Sep 2006
- ↑ CDC. “Clostridium difficile in Discharged Inpatients, Germany”. Emerging Infectious Diseases, 13(1), Jan 2007.
Gramnegative Kokken
Anaerobe Gram-negative Kokken
Veillonella parvula
Veillonella parvula sind anaerobe, Gram-negative Kokken, die zur Normalflora der Schleimhäute gehören.
Krankheitsbilder: Die Anaerobier können an Infektionen im Mund-Kiefer- und Genital-Becken-Bereich beteiligt sein.
Diagnostik: Prolongierte anaerobe Kultur.
Therapie: Clindamycin, Alternativen sind Metronidazol und Penicillin G.
Aerobe Gram-negative Kokken
Neisseria gonorrhoeae (Gonokokken)
| Neisseria gonorrhoeae. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Neisseria gonorrhoeae (syn. Gonokokken) sind Gram-negative, Semmel- oder Kaffeebohnenförmige, unbewegliche, strikt aerobe, Katalase- und Oxidase-positive Diplokokken. Sie sind gegenüber Umwelteinflüssen, insbesondere gegen Austrocknung sehr empfindlich. Im Gegensatz zu Neisseria meningitidis fehlt ihnen eine echte Kapsel. Die Membran der Gonokokken enthält jedoch sog. Lipooligosaccharide (LOS), von denen bestimmte Unterformen Sialinsäure binden können und damit eine kapselartige Struktur aufbauen, die die Antigenität, Serumresistenz und das extrazelluläre Überleben im Wirt ermöglicht. Auf Kochblut bilden Neisserien weißliche Kolonien.
Epidemiologie: Gonokokken sind weltweit verbreitet. Erregerreservoir ist ausschließlich der Mensch, der Infektionsgipfel liegt im jungen Erwachsenenalter. Die Inzidenz beträgt etwa 10/100.000, da die Infektion jedoch vor allem bei Frauen asymptomatisch bzw. uncharakteristisch verlaufen kann, muß von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. In Ländern mit schlechter Gesundheitsversorgung findet sich eine hohe Infektionsrate, weltweit wird von 25 Millionen Erkrankungen ausgegangen. Die Gonorrhoe ist neben der Infektion durch Chlamydia trachomatis die weltweit häufigste Geschlechtskrankheit.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Lipoligosaccharide (LOS) auf der Bakterienoberfläche wirken schädigend auf die Epithelzelle, bedingen die Antigentät und bilden durch Bindung von Sialinsäure kapselartige Strukturen, die die Komplementwirkung hemmen. Im einzelnen bindet Sialinsäure (N-Acetyl-Neuraminsäure) Protein H, degradiert C3b und entgeht dadurch dem Tod durch den Komplement-MAK.
- Gonokokken besitzen außerdem aus dem sog. Pillin aufgebaute Pili für das Attachement an das Schleimhautepithel. Die Pili sind ebenfalls Antigen-variabel.
- Antigene Variation (Antigen-Shift) - Der direkte Kontakt mit den Wirtszellen erfolgt über sog. OPA-Proteine (OPA = opacity, da sie die Kolonien trübe erscheinen lassen). Gonokokken besitzen verschiedene OPA-Proteine im Genom, die meist nicht gleichzeitig exprimiert werden. Der Typ an exprimiertem OPA-Protein ist für den Organotropismus des Keimes ursächlich. Diese binden an CD66, Heparansulfat-Proteoglykan-Rezeptoren und CGM1 auf Fibroblasten, Epithelzellen und Makrophagen. Außerdem induzieren die OPA-Proteine die Phagozytose. Jedes OPA-Gen hat mehrere sich wiederholende Sequenzen (repeats) aus 5 Nucleotiden. Diese werden regelmäßig herausgeschnitten oder dupliziert, wodurch sich der reading-frame ändert und neue Varianten der OPA-Proteine entstehen. Stop-Codons entscheiden darüber, ob das Opaque-Antigen exprimiert wird oder nicht. Diesen Mechanismus nennt man Antigen-Shift, und er ist bei Neisserien sehr ausgeprägt.


- Da für Gonokokken die Eisenzufuhr essentiell ist, finden sich auf ihrer Oberfläche Transporter für Transferrin und Lactoferrin.
- Außerdem bilden Gonokokken eine sog. IgA1-Protease, welche sekretorische IgA-Antikörper spaltet.
- Gonokokken-Stämme bilden z.T. Penicillinase, meist Plasmid-kodiert.
Krankheitsbilder:
- Gonorrhoe (syn. Tripper): Die Gonorrhoe verläuft beim Mann meist als schmerzhafte und eitrige Urethritis. Steigt die Erkrankung auf, so kann es zur gonorrhoischen Prostatitis und Epididymitis kommen. Die Symptome können nach Wochen wieder verschwinden. In 10% bleibt die Infektion beim Mann asymptomatisch. Bei Frauen verläuft der Großteil der Infektionen ohne wesentliche Symptome. Bei den übrigen Patientinnen finden sich Ausfluss (Endozervizitis), schmerzhafte Miktionen und eitrige Sekretionen aus der Urethra. Steigt die Infektion auf, so können sich Endometritis, Adnexitis mit Sterilität, Tuboovarialabszesse und eine sog. pelvic inflammatory disease (PID) bzw. Peritonitis entwickeln. Außerdem kann es zur Infektion der Frucht und der Fruchtblase kommen (Chorionamnionitis) mit dem Risiko eines Abortes. Häufig liegen Koinfektionen vor z.B. mit C. trachomatis, Ureaplasmen, Mykoplasmen, Lues, Hiv oder H. ducreyi.

- Gonoblennorrhoe: Die eitrige Keratokonjunktivitis des Neugeborenen entsteht durch die perinatale Infektion unter der Geburt mit der Gefahr der Perforation und Erblindung. Daher wird seit dem 19. Jahrhundert die sog. Credé-Prophylaxe mit Silbernitrat bzw. heutzutage Erythromycin durchgeführt.
- Außerdem können Gonokokken die Konjunktiven, den Pharynx und den Mastdarm infizieren.
- Disseminierte Gonokokkeninfektionen sind möglich, z.B. Hautexantheme, eitrige Arthritis, selten Endokarditis, Pneumonie oder Meningitis.
Infektionsweg: Sexuell. Neugeborene infizieren sich unter der Geburt.
Inkubationszeit: Die Inkubationszeit beträgt beim Mann zwischen zwei und fünf Tagen, bei der Frau bis zu drei Wochen.
Pathogenese: Gonokokken heften sich über Pili an die Schleimhautzellen der Harnröhre bzw. des Cervix uteri an. Einige Gonokokken induzieren durch die Opa-Proteine eine Endozytose an Schleimhautzellen und werden auf der Lumen-abgewandten Seite wieder ausgeworfen (Transzytose). Die Erreger werden von Granulozyten phagozytiert und können meist auch abgetötet werden. Nur ein Teil der Bakterien überlebt intrazellulär. Die Gewebsschädigung erfolgt durch Induktion einer eitrigen Entzündung und Komplementaktivierung und dadurch bedingter Zerstörung des befallenen Epithels. Dabei scheint v.a. das Lipooligosaccharid der Bakterienzellwand eine Rolle zu spielen.
Diagnostik: Der Nachweis einer Gonokokkeninfektion wird meist mikroskopisch gestellt. Zur Sicherung der Diagnose erfolgt eine Erreger-Anzucht auf Selektivnährböden, z.B. Thayer-Martin-Medium. Da die Erreger sehr empfindlich gegen Austrocknen sind, müssen die Kulturmedien unmittelbar beimpft werden. Bei Frauen kann die Mikroskopie eines Cervix-Abstrichs negativ ausfallen, da sich die Erreger tief in den Krypten aufhalten können.
Therapie:
- Die Therapie erfolgt wegen Penicillin/Tetrazyklin-Resistenzen mit Fluorchinolonen bzw. Cephalosporinen parenteral 3a oder oral 2. Generation.
- Koinfektionen müssen mitbehandelt werden. Bei Chlamydien wird zusätzlich Doxycyclin eingesetzt.
- Wichtig ist die Mitbehandlung des Partners, um Kreuzinfektionen auszuschließen (Ping-Pong-Effekt).
Eine Meldepflicht besteht nicht.
Prophylaxe: Ein Impfstoff ist wegen der hohen Variabilität der Opa- und Pillin-Proteine nicht verfügbar. Credéprophylaxe mit Erythromycin bei allen Neugeborenen.
Historisches: Albert Neisser entdeckte die Gonokokken im Jahre 1879 im Urethralabstrich eines Patienten. Carl Siegmund Franz Credé führte 1881 die nach ihm benannte Credé-Prophylaxe ein. Ernst Bumm gelang 1885 erstmals die Anzucht von Gonokokken.
Weblinks: RKI - Gonorrhoe
Neisseria meningitidis (Meningokokken)
| Neisseria meningitidis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||
|

Morphologie und Eigenschaften: Meningokokken (Neisseria meningitidis) sind wie Gonokokken auch Gram-negative, Semmel- oder Kaffeebohnenförmige, unbewegliche, strikt aerobe, Katalase- und Oxidase-positive Diplokokken. Zusätzlich tragen sie eine Kapsel. Auf Kochblut bilden Neisserien weißliche Kolonien.
Epidemiologie: Etwa 10% der europäischen Bevölkerung tragen die Bakterien asymptomatisch im Nasenrachenraum. In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 700 bis 800 Menschen. Einige Fälle werden von Reisenden aus dem europäischen Ausland eingeschleppt. 40% aller Patienten sind Kinder unter vier Jahren, mit Abstand am häufigsten sind Säuglinge im ersten Lebensjahr betroffen. Auch heute noch sterben etwa 10% der Patienten.
Aufgrund des Kapsel-Oligosaccharidmusters werden 13 verschiedene Typen unterschieden, von denen nur 5 humanpathogen sind: Typ A, B, C, W135 und Y. In Deutschland werden etwa 70% der Erkrankungsfälle durch den Serotyp B verursacht, auf Typ C entfallen 20 bis 25%. Der in Deutschland vorherrschende Typ B besitzt eine identische Struktur wie das neurale Zelladhäsionsmolekül N-CAM (Kreuzantigenität), daher gibt es gegen diesen Serotyp keinen Impfstoff. In Entwicklungsländern herrscht Typ A vor.
Impfstoffe gibt es gegen den Typ C, der beispielsweise in England, Spanien oder auch in einigen Regionen Deutschlands gehäuft auftritt, und gegen die Typen A, Y und W135. Von Dezember bis Juni kommen Meningokokken-Epidemien verstärkt im afrikanischen "Meningitisgürtel" südlich der Sahara vom Sudan bis nach Gambia vor. Von November bis Mai treten sie auch gehäuft in Indien, vor allem Nordindien, und Nepal auf. Grundsätzlich kann jedes Land mit schwierigen Hygiene-Verhältnissen als mögliches Meningitis-Gebiet angesehen werden. Hier werden im Allgemeinen Erkrankungen mit Gruppe A oder C gesehen.
Übertragung: Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch. Die Meningokokken heften sich mit Hilfe ihrer Pili an die Mucosa des Nasenrachenraumes, wo sie wochen- oder monatelang verbleiben können.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Ähnlich wie bei Gonokokken:
- Pili
- LOS
- OPA-Proteine
- IgA-Protease
- Zusätzlich besitzen Meningokokken eine Kapsel, von denen die 5 Kapseltypen A, B, C, W135 und Y humanpathogen sind.
- Der Kapseltyp B besitzt eine identische Struktur wie N-CAM (cell adhesion molecule) -> „molecular mimicry“, Immuntoleranz, keine Impfung möglich.
Krankheitsbilder: Das Spektrum der Erkrankung reicht von leichten Verläufen mit spontaner Abheilung bis hin zu einem hochakuten Ausbruch, der trotz Behandlung in wenigen Stunden zum Tod führt. Die Meningitis beginnt mit starkem Krankheitsgefühl wie Abgeschlagenheit, hohem Fieber, Erbrechen, Schüttelfrost, Gelenk- und Muskelschmerzen, Krämpfen oder Bewusstseinsstörungen. Unscheinbare petechiale Blutungen können in der Frühphase wegweisend sein und sollten keinesfalls übersehen werden. Als typisches Zeichen einer schweren Hirnhautentzündung tritt die Nackensteifigkeit auf, die sich im Extremfall zum "Kissenbohren" auswächst: Wenn der Patient liegt, zeigt sich ein überstrecktes Hohlkreuz und der Kopf drückt sich in das Kissen. Bei Säuglingen kann neben dem fast immer auftretenden Fieber die Symptomatik zunächst sehr unspezifisch sein: Apathie oder Unruhe, Nahrungsverweigerung und Berührungsempfindlichkeit. Trotz Behandlung drohen Komplikationen und Spätfolgen wie Hörverlust oder Krampfleiden, jeder zehnte Patient stirbt.
Neben der Mengitis können eine Meningokokkensepis oder ein Waterhouse-Friderichsen-Syndrom (massive subkutane und innere Blutungen sowie Nekrosen) einen oft tödlichen Krankheitsverlauf herbeiführen.
Diagnostik: Klinische Diagnose: Meningismus (Photophobie, Kopfschmerzen, Übelkeit, Nackensteifigkeit), petechiale Blutungen u.a. Mit folgenden einfachen Tests läßt sich ein Meningismus nachweisen (Prinzip: Zug an den entzündeten Hirnrückenmarkshäuten löst Schmerzen aus.):
- Brudzinski-Zeichen: Ein Beugen des Kopfes führt zum reflektorischen Beugen/Anziehen der Knie.
- Kernig-Zeichen: Die Beugung im Hüftgelenk bei gestreckten Knien führt zum Anziehen der Knie.
- Laségue-Zeichen: Die Beugung im Hüftgelenk auf 70 bis 80° bei gestreckten Knien ist wegen Schmerzen nicht möglich.
Diagnostische Liquorpunktion zum Erregernachweis (nach Ausschluss Hirndruck), zusätzlich bei Meningitis immer Blutkultur und Rachenabstrich! Da Neisserien empfindlich sind, sollten sie rasch untersucht werden (Warmtransport).
Therapie:
- Die Meningitis ist ein infektiologischer Notfall. Daher sollte frühstmöglich eine kalkulierte Antibiotikatherapie mit parenteralen Cephalosporinen 3a, alternativ mit Flourchinolonen begonnen werden, auch wenn dadurch ein Erregernachweis unmöglich wird. Die diagnostische Liquorpunktion (nach cCT zum Hirndruckausschluss!) hat in diesem Fall die geringere Priorität. Bei sensiblen Meningokokken kann Penicillin G eingesetzt werden, allerdings nehmen hier die Resistenzen zu.
- Isolierung: Krankheitsverdächtige und Erkrankte müssen bis 24h nach Einleitung einer wirksamen Therapie isoliert werden. Kontaktpersonen ist eine Chemoprophylaxe zu empfehlen (Rifampicin, alternativ: Ciprofloxazin, Ceftriaxon).
Prophylaxe:
Es stehen drei aktive Impfstoffe zur Verfügung. Sie enthalten im Wesentlichen gereinigte Saccharidbruchstücke von Neisseria meningitidis. Der Polysaccharid-Impfstoff richtet sich gegen die Gruppen A und C (AC-Impfstoff), ein weiterer gegen die Gruppen A, C, W 135 und Y (ACWY-Impfstoff, beide schützen am besten ab einem Alter von zwei Jahren. Mit den neuen Konjugat-Impfstoffen können auch Kinder ab einem Alter von zwei Monaten gegen Meningokokken C geschützt werden. Beide Polysaccharid-Impfstoffe werden unter die Haut gespritzt. Der Impfschutz hält mindestens drei Jahre. Für Erwachsene und Kinder genügt eine einmalige Injektion. Der AC-Impfstoff kann ab einem Alter von 18 Monaten eingesetzt werden. Der ACWY-Impfstoff ist ab zwei Jahren wirksam. Bei jüngeren Kindern ist ein Schutz gegen die Gruppen C, W 135 und Y nicht gesichert und der Impfschutz hält höchstens zwei Jahre an. Um einen besseren Impfschutz zu erreichen, können Kinder unter zwei Jahren im Abstand von drei Monaten auch ein zweites Mal geimpft werden. Die Schutzwirkung der Impfung setzt etwa nach zwei Wochen ein. Bei bestehendem Infektionsrisiko ist nach drei Jahren eine Auffrischimpfung ratsam. Speziell für Kinder im Alter zwischen zwei Monaten und zwei Jahren sind C-Konjugat-Impfstoffe entwickelt worden. Sie können bei Bedarf aber auch bei älteren Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen eingesetzt werden. Sie schützen vor Infektionen des Meningokokken-Typs C, der in Deutschland etwa jede fünfte Erkrankung verursacht. Die Impfung mit dem Konjugatimpfstoff kann bei Bedarf ab dem dritten Lebensjahr mit einem Polysaccharidimpfstoff ergänzt werden. Die Meningokokken-Impfung kann meistens gleichzeitig mit anderen Schutzimpfungen vorgenommen werden. Zeitabstände zu anderen Impfungen sind nicht einzuhalten. Die Impfung wird allen Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko empfohlen. Besonders gefährdet sind zum Beispiel Personen mit Immundefekten oder fehlender beziehungsweise funktionsuntüchtiger Milz. Auch Reisende in Gebiete, in denen Meningokokken-Infektionen häufig auftreten, tragen ein erhöhtes Infektionsrisiko, wenn sie sich dort länger aufhalten oder engen Kontakt zur Bevölkerung haben. Schüler und Studenten mit einem längeren Aufenthalt in Ländern wie England, Irland oder Spanien, in denen die Impfung gegen Meningokokken C allgemein oder gezielt für diese Altersgruppe empfohlen wird, sollten ebenfalls geimpft werden. Im Bundesland Sachsen gelten nach der dortigen Impfkommission (SIKO) ab Juli 2003 zusätzliche Empfehlungen für die Impfung mit konjugierten Meningokokken-C-Impfstoffen, danach sollten folgende Personengruppen geimpft werden:
- Alle Kinder ab dem 3. Lebensmonat und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Kosten werden zurzeit nicht von den Krankenkassen übernommen)
- Enge Kontaktpersonen zu einem Kranken mit invasiver Meningokokken-C- Infektion, parallel zur Chemoprophylaxe mit Antibiotika.
Saudi-Arabien verlangt während der Mekka-Wallfahrten von Pilgern und Besuchern eine Impfbescheinigung, die maximal drei Jahre und minimal zehn Tage vor dem Eintreffen in Saudi-Arabien ausgestellt worden sein darf. Pflicht ist der Vierfach-Impfstoff A,C,W135,Y. Pilger, die aus Endemiegebieten einreisen, werden untersucht und bei Verdacht auf Meningitis beobachtet. Alle anderen Reisenden müssen nicht geimpft sein. Hinweis: Nur gegen die jeweils genannten Serogruppen wird ein Schutz aufgebaut. Die Impfungen bieten keinen Schutz gegen die in Mitteleuropa und Brasilien häufiger vorkommende Meningitis durch Meningokokken der Gruppe B.
Weblinks: RKI - Meningokokken-Erkrankungen
Moraxella catarrhalis
| Moraxella catarrhalis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | |||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Moraxella catarrhalis sind Gram-negative, aerobe, Oxidase-positive Diplokokken.
Vorkommen: Die Bakterien kommen als Kolonisationskeime vor allem im Kleinkindalter vor.
Krankheitsbilder: Respiratorische Infekte Bronchitis, Sinusitis, Otitis media, Laryngitis und bei vorbestehehender Lungenerkrankung Bronchopneumonien.
Therapie: "watchful waiting", die Erreger sind häufig β-Lactamase-positiv, sprechen aber i.d.R. auf Amoxicillin plus βLI, Makrolide und Cotrimoxazol an.
Gramnegative Stäbchen
Ernährungstechnisch anspruchsvolle Gram-negative Stäbchen
Bordetella pertussis
| Bordetella pertussis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Bordetella pertussis ist der Erreger des Keuchhustens (Pertussis)
Morphologie und Eigenschaften: Bordetella pertussis ist ein kleines (ca. 0,8 x 0,4µm), kokkoides, unbewegliches, bekapseltes, Gram-negatives Stäbchen. Die Bakterien erscheinen im mikroskopischen Präparat einzeln oder paarweise gelagert. Kolonien von B. pertussis sind klein, glatt und glänzend mit einer hohen Konvexität (wie eine Quecksilberperle). Der Keim kann auf Spezialmedien innerhalb von 3 bis 4 Tagen bei 37°C in einer aeroben Atmosphäre kultiviert werden. Er wächst mit β-Hämolyse und läßt sich morphologisch nur schwer von anderen Bordetellen wie B. parapertussis und B. bronchiseptica unterscheiden.
Vorkommen: Alleiniges Habitat von B. pertussis sind die zilientragenden Epithelzellen des menschlichen Respirationstraktes.
Übertragung: Das hochkontagiöse Bakterium wird aerogen via Tröpfcheninfektion übertragen bes. im Stadium catarrhale. Der Kontagionsindex beträgt zwischen 0,8 und 1,0, das heißt, dass 80-100 % der Menschen welche mit dem Erreger in Kontakt kommen, auch erkranken. Darüberhinaus kann eine Übertragung über kontaminierte Gegenstände nicht ausgeschlossen werden, da das Pertussis-Bakterium für einige Tage außerhalb des Organismus überleben kann.
Epidemiologie: Trotz wirksamer Impfstoffe erkranken weltweit etwa 20 bis 40 Millionen Menschen an Keuchhusten, Todesfälle - meist bei Säuglingen unter 6 Monaten - sind etwa 200.000 bis 300.000 zu verzeichnen. Wegen des hohen Kontagionsindex bei nicht-immunen Menschen kann sich B. pertussis in Bevölkerungen mit niederiger Durchseuchungsrate epidemisch ausbreiten. In Regionen mit hoher Impfrate bleibt der Pertussis-Erreger endemisch, da der Immunitätsnachlaß eine Besiedelung erlaubt. Geschlecht, Jahreszeit und Klima spielen bei der Morbidität keine Rolle.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Adhärenzfaktoren - Die zwei wichtigsten Adhärenzfaktoren sind das Filamenthämagglutinin (FHA) und das Pertussistoxin (PT), das sowohl als Exotoxin als auch als Adhäsin funktionieren kann. Daneben besitzt B. pertussis verschiedene antigenetisch unterschiedliche Fimbrien, die für die weitere Stabilisierung der Anheftung an die Epithelzellen des oberen Respirationstraktes verantwortlich sind. Darüber besitzt das Bakterium an der äußeren Membran die Membranproteine Pertactin und BrkA (Bordetella resistance to killing), die zur Bindung an die Wirtszellen beitragen.
- Exotoxine - Von entscheidender Bedeutung für die Pathogenese des Keuchhustens ist das Pertussistoxin (PT), das aus sechs Untereinheiten (Hexamer) aufgebaut ist und Verwandtschaft zu anderen Toxinen des AB-Typs wie dem Choleratoxin, Shigatoxin und Diphtherietoxin aufweist. Die eigentlich toxische Komponente ist das Monomer A, das von fünf anderen Untereinheiten, die zusammen das Oligomer B bilden, stabilisiert wird. Das Monomer A ist eine ADP-Ribosyltransferase, die G-Proteine modifiziert und eine veränderte Signaltransduktion innerhalb der Epithelzelle auslöst. Das PT sensibilisiert darüber hinaus den Körper für Histamin, sorgt für verstärkte Leukozytenaktivierung und erhöht die Insulinsekretion. Ein weiteres Protein, die invasive Adenylatcyclase (CyaA), kann in die Wirtszelle (Phagozyten) eindringen um dort zu einem unphysiologisch hohen cAMP-Spiegel zu führen.
- Endotoxine - Das aus dem Peptidoglykan der Zellwand gebildete Tracheale Cytotoxin (TCT) führt zur Stase der Zilienbewegung. In der äußeren Membran der Bakterien befinden sich Lipooligosaccharide, die chemisch und in ihrer Wirkung auf den Wirt den Lipopolysacchariden anderer gramnegativer Erreger ähnlich sind. Auch wenn sie bei der natürlichen Infektion keine Rolle zu haben scheinen, sind sie doch möglicherweise für einen Teil der unerwünschten Nebenwirkungen der zellulären Vakzine (Vollkeimimpfstoffe) verantwortlich.
- Die Kapsel bietet dem Erreger Schutz vor Inaktivierung durch das Komplementsystem.

Pathogenese: B. pertussis überwindet die lokalen Immunmechanismen des oberen Respirationstraktes und kann bei völliger Gesundheit des Wirts ohne prädisponierende Faktoren eine Krankheit auslösen (hohe Pathogenität). Mittels verschiedener Adhäsine binden sich die Bakterien sehr fest an die Zellen des Flimmerepithels und können dann durch die Freisetzung von Toxinen die Erkrankung Keuchhusten (Pertussis) auslösen. Eine Invasion ins Epithel ist selten, es kommt zu (sub-)epithelialen Entzündungen und Nekrosen. Obwohl die Erreger in der Regel nicht invasiv sind, d.h. nicht in das Gewebe oder die Blutbahn gelangen, treten durch die produzierten Toxine dennoch systemische Effekte auf. Neben der Kapsel, die dem Erreger Schutz vor Inaktivierung durch Komplement bietet, sind Toxine für die Virulenz und Adhäsine für die Pathogenität verantwortlich.
Klinik: Nach einer Inkubationszeit von 1-2 Wochen durchläuft die Krankheit klassischerweise drei Stadien. Wegen der Gesamtdauer des chronischen Hustens spricht man auch vom „100 Tage Husten“:
- Stadium catarrhale mit Schnupfen und untypischem Husten, Dauer 1-2 Wochen, höchste Infektiösität
- Stadium convulsivum mit plötzlich auftretenden staccatoartigen Hustenattacken und typischem Jauchzen beim Wiedereinatmen, die teilweise begleitet werden von Erbrechen oder Ausstoßen von glasigem Schleim, Dauer 2-6 Wochen
- Stadium decrementi mit langsam abnehmenden Hustenattacken, Dauer ca. 3-6 Wochen
Komplikationen: Komplikationen treten bei Kindern im ersten Lebensjahr am häufigsten auf. Dazu gehören Pneumonie (25 % der Komplikationen), Bronchiolitis und Apnoen, die in seltenen Fällen zur Enzephalopathie (durch Hypoxie oder Einblutung) oder zum zum Tod führen können. Weiterhin kann es zu einer Otitis media kommen. Auch Krampfanfälle und durch das starke Husten verursachte Hyposphagma können auftreten.
Diagnostik: Da unter Umständen auch andere Erreger wie Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica, Chlamydia trachomatis und Adenoviren vorübergehend ähnliche Symptome wie Bordetella pertussis verursachen können, kommt der bakteriologisch-serologischen Diagnostik eine entscheidende Rolle zu. Die Diagnostik gestaltet sich schwierig. Direkt beimpfte Spezialnährböden („Hustenplatten“) funktionieren nur eingeschränkt. Serologisch läßt sich mittels ELISA spezifisches IgA nachweisen. Goldstandard ist jedoch zur Zeit die PCR.
Therapie: Die Antibiotikatherapie (Makrolide, alternativ Amoxicillin oder Cotrimoxazol) im Stadium convulsivum ist von fraglichem Nutzen. Der Husten spricht auf Hustenstiller nur schlecht an.
Immunität und Prophylaxe: Nach einer natürlichen Infektion besteht im ersten Jahrzehnt nach der Erkrankung eine tragfähige Immunität. Die wichtigste prophylaktische Maßnahme ist die aktive Immunisierung. Es existierten dafür ein Ganzkeimimpfstoff (zelluläre Vakzine) und verschiedene azelluläre Vakzinen.
- Ganzkeimimpfstoff (whole cell vaccine): aus inaktivierten Bordetella pertussis-Zellen gewonnene Lysate, früher mit mehr Nebenwirkungen behaftet
- Azelluläre Vakzine (subunit vaccines): Gemische von B. pertussis-Komponenten
Die gegenwärtig zugelassenen Präparate beider Kategorien bieten bei vollständig durchgeführtem Immunisierungsschema einen sehr guten Impfschutz, jedoch garantieren weder Impfung noch Erkrankung einen lebenslangen Schutz vor einer Infektion mit B. pertussis. Erwachsene erkranken seltener und weniger schwer als Kinder oder Säuglinge. Impfraten von mehr als 90 % sind anzustreben, um einen Kohortenschutz aufzubauen, der einen maximalen Schutz von Neugeborenen und Kindern in den ersten Lebensmonaten bietet. Die Impfung behindert nicht die Kolonisation (Relativ höhere Durchseuchung in Ländern mit hoher Impfrate).
Forschungsgeschichte: 1906 konnte ein schwer anzüchtbares Bakterium durch die Bakteriologen Jules Bordet und Octave Gengou als Erreger des Keuchhustens erstmals identifiziert werden. Zunächst wurde es als Bordet-Gengou-Bacillus den hämophilen Stäbchenbakterien zugeordnet. Bei der später notwendigen Klassifizierung wurde zu Ehren Jules Bordets die Bezeichnung Bordetella pertussis gewählt. Im Jahr 2002 wurde das Genom des Keuchhustenerregers, das aus insgesamt 3800 Einzelgenen besteht, nach über vierjähriger Forschungsarbeit von einem internationalen Forscherteam an der University of Cambridge entschlüsselt.
Weblinks: RKI - Pertussis
Brucella melitensis
| Brucella melitensis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|
Etymologie: Der Name stammt von dem englischen Militärarzt David Bruce.
Morphologie und Eigenschaften: Brucellen sind kurze, stäbchenförmige, Gramn-egative und aerobe Bakterien.
Vorkommen: Organismen der Zoonose kommen im Urogenitalbereich von Kühen, Schafen, Schweinen u.a. Tieren vor. U.a. deshalb werden Milchprodukte in Deutschland pasteurisiert.
Krankheitsbilder: Brucellen können bei Übertragung auf den Menschen sehr selten eine zyklische Allgemeininfektion auslösen mit Allgemeinsymptomen, undulierendem Fieber und multiplem Organbefall (Knochen und Gelenke, Leber, Orchitis). Die Krankheit wird als Berufskrankheit anerkannt.
- B. m. melitensis (Schaf, Ziege) verursacht das Maltafieber
- B. m. abortus (Rind) ist der Erreger des Morbus Bang
- B. m. suis (Schwein) kann ebenfalls eine Brucellose auslösen
- B. m. ovis, B. m. canis und B. m. neotomae sind für den Menschen ungefährlich

Epidemiologie: In Mittelmeerländern sind Rohmilchprodukte ein Risiko. Ebenfalls gefährdet sind beruflich Exponierte. Der Tierbestand in Deutschland ist zur Zeit Brucellose-frei. Insgesamt ist die Erkrankung selten.
Diagnostik: Anzucht auf komplexen Medien oder in Blutkultur mit verlängerter Bebrütung. Serologischer Nachweis mit Antiseren.
Therapie: Dauertherapie mit Doxycyclin plus Aminoglykosid, alternativ Cotrimoxazol (ggf. plus Aminoglykosid) oder Doxycyclin plus Rifampicin.
Prophylaxe: Pasteurisierung von Milchprodukten, Schutzkleidung in Berufen mit Tierkontakt.
Taxonomie: Früher wurden in der Gattung Brucella zahlreiche Spezies unterschieden. Auf Grund von DNS-Stammbäumen geht man heute von nur einer Spezies Brucella melitensis aus. Die früheren Arten wurden als Biovarietäten von B. mellitensis eingestuft. In der Praxis wird jedoch meist an der alten Arteneinteilung festgehalten.
Weblinks: RKI - Brucellose
Campylobacter sp.
| Campylobacter sp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Campylobacter-Spezies sind Gram-negative, mikroaerophile (Vorliebe für reduzierten Sauerstoffgehalt, 5%) und polar begeißelte sowie Oxidase- und Katalase-positive Stäbchen. Die Differenzierung erfolgt biochemisch und anhand der Antibiotikasensibilität (Nalidixinsäure, Cephalothin).
Krankheitsbilder: Die Erreger C. jejuni (häufigster Erreger) und C. coli können beim Menschen eine entzündliche Durchfallerkrankung (Campylobacter-Enteritis) auslösen. Sie sind die zweithäufigsten Erreger einer solchen Infektion nach Salmonellen. Wichtigste Komplikation ist das Guillain-Barré-Syndrom.
Pathogenese: Die Bakterien der Campylobacter-Gruppe gehören, wie die Shigellen, zu den Erregern, die in die Schleimhäute des Darmes einwandern. Durch Bildung eines hitzeresistenten Enterotoxins werden vermutlich die Durchfallsymptome ausgelöst.
Übertragung: Die Übertragung der Erreger erfolgt vor allem durch Lebensmittel tierischer Herkunft, besonders ungenügend gegartes Geflügelfleisch und nicht pasteurisierte Milch. Darüber hinaus sind die Erreger in den Ausscheidungen gesunder Haustiere zu finden und können häufig in Oberflächengewässern nachgewiesen werden. Da sich Campylobacter in rohem Fleisch vermehren stellen sie eine Gefahr beim Grillen dar.
Epidemiologie: In den Industrie- und Entwicklungsländern werden 5 bis 10% der Durchfallerkrankungen durch Campylobacter hervorgerufen (z.B. USA schätzungsweise 2 Mio. Campylobacter-Infektionen pro Jahr).
Therapie: Erythromycin, alternativ Chinolone, es gibt Multiresistenzen
Weblinks: RKI - Campylobacter-Infektionen
Helicobacter pylori
| Helicobacter | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Helicobacter pylori ist ein Gram-negatives, schraubenförmiges, begeißeltes, mikroaerophiles Bakterium, das im menschlichen Magen vorkommt.
Krankheitsbilder: Heute wird H. pylori für 80% der Magengeschwüre und praktisch alle Duodenalulzera sowie für die chronisch aktive B-Gastritis verantwortlich gemacht, bei denen eine verstärkte Sekretion von Magensäure auftritt. Weiterhin sollen MALT-Lymphome großteils durch die durch H. pylori induzierte Immunantwort verursacht sein. Eine Rolle in den Genese des Adenokarzinoms des Magens wird für möglich gehalten.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Adhärenzmechanismen
- Das Enzym Urease ermöglicht dem Bakterium das Überleben im sauren Magensaft durch Bildung einer (basischen) Ammoniakwolke um das Bakterium, welche die Säure neutralisiert.
- Zytotoxin VacH und CagH
- Einen weiteren Faktor für die Entstehung der Entzündungsreaktion, entdeckte ein internationales Forscherteam am Institut Pasteur in Paris. Demnach dringt das Bakterium mit einem nadelartigen Fortsatz in die Zellen der Magenschleimhaut ein. Hierbei wird ein Peptidoglycan injiziert – der Keim selbst bleibt außerhalb der Zellen. Im Inneren der Zellen bindet das Peptidoglycan an ein spezifisches Rezeptormolekül, wodurch eine Reaktionskette in Gang gesetzt wird, die letztlich zur Entzündung der Magenschleimhaut führt. Offensichtlich wird H. pylori im Gegensatz zu vielen anderen pathogenen Keimen ohne diesen Eindringvorgang nicht vom Immunsystem erkannt, da die dafür zuständigen Oberflächenrezeptoren der Zellen nicht an das Bakterium binden. Der von den Forschern entdeckte Injektionsmechanismus kommt nicht bei allen Stämmen von H. pylori vor. Dies erklärt warum nur ein Teil der infizierten Menschen an Magenschleimhautentzündung erkranken. Literatur: Jérôme Viala et al.: Nature Immunology (Online-Vorabveröffentlichung, DOI: 10.1038/ni1131)
Pathogenese: H. pylori provoziert eine Immunantwort des Körpers, da die Immunozyten jedoch im Schleim und in der saueren Umgebung des Magens nicht überleben können, zerfallen sie und geben Zytokine und Zerfallsprodukte in die Umgebung ab und unterhalten die chronische Entzündung. Die Infektion mit dem Bakterium bedingt im Allgemeinen eine verstärkte Sekretion von Magensäure. Folgen sind Ulzera und die Induktion von MALT-Lymphomen.




Übertragungsweg: Vermutlich fäkal-orale Übertragung. Epidemiologische Daten weisen außerdem auf die Möglichkeit von oral-oralen oder einen gastro-oralen (Kontakt mit durch H. pylori infiziertem Magenschleim bei Erbrechen) Übertragungsmechanismus hin. Der Magen gilt nach derzeitigem Kenntnisstand als das Hauptreservoir für die Keime, was die letzteren Auffassungen stärkt. Ferner wird auch eine mögliche Übertragung durch Schmeißfliegen diskutiert. Es wurde eine zeitlang behauptet, dass das Vorkommen des Bakteriums im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status steht. Jedoch haben Arbeiten aus der Schweiz und Deutschland diese Ansicht nicht stützen können. So sind etwa 7 % der Jugendlichen in der Schweiz und Deutschland von H. pylori befallen, unabhängig vom Status. Nach bisherigen Untersuchungen sind etwa 50 % der älteren Erwachsenen mit dem Bakterium kontaminiert. Jedoch bekommt nicht jeder ein Ulcus! Bei einer Beseitigung des Bakteriums besteht nur ein einprozentiges Risiko einer Wiederansteckung.
Epidemiologie: Mit einer Prävalenz von weltweit ca. 50% ist die H. pylori-Infektion eine der häufigsten chronischen bakterielle Infektionen. Hierbei ist die Infektionsrate in Entwicklungsländer sehr viel höher als in den Industrienationen. In Deutschland sind insgesamt ca. 33 Millionen Menschen mit H. pylori infiziert, von denen ungefähr 10 bis 20 % eine peptische Ulkuskrankheit entwickeln. Für das weltweit verbreitete Bakterium konnten insgesamt 370 Stämme nachgewiesen werden, die in Details ihrer DNA-Sequenzen sehr große Unterschiede aufweisen. Für Epidemiologen und Ethnologen gleichermassen interessant ist die Tatsache, dass die Völkerwanderungen des Menschen und die Verbreitung von H. pylori gemeinsame Wurzeln haben.
Diagnostik: Der Nachweis des H. pylori geschieht durch mehrere Probeentnahmen aus Antrum und Corpus des Magens und dem direkten mikroskopischen Nachweis, der Kultur oder indirekt über den Nachweis der Urease. Auch der Harnstoff-Atemtest kann das Bakterium mit hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen. Beim Atemtest trinkt der Patient eine 13C Isotopen-markierte Harnstofflösung. Harnstoff wird durch die Urease gespalten und 13C markiertes Kohlendioxid abgeatmet, welches dann nachgewiesen werden kann. Da 13C ein stabiles Isotop ist, ist der Test ungefährlich. Möglich ist auch der Nachweis des Keimes im Stuhl (PCR). Zuletzt besteht auch die Möglichkeit des Antikörpernachweises im Blut (Serologie).
Therapie: Die Therapie von H. pylori besteht aus der Kombination eines Protonenpumpenhemmers mit zwei Antibiotika (Eradikationstherapie). Hierfür gibt es zahlreiche "Rezepte":
| Therapieform | Protonen-pumpen-hemmer | Antibiotikum | Antibiotikum | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| french triple | Omeprazol | Clarithro-mycin | Amoxicillin | gutes Ansprechen |
| italian triple | Omeprazol | Clarithro-mycin | Metronidazol | 25 % Resistenz bei Metronidazol |
Bei den Antibiotika werden Amoxicillin oder Metronidazol zusammen mit Clarithromycin kombiniert. Nach 7-tägiger Behandlung ist mit über 95 % Erfolgsrate zu rechnen. Die Therapie mit Protonenpumpenhemmer, Amoxicillin und Clarithromycin („french triple“) erzielt die höchsten Eradikationsraten. Die zweite gängige Behandlung besteht aus Protonenpumpenhemmer, Metronidazol und Clarithromycin („italian triple“). Letztere bietet sich insbesondere bei Penicillinallergie an, da in diesem Fall Amoxicillin nicht verwendet werden darf.
Alternativ bietet die Quadruple-Therapie die Möglichkeit zur Eradikation. Hierbei wird ein Protonenpumpenhemmer mit Tetracyclin und Metronidazol sowie Wismut kombiniert. Bei 10-tägiger Anwendung ist der Erfolg 95 %. Hierbei wird der Protonenpumpenhemmer über die Tage 1 bis 10 der Therapie appliziert, die beiden Antibiotika und Wismut über die Tage 4 bis 10.
Mittels einem ¹³C-Harnstoff-Atemtest (nicht invasiv in der Ausatemluft) kann etwa sechs Wochen nach Therapieende der Erfolg nachgewiesen werden. Ursachen für Misserfolge können neben mangelnder Compliance eigentlich nur Antibiotika-Resistenz sein, daher vor einem neuen Therapieversuch den Keim kulturell anzüchten. Die Rezidivrate beträgt 5 % pro Jahr.
Nicht jede Helicobacter-pylori-Infektion muss behandelt werden. Bei einem Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür mit nachgewiesenem H. pylori sowie beim Helicobacter-assoziierten MALT-Lymphom ist die Therapie jedoch zwingend erforderlich.
Ethnologie: Bei einem Vergleich des Bakteriengenoms wurde festgestellt, dass es bevorzugt innerhalb von Familien weitergegeben wird. Das führt dazu, dass Bakterienstämme in unterschiedlichen geographischen Bevölkerungsgruppen genetisch unterscheidbar sind. Die europäischen Stämme der Bakterien stammen beispielsweise aus dem Nahen Osten und aus Asien. Durch Vergleiche des Bakterienerbgutes sollte es möglich sein, die Ausbreitung der Bakterien, und somit indirekt Wanderbewegungen der Menschheit nachzuvollziehen.
Entdeckungsgeschichte: Dem deutschen Arzt und Forscher Robert Koch (1843-1910) gelang es im 19. Jahrhundert Bakterien durch Kultivierung, Mikroskopie und Übertragung in einen Kausalzusammenhang mit Infektionskrankheiten zu bringen. Er ebnete so den Weg in die medizinische Mikrobiologie und beschrieb die Bakterien - wie H. pylori. Bereits vor über 70 Jahren wurden spiralige Mikroorganismen im Magen nachgewiesen. Die Idee von Magenbakterien als Krankheitsursache von Magen- und Duodenalulzera konnte sich allerdings nicht gegen die Alternativhypothesen "Übersäuerungsproblem" und „psychosomatisch“ durchsetzen, da man weithin annahm, dass das saure Magenmilieu eine Magenflora ausschließe.
Barry Marshall und J. Robin Warren aus Perth (Western Australia), entdeckten H. pylori 1983 (wieder), wurden damit aber von der medizinischen Forschung lange Zeit nicht ernst genommen. Marshall u.a machten 1985 heroische Selbstversuche und konnten durch Trinken von Helicobacter-Lösungen tatsächlich bei sich selbst eine akute Gastritis auslösen. 1989 gelang es ihnen dann allgemeines Gehör zu finden und das Bakterium wurde weltweit als Ursache von Ulcus und Gastritis akzeptiert. Im Dezember 2005 wurden Warren und Marshall für ihre Arbeiten zu H. pylori je zur Hälfte mit dem "Nobelpreis für Physiologie oder Medizin" ausgezeichnet.
Ursprünglich wurde der Organismus Campylobacter pyloridis genannt (nach dem Pylorus). Später wurde es in Campylobacter pylori umbenannt, damit es besser zu den Namen anderer krankmachender Keime im Magen-Darm-Trakt passt. 1989 wurde es endgültig wegen des Bestandes an Enzymen und Funktionen Helicobacter pylori genannt.
Andere Arten von Helicobacter wurden seitdem auch in den Mägen anderer Säugetiere und Vögel entdeckt.
Aussichten: 2005 trafen sich am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin Helicobacter-Experten aus Nordamerika, China und Europa, um über die Entwicklung und den Einsatz eines Impfstoffs zu diskutieren. Nach Thomas F. Meyer, Direktor des MPI für Infektionsbiologie, wird „die Gefährlichkeit von H. pylori immer noch generell unterschätzt. Mehr als die Hälfte aller Menschen ist damit infiziert, und man muss davon ausgehen, dass etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung einmal im Leben an einem Magengeschwür erkranken“. Ein Teil davon leidet danach an einem Magenkarzinom, das weltweit jährlich etwa 750.000 Opfer fordert. Es ist zehn- bis zwanzigfach häufiger als der seltene Speiseröhrenkrebs. Um den Zusammenhang dieser Krebsform, dem Sodbrennen mit dem Verschwinden des Magenkeims H. p. geht es vor einer Entscheidung über die Impfstrategie. Malfertheiner u. a. schlagen im American Journal of Gastroenterology die Impfung vor allem in Ländern mit hohem Magenkrebsrisiko vor, also vor allem in China, Japan und den Staaten Lateinamerikas. Eine Rolle bei der künftigen Entscheidung kann auch das Interesse der Pharmaindustrie spielen, die das sichere Geschäft mit den Antibiotika verständlicherweise hoch einschätzt. Die Berliner Forscher warnen vor verfrühter Hoffnung auf die Möglichkeit zur Impfung. Ein zuverlässiger Impfstoff sei vor 2010 nicht verfügbar.
Genomforschung: Bereits im Jahr 1997 wurde die erste komplette Genomsequenz eines Vertreters der Art Helicobacter pylori publiziert. 1999 wurde eine zweite Sequenz veröffentlicht womit sich erstmals die Möglichkeit ergab, die Genomsequenzen von zwei Isolaten derselben Bakterienart zu vergleichen. Dabei zeigte sich, dass sich die beiden Isolate in etwa 10% der Gene unterschieden. Literatur: Tomb, J.-F. et al., 1997. The complete genome sequence of the gastric pathogen Helicobacter pylori. Nature 388:539-547 und Alm RA et al., 1999. Genomic-sequence comparison of two unrelated isolates of the human gastric pathogen Helicobacter pylori. Nature 397:176-80.
Weblinks: RKI - Helicobacter pylori
Legionellen
| Legionella sp. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Von den über 40 Legionellen-Arten sind u.a. L. pneumophila, L. micdadei, L. bozemani und L. dumoffi humanpathogen und lösen pulmonale Legionellosen aus. Legionella pneumophila ist der häufigste Erreger (70-80 %) der Legionärskrankheit und des Pontiac-Fiebers.
Morphologie und Eigenschaften: L. pneumophila ist ein obligat aerobes, gramnegatives, unbekapseltes und sporenloses Stäbchen-Bakterium mit meist monopolarer Begeißelung. Im Nativpräparat finden sich meist kurze Stäbchen, während in Kultur meist unterschiedlich große Stäbchen-Bakterien (2-20µm) vorherrschen. Legionellen benutzen v.a. Aminosäuren als Energiequelle. Zucker können nicht zu Säuren verstoffwechselt werden. Legionellen sind auf Cystein und Eisen(III)-Ionen im Nährmedium angewiesen, daher findet man sie in der freien Natur in der Regel in Kombination mit autotrophen Mikroorganismen (z.B. Eisen-Mangan-Bakterien) oder als Endosymbionten in Amöben (z.B. Acanthamoeba, Naegleria, Hartmanella), die den Legionellen Schutz bieten und bei der Verbreitung von L. pneumophila eine wichtige Rolle zu spielen scheinen. Legionellen bilden keine Urease und Nitratase, sind jedoch Katalase positiv. Sie sind gegen Austrocknung sehr empfindlich. Bei einer Temperatur von 60°C überleben sie etwa fünf Minuten.
Infektionsweg: L. pneumophila findet sich weltweit in Erd- und Gewässerproben. Infektionsquelle für den Menschen sind Warmwasserleitungen mit nicht ausreichend erhitztem Wasser, Klimaanlagen und Kühltürme. Die Übertragung erfolgt in der Regel aerogen, meist durch Einatmen von erregerhaltigen Aerosolen aus Klima-Anlagen oder Wasserhähnen. Es wird geschätzt, dass nur 10% der Infektionen wirklich zu einer Erkrankung führen. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung findet nicht statt.
Epidemiologie: Legionellosen treten meist sporadisch, seltener in kleinen Epidemien auf. In den USA schätzt man, dass ca. 30 Erkrankungsfälle pro Jahr und 100.000 Einwohnern auftreten. Die Legionellosen haben in den Sommermonaten einen Höhepunkt. In endemischen Gebieten schätzt man, dass etwa 5% der Pneumonien auf Legionellen zurückzuführen sind.
Krankheitsbilder: Die Legionärskrankheit verläuft als atypische, interstitielle Pneumonie mit Fieber, Durchfällen, Kopfschmerzen und Desorientiertheit. Sie betrifft häufig immungeschwächte Menschen (z.B. Alkoholiker, HIV-Erkrankte). Die Letalität beträgt unbehandelt im Mittel etwa 10%, kann aber bis zu 80 % betragen.


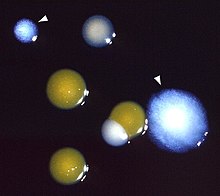
Das Pontiac-Fieber ist eine akute, selbstlimitierende respiratorische Erkrankung mit Husten und Schnupfen, die meist nach sieben Tagen spontan ausheilt.
Inkubationszeit: Die Inkubationszeit der Legionärskrankheit beträgt zwei bis zehn Tage. Die des Pontiac-Fiebers nur ein bis zwei Tage.
Pathogenese: L. pneumophila adhäriert an Wirtszellen über einen Pilus und induziert eine besondere Form der Phagozytose (sog. coiling phagocytosis), entgeht aber der intrazellulären Abtötung und vermehrt sich in nicht aktivierten phagozytierenden Zellen. L. pneumophila induziert eine z.T. nekrotisierende Entzündung der Alveolen. Die Abwehr von L. pneumophila als intrazellulärer Erreger ist wahrscheinlich von T-Lymphozyten abhängig. Diese aktivieren die erregerhaltigen Makrophagen, so dass die Erreger im Inneren der Phagozyten vernichtet werden können. L. pneumophila produziert Exotoxine (z.B. Hämolysin) und Enzyme. Die Rolle im Krankheitsgeschehen dieser Exotoxine ist noch nicht abschließend geklärt. Das Protein MIP (macrophage infectivity potentiator), ein 24 kDA Protein, scheint bei der Phagozytose-Induktion beteiligt zu sein.
Diagnostik:
- Antigennachweis: Ein L. pneumophila-Antigennachweis kann im Urin durchgeführt werden (ELISA, allerdings nur Serogruppe 1 von L. pneumophila).
- Mikroskopie: In der Gram-Färbung lassen sich Legionellen schlecht färben. Daher benutzt man meist Fluoreszenz-markierte polyklonale Antikörper.
- Anzucht: Die Anzucht kann aus Lungenbiopsien, Bronchialsekret und einer bronchoalveolären Lavage (BAL) gelingen. Wichtig ist, dass dem Labor die Verdachtsdiagnose einer Legionellose mitgeteilt wird, da der Erreger auf Routine-Nährböden nicht anzuziehen ist. Die Anzucht kann auf gepufferten Kohle-Hefe-Agar mit Zusatz von α-Ketoglutarat (α-BCYE Agar) gelingen. Kolonien erscheinen bei kapnophiler Bebrütung nach 2-7 Tagen.
- PCR: Die PCR ermöglicht einen schnellen Erreger-Nachweis. Die Spezifität und die Sensitivität sind jedoch noch offen.
- Serologie: Im Blut können Antikörper gegen L. pneumophila nach etwa zehn Tagen nachgewiesen werden (IF, EIA, Western blot).
Therapie: Die Therapie der Legionärskrankheit erfolgt meist mit Makroliden (z.B. Erythromycin), evtl. plus Rifampicin, alternativ können auch Fluorchinolone eingesetzt werden. Die Infektion ist nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig.
Prophylaxe: Trinkwasseruntersuchungen, Sanierung möglicher Infektionsquellen durch Erhitzen oder Chlorierung.
Historisches: L. pneumophila wurde erst 1976 entdeckt, als bei einer Tagung der American Legion in Phildadelphia eine Epidemie unter den teilnehmenden Veteranen auftrat. 29 der 182 erkrankten Veteranen verstarben damals. Die Legionärskrankheit erhielt davon ihren Namen.
Weblinks: RKI - Legionellose
Pasteurella multocida
Aerobes, gramnegatives Stäbchen der Mundflora von Katzen und Hunden. Häufiger Erreger bei Katzenbißverletzung. Kann zu rasch progredienten Weichteilinfektionen führen.
D.: Kultur
Th.: Ohne Infektionszeichen: Wundreinigung und -desinfektion, Antibiotische Therapie bei Biss ins Gesicht oder an den Händen, ansonsten abzuwägen. Bei Weichteilinfektion: Chirurgische Wundsanierung, Ampicillin oder Amoxicillin plus Clavulansäure.
HACEK-Gruppe
Haemophilus sp.
| Haemophilus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Die 16 Arten der Gattung Haemophilus sind kurze, gramnegative, unbewegliche Stäbchen, die die Schleimhäuten von Menschen und Tieren bewohnen und verschiedene Erkrankungen auslösen können. Beinahe alle Haemophilus-Arten sind in der Lage, ohne Sauerstoff zu überleben, allerdings sind sie meistens eher aerob (fakultativ aerob). Der Name der Gruppe kommt von ihrer besonderen Vorliebe für Nährböden mit Blut- oder Hämoglobinzusätzen, auf denen sie in Kultur gehalten werden können. Die ernährungstechnisch anspruchsvollen Bakterien wachsen bis auf H. hämolyticus nicht auf normalem Blutagar, lassen sich aber auf Kochblutagar heranzüchten.
Medizinisch bedeutsame Arten:
Haemophilus influenzae (HiB)
Die invasive Haemophilus Influenzae B-Infektion ist eine der schwersten bakteriellen Infektionen in den ersten fünf Lebensjahren. Der Erreger ist ausschließlich humanpathogen und findet sich vor allem auf den Schleimhäuten der oberen Atemwege. Bei Erkrankungen gefundene Exemplare sind fast immer bekapselt. Etwa 50 % der gesunden Bevölkerung sind von diesem Keim besiedelt, davon 5 % mit dem bekapselten Typ.
Kultur: Haemophilus Influenzae B benötigt zum Wachsen Hämin (Faktor X) und NAD bzw. NADPH (Faktor V). Die Kultur gelingt demnach auf Kochblutagar oder auf Blutplatten, die mit S. aureus beimpft sind, der NAD zur Verfügung stellt („Ammenphänomen“).
 |
 |
 | |
 | |
 |
Infektionsweg: Übertragung von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion
Inkubationszeit: Zwei bis fünf Tage.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Adhäsine
- Pili
- IgA-Protease
- Polyribitolphosphat-Kapsel: 95 % der invasiven Infektionen werden durch Kapseltyp B verursacht, unbekapselte Stämme verursachen meist nur lokale Infektionen.
Krankheitsbilder: Fieberhafte Infektionen der Atemwege wie Otitis media, Sinusitis, Bronchitis und Pneumonie in allen Altersklassen. Lebensbedrohliche Komplikationen, von denen vorwiegend Kinder betroffen sind, sind die eitrige Meningitis, die Sepsis und die Epiglottitis (DD: Pseudokrupp). Weitere mögliche Manifestationen umfassen Pleuritis, Perikarditis, Arthritis und Osteomyelitis. Klinisch sind die Kinder mit Epiglottitis schwer krank, haben starke Halsschmerzen, sprechen, husten und schlucken nicht (Speichel läuft aus dem Mund) und es besteht Erstickungsgefahr.
Diagnostik: Klinik, Bei V.a. Epiglottitis ist die Inspektion des Mundraumes wegen Erstickungsgefahr zu unterlassen!
Therapie: Aminopenicilline (Amoxicillin, Ampicillin) plus BLI oder parenterale 3a/b-Cephalosporine, ferner Makrolide und Cotrimoxazol.
Prophylaxe: Schutzimpfung: Ab vollendetem zweiten Lebensmonat erfolgen drei Impfungen im Abstand von vier Wochen mit Kombinationsimpfstoffe, im 11. bis 14. Lebensmonat dann eine vierte Impfung. Bei verspäteter erster Impfung nach dem 18. Lebensmonat erfolgt nur eine Impfung. Bereits zwei Jahre nach Einführung der Impfung in Deutschland im Jahre 1990 sind HiB-Infektionen um mehr als 80% zurückgegangen. Wurden in den 80er-Jahren noch etwa 50 Fälle jährlich registriert, waren es in den vergangenen Jahren durchschnittlich etwa acht. Meist werden Kombinationsimpfstoffe eingesetzt, die u.a. die HiB-Komponente beinhalten. Über Impfreaktionen wie leichte Temperaturerhöhung, Rötung und Schwellung an der Einstichstelle wird gelegentlich berichtet. Im Allgemeinen treten diese Reaktionen nach der zweiten und dritten Impfung etwas häufiger auf. Geimpft werden sollten unbedingt alle Patienten ohne Milz oder deren Milz nur eingeschränkt arbeitet (Splenektomierte sollten auch unbedingt gegen Meningokokken und Pneumokokken geimpft sein).
Weblinks: RKI - Haemophilus influenzae
Haemophilus ducreyi
Haemophilus ducreyi ist der Erreger des weichen Schanker (auch Ulcus molle), einer bei uns meldepflichtigen Geschlechtskrankheit. Die Krankheit und damit auch ihr Erreger kommen vor allem in den tropischen Regionen in Afrika, Südostasien und Lateinamerika vor. Sichtbares Zeichen der Krankheit sind rundliche Geschwüre an den Schamlippen und im Scheidenvorhof der Frau bzw. an der Glans penis und am Penisschaft des Mannes sowie die Mitbeteiligung der regionären Lymphknoten. Seit 2003 ist auch das Genom dieses Bakteriums bekannt.
Therapie: Makrolide, alternativ Cotrimoxazol oder parenterale Cephalosporine 3a.
Haemophilus parainfluenzae
Haemophilus parainfluenzae ist ein nur gering pathogener Bewohner des Mundrachenraums. In seltenen Fällen kann er eine Endokarditis auslösen.
Haemophilus aegypticus
Haemophilus aegypticus, auch als Koch-Weeks-Bacillus bezeichnet, ist morphologisch nicht von H. influenzae zu unterscheiden. Er ist vor allem in Nordafrika und anderen tropischen und subtropischen Kontinenten verbreitet und der Erreger der als purulente Konjunktivitis bekannten Augenbindehautentzündung.
Haemophilus aphrophilus
Haemophilus aphrophilus kann Abszesse und Endokarditis hervorrufen.
Apathogene Haemophilus sp.
Haemophilus parahaemolyticus, Haemophilus paraprophilus und Haemophilus haemolyticus verursachen keine Erkrankungen.
Anders als die anderen Vertreter der Gattung ist H. haemolyticus in der Lage, das Hämoglobin des Blutes zu spalten und zu nutzen.
Actinobacillus actinomycetem comitans
Aerobes, gram-negatives, unbewegliches Stäbchenbakterium.
Krankheitsbilder: Juvenile Parodontitis, Endokarditis, Perikarditis, Meningitis, Knochen- und Weichteilinfektionen.
Cardiobacterium sp.
Eikenella corrodens
Mikroaerophile, gramnegative, kokkoide und unbewegliche Stäbchenbakterien. Teil der menschlichen Mundflora. Häufiger Erreger bei Bissverletzungen durch Menschen.
D.: Kultur
Th.: Amoxicillin plus Clavulansäure
Kingella sp.
Ernährungstechnisch weniger anspruchsvolle Gram-negative Stäbchen
Anaerobe Stäbchen
Gram-negative, anaerobe Stäbchen gehören bei Mensch und Tier zur normalen Bakterienflora. Als Opportunisten können sie unter für sie günstigen Umständen (reduzierte Immunität, Eintritt in sterile Körperhöhlen, Verletzungen u.a.m.) endogene, eitrige oder septische Infektionen verursachen. Die Anaerobier können solitär oder als Teil aerob-anaerober Mischinfektionen auftreten.
Bacteroides fragilis
| Bacteroides fragilis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Bacteroides fragilis gehört, wie die übrigen Mitglieder der Bacteroides, zu den Gram-negativen, obligat anaeroben und nicht sporenbildenden Stäbchen-Bakterien. Bacteroides sp. gehören bei Mensch und Tier zur physiologischen Bakterienflora und spielt eine wichtige Rolle bei der Kolonisationsresistenz. B. fragilis findet sich häufig bei Mischinfektionen mit aeroben bzw. fakultativ anaeroben Bakterien.
Morphologie und Eigenschaften: Bacteroides fragilis ist ein obligat anaerobes, Gram-negatives und nicht sporenbildendes Stäbchenbakterium. Gegen Umwelteinflüsse ist Bacteroides fragilis auf Grund der Empfindlichkeit gegenüber Sauerstoff relativ empfindlich. Das Bakterium ist galleresistent, spaltet Saccharose und ist nicht pigmentiert. Die Identifizierung erfolgt biochemisch.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren: B. fragilis bildet z.T. eine Kapsel, die es in Kombination mit anderen anti-phagozytären Substanzen vor der Phagozytose schützt. Das Lipopolysaccharid (LPS) von Bacteroides fragilis unterscheidet sich von dem der aeroben Bakterien und entfaltet nur eine geringere Toxizität im Wirtsorganismus. Der Mikroorganismus besitzt zur Verbesserung der Adhärenz Fimbrien. Außerdem finden sich unterschiedliche Exotoxine und Enzyme.
Krankheitsbilder: Bacteroides fragilis als wichtigster Erreger und Bacteroides thetaiotaomicron finden sich häufig in aerob-anaeroben Mischinfektionen, so z.B. bei Peritonitis, gynäkologischen Infektionen (z.B. Adnexitis), intraabdominellen Abszessen nach abdominalchirurgischen Eingriffen, Aspirationspneumonien, Sinusitiden und Hirnabszessen sowie bei Patienten mit konsumierenden Grunderkrankungen.
Vorkommen und Übertragung: Bacteroides fragilis gehört nicht zu den typischen Umweltkeimen. Er gehört vielmehr zur normalen Bakterien-Flora des Menschen. Die Besiedelung des Menschen durch Bacteroides sp. findet meist während der ersten Lebensjahre statt. Infektionen sind daher meist endogen, d.h. von der physiologischen Flora des eigenen Körpers ausgehend.
Pathogenese: Als Bestandteil der physiologischen Flora ist B. fragilis nur gering pathogen. Infektionen entstehen durch Keimverschleppung in eigentlich sterile Körperbereiche. Häufig erfolgt zunächst eine Infektion durch aerobe bzw. fakultativ anaerobe Bakterien. Diese senken den Sauerstoff-Partialdruck im infizieren Gewebe und schaffen Anaerobiern wie Bacteroides sp. ein optimales Mileu. Isolate aus Infektionsherden bilden meist eine Kapsel, die sich jedoch nach mehreren Subkultur-Schritten häufig nicht mehr findet.
Epidemiologie: Etwa 5-10 % der Sepsis-Fälle, die durch Gram-negative Stäbchen hervorgerufen werden, gehen auf Infektionen durch Bacteroides sp. zurück. B. fragilis ist dabei der häufigste isolierte Keim der Bacteroides.
Diagnostik:
- Anzucht: B. fragilis lässt sich unter strikt anaeroben Bedingungen auf Spezialnährböden anzüchten. Bakterien der Bacteroides-fraglilis-Gruppe bilden meist nach zwei Tagen 1–3 mm große, grau-glänzende Kolonien. Zur Differenzierung der Bacteroides-fragilis-Gruppe sind biochemische bzw. gaschromatographische Untersuchungen notwendig.
- Mikroskopie: Die Gram-Färbung und die Färbung mit gruppenspezifischen Fluoreszenz-markierten Antikörpern kann die Diagnose sichern.
Therapie: Nekrosen und Abszesse müssen chirurgisch saniert werden, da Antibiotika meist nicht in ausreichender Menge in das Infektionsgebiet vordringen. Gegen Aminoglykoside sind Bacteroides primär resistent, sekundär auch gegen β-Laktamase-sensible Penicilline und Cephalosporine. Zum Einsatz kommen daher v.a. Nitroimidazole (Metronidazol), Aminopenicilline plus BLI, Piperazillin/Tazobactam und Carbapeneme (Imipenem). Die entsprechenden Antibiotika kommen meist schon bei Verdacht zum Einsatz, da die bakteriologische Diagnostik zu lange dauert. Bei Operationen im Darmtrakt wird häufig eine Chemoprophylaxe durchgeführt, um eine Infektion durch Anaerobier zu verhindern.
Historie: Veillon und Zuber beschrieben 1898 Bacteroides fragilis (damals noch Bacillus fragilis) erstmals als Erreger einer Appendizitis.
Porphyromonas spp.
Morphologie und Eigenschaften: P. asaccharolytica, P. endodontalis, P. gingivalis und P. salivosa sind Gram-negative, obligat anaerobe Bewohner der normalen Mund-, Darm- und Urogenitalflora.
Krankheitsbilder: Porphyromonaskann unter opportunen Bedingungen eitrige Entzündungen und Abszesse auslösen, z.B. Entzündungen im Oropharyngeal-, Peridontal- und Urogenitalbereich. Weiterhin kann das Bakterium an aerob-anaeroben Mischinfektionen teilhaben, wie intraabdominelle Abszesse, Hirnabszesse, Lungenabszesse und Empyem und er kann bei Haut- und Weichteilinfektionen sowie Infektionen beim diabetischen Fuß eine pathogene Rolle spielen.
Diagnostik: Kultur unter anaeroben Bedingungen auf herkömmlichen Nährmedien.
Therapie: Clindamycin oder Metronidazol sind die 1. Wahl. Weiterhin können Penicilline (Penicillin G, Amoxicillin, Piperacillin/Tazobactam), Carbapeneme und Chloramphenicol eingesetzt werden.
Prevotella spp.
Morphologie und Eigenschaften: Die zahlreichen Spezies der Gattung Prevotella sind Gram-negative, anaerobe Mikroorganismen der physiologischen Mund-, Darm-, und Urogenitalflora
Arten (Auswahl): P. bivia, P. buccae, P. buccalis, P. corporis, P. denticola, P. disiens, P. gingivalis, P. heparinolytica, P. intermedia, P. loescheii, P. melaninogines, P. nigrescens, P. oralis, P. oulorum, P. pallens
Krankheitsbilder: Die Krankheitsbilder entsprechen denen von Porphyromonas: Eitrige Entzündungen und Abszesse im Oropharyngeal-, Peridontal- und Urogenitalbereich (P. disiens, P. bivia). Aerob-anaerobe Mischinfektionen (intraabdominelle, Hirn-, Lungenabszesse und Empyem), Haut- und Weichteilinfektionen, Wundinfektionen.
Diagnostik: Kultur unter anaeroben Bedingungen auf herkömmlichen Nährmedien.
Therapie: Clindamycin oder Metronidazol. Ferner eignen sich Aminopenicilline, Cefoxitin, Chloramphenicol und Carbapeneme
Fusobakterien
Morphologie und Eigenschaften: Fusobacterium spp. sind obligat anaerobe, Gram-negative, spindelförmige und unbewegliche Stäbchen. Sie sind meist Teil der normalen Mund- und Darmflora.
Arten (Auswahl): F. alocis, F. mortiferum, F. necrophorum, F. nucleatum, F. periodonticum, F. sulci, F. ulcerans, F. varium
Krankheitsbilder: Einige Fusobakterien können eitrige und gangränöse Infektionen hervorrufen. Zu den Krankheitsbildern gehören die Angina Plaut-Vincent (F. nucleatum in Symbiose mit Treponema vincentii), Abszesse - oft als Mischinfektion - in verschiedenen Körperregionen (orofazial, cervical, Atemwege, Abdomen, weibliches Genitale), Infektionen von chirurgischen und Bisswunden, Weichteilinfektionen, Endokarditis und die Postangina-Sepsis (Peritonsillarabszess, Jugularvenenthrombose).
Diagnostik: Kultur unter anaeroben Bedingungen auf herkömmlichen Nährmedien.
Therapie: Penicillin G und Ampicillin sind die 1. Wahl. Alternativen sind Clindamycin und Metronidazol.
Aerobe Stäbchen mit oxidativem Glucosestoffwechsel
Pseudomonas aeruginosa
| Pseudomonas aeruginosa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
|

Morphologie und Eigenschaften: Pseudomonas aeruginosa (lat. aerugo Grünspan) ist ein gramnegatives, aerobes und Oxidase-positives Stäbchenbakterium. Es ist lophotrich begeißelt (büschelige Flagellen an beiden Polen) und besitzt zusätzlich Haftfimbrien. P. aeruginosa ist nicht zur Gärung befähigt (Nonfermenter), und kann daher nur aerob existieren. In verschiedenen Nährmedien setzt er Farbstoffe wie Fluorescein/Pyoverdin (gelbgrün), Pyozyanin (blaugrün), Pyorubin und Pyomelanin frei. Die oft unregelmäßig begrenzten Kolonien sind metallisch-grün glänzend und zeigen β-Hämolyse. Charakteristisch ist ein süßlicher Geruch nach Lindenblüten oder Weintrauben (Aminoacetophenon).
Vorkommen: P. aeruginosa ist ein ernährungstechnisch anspruchsloser, ubiquitär vorkommender Boden- und Wasserkeim und kann aus Pflanzen, Früchten, Lebensmitteln und dem Darmtrakt von Mensch und Tier isoliert werden. Als bedeutender Erreger nosokomialer Infektionen und Feuchtkeim findet er sich besonders in Leitungswasser, Bädern, Waschbecken, Spülmaschinen und sogar (unterdosierten) Desinfektionslösungen.
Übertragung: meist aus der Umwelt (Naßzonen), seltener von Mensch zu Mensch
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Haftfimbrien
- Biofilm-Bildung
- Neuraminidase
- Lipopolysaccharide (LPS) -> interagieren mit CFTR
- Exotoxin A (ToxA), eine ADP-Ribosyltransferase, die den Elongationsfaktor EF2 inaktiviert (ähnlich dem Diphtherietoxin)
- Exoenzym S (ExoS), welches Zytoskelett- und G-Proteine hemmt
- Zytotoxin, welches transmembrane Poren erzeugt
- Metalloproteinasen, die Interzellularbestandteile wie Elastin, Kollagen und Laminin hydrolysieren
- Zwei Phospholipasen C mit Membranaktivität

Gramfärbung von
P. aeruginosa - Multiple Antibiotikaresistenzen (ß-Laktamasen, Effluxmechanismen, mutiertes Carbapenem-Transportprotein u.a.)
Krankheitsbilder: Typisch sind opportunistische Infektionen wie Pneumonien (bei Cystischer Fibrose, Beatmung, Hitzetrauma), Wundinfektionen (bes. bei Verbrennungen, postoperativ), chronische Pyelonephritiden, Endokarditis (bei i.v.-Drogenabusus), nosokomiale Sepsis, Katheter-assoziierte Infektionen (z.B. Harnwegsinfektionen bei Blasenkatheter), ulzerierende Keratitis (Kontaktlinsen), Osteomyelitis, Dermatitis/Follikulitis, die maligne Otitis externa u.a.m.
Therapie: häufig Multiresistenzen!
- ß-Lactam-Antibiotika (Azlocillin, Piperacillin plus BLI) plus evtl. ein Aminoglykosid (Tobramycin)
- Cephalosporine parenteral 3b (z.B. Ceftazidim, Cefepim)
- Ciprofloxazin bei Harnwegsinfektion
- alternativ Carbapeneme
Acinetobacter sp.

| Acinetobacter sp. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | |||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Acinetobacter sind Gram-negative, chemoorganotroph lebende und damit aerobe, Oxidase-negative Stäbchenbakterien.
Vorkommen: Acinetobacter spp. sind häufige Boden- und Wasserbewohner.
Krankheitsbilder: Nosokomiale Infektionen wie Wundinfektionen, Atemwegsinfekte, sekundäre Meningitis (Meningitis nach Schädelhirntrauma, neurochirurgischen Eingriffen) und Sepsis. Häufigster Vertreter der etwa 20 bekannten Spezies ist A. baumannii, daneben werden auch A. lwoffi, A. junii, A. haemolyticus und A. johnsnii nachgewiesen.
Therapie: Oft Multiresistenzen durch Bildung von β-Lactamasen und Aminoglykosid-modifizierenden Enzymen. Am besten scheinen noch Carbapeneme zu wirken.
Aerobe Stäbchen mit fermentativem Glucosestoffwechsel
Vibrio cholerae
| Vibrio cholerae | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Vibrio cholerae ist der Verursacher der Cholera (griech.: Gallenbrechdurchfall).
Morphologie und Eigenschaften: Das Gram-negative, gekrümmte, kommaförmige und hochbewegliche Bakterium Vibrio cholerae gehört zur Gattung der Vibrionen und umfasst 70 Stämme. Es ist fakultativ anaerob, Oxidase-positive und gehört zu den Fermentern.
Epidemiologie: Die klassische Cholera wurde durch den Biovar O1/Biovar cholerae verursacht, heute herrscht vor allem der resistentere Biovar O1/Biovar eltor vor. 1998 gab es weltweit 300.000 Cholera-Fälle mit 11.000 Toten und Schwerpunkt in Afrika. Cholera tritt häufig in Entwicklungsländern auf, in denen Trinkwasser- und Abwassersystem nicht voneinander getrennt sind. In den Industrieländern ist meist eine ausreichende und hygienisch einwandfreie Versorgung der Bevölkerung gewährleistet, so dass Cholerafälle selten sind. Der letzte größere Choleraausbruch in Deutschland war in Hamburg im Jahr 1892. Die Krankheit kann epidemisch auftreten und ist in Deutschland meldepflichtig und eine Quarantäneerkrankung der WHO.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren: Das phagenkodierte Choleratoxin ist aus zwei A- und fünf B-Proteinuntereinheiten aufgebaut. Der A1-Teil des Toxins ADP-ribosyliert die α-Untereinheit stimulatorischer Gs-Proteine und inaktiviert dadurch die GTPase-Aktivität, die für das Abschalten des G-Proteins (Umsetzung von GTP zu GDP) verantwortlich ist. Es kommt zu einem Überschuss des Second Messengers cAMP durch Daueraktivierung der Adenylatcyclase. Die erhöhte Produktion von Proteinkinase A führt zum gesteigerten Einbau von sekretorischen Ionenkanälen in die Darmmukosa, was den massiven Elektrolyt- und sekundären Wasserverlust erklärt.
- Die Pathogenität und Virulenz wird hervorgerufen durch die Integration von zwei Bakteriophagen in das Genom des Bakteriums. Namentlich sind dies VPIΦ (Vibrio Pathogenicity Island) und CTXΦ (Choleratoxin). Der Prozess der Infektion des Bakteriums durch die Bakteriophagen vollzieht sich in zwei Stufen: Zuerst ist nur die DNA von VPIΦ im Genom enthalten. Diese Gene kodieren für den TCP-Faktor (Toxin Coregulated Pili). Dadurch bildet das Bakterium spezielle Pili aus, mit denen es sich an der Oberfläche der Mikrovilli der Darmzellen festhaften kann. Diese Pili bilden nun auch die Rezeptoren für den Phagen CTXΦ. Nachdem dieser in die Bakterienzelle gelangt ist, integriert er sich ebenfalls in das Chromosom (lysogener Phage). Dadurch kann der ACF (Accessory Colony Factor) gebildet werden, und es kommt zur Ausschüttung von Choleratoxin A und B. Da beide Phagen die Zelle jedoch nicht lysieren sondern aktiv aus der Zelle austreten und nur noch schlecht aktiviert werden können verbleibt CTXΦ gemeinsam mit VPIΦ in der Zelle und vermehrt sich mit. VPIΦ selbst ist aufgrund einer Mutation nicht mehr infektionsfähig für andere Bakterien.
 |
 |
Krankheitsbild: Die Cholera ist eine schwere, bakterielle Infektionskrankheit, die vorwiegend den Dünndarm befällt. Sie kann extremen Durchfall und starkes Erbrechen verursachen, was zu einer schnellen Exsikkose mit Elektrolytverlust führen kann. Obwohl die meisten Infektionen asymptomatisch verlaufen (ca. 85 %), beträgt die Letalität bei Ausbruch der Krankheit unbehandelt zwischen 20 und 70 %. Klinisch verläuft die Cholera nach einer Inkubationszeit von 2-3 Tagen meist in drei Stadien:
- Stadium mit Brechdurchfall mit häufig dünnflüssigem Stuhl, oft mit Schleimflocken durchsetzt ("Reiswasserstuhl") und selten Bauchschmerzen.
- Stadium des Flüssigkeitsmangels (Exsikkose). Dabei kommt es zu Untertemperatur und zu einem auffälligen Gesichtsausdruck mit spitzer Nase, eingefallenen Wangen und stehenden Hautfalten.
- Stadium der allgemeinen Körperreaktion mit Fieber, Benommenheit, Verwirrtheit, Koma und Ekzem. Komplikationen wie zum Beispiel eine Lungenentzündung, eine Parotitis und eine Sepsis können hinzukommen. Menschen mit der Blutgruppe 0 sind gefährdeter.
Diagnostik:
- Die Diagnose erfolgt anhand der typischen Beschwerden, die bei einer Person in einem Gebiet mit bekannter Choleragefahr auftreten und
- Anhand des bakteriologischen Erregernachweises im Stuhl oder in Erbrochenem. Die Anzucht geschieht in sog. Peptonwasser bei pH 9.
Infektionsweg: Cholera wird in der Regel durch Trinkwasser verursacht, welches mit Choleraerregern verunreinigt ist. Choleraerreger finden sich vor allem in Fäkalien, sowie in Fluss- und Meerwasser, welches mit Fäkalien belastet ist. Außerdem können Fische und andere Nahrungsmittel aus Flüssen und dem Meer mit Choleraerregern verunreinigt sein.
Geschichte: Der Erreger wurde erstmals von Filippo Pacini 1854 als gekrümmtes, kommaförmiges und hochbewegliches Bakterium beschrieben. Robert Koch hat 1883 zusammen mit Fischer und Georg Theodor August Gaffky (1850-1918) in Ägypten den Erreger aus dem Darm von verstorbenen Patienten in Reinkultur angezüchtet.
Die Cholera wurde seit etwa 600 v. Chr. im Gangestal in Indien beobachtet. Um 1831 gelangt die Krankheit erstmals nach Europa. Um 1892 grassiert die Cholera in Afghanistan und gelangt nach Russland. Robert Koch, der als Entdecker des Cholera-Erregers gilt, vermutete, dass russische Amerika-Auswanderer sie mit nach Hamburg gebracht haben. Es gibt jedoch starke Zweifel an dieser Hypothese, da die ersten Cholerafälle unter den Hamburgern entdeckt wurden. Durch die fehlende Aufklärung der Bevölkerung und zu wenig Kläranlagen wurde der Ausbruch des Erregers stark begünstigt. Allein in Hamburg starben mehr als 8600 Personen.
Die letzte größere Choleraepidemie brach 1991 in Peru aus und breitete sich auch nach Ecuador, Kolumbien, Mexiko und Nicaragua aus. Am 9. Februar rief die peruanische Regierung den nationalen Notstand aus. Von den rund 400.000 damals in Südamerika Erkrankten starben schätzungsweise 12.000.
Therapie: Ausgleich von Volumen- und Elektrolytverlust bevorzugt i.v. ist die wichtigste Massnahme. Ein Antibiotikum vom Fluorchinolon-Typ, z.B. Ciprofloxacin reduziert die Krankheitsdauer und Erregerausscheidung. Auch auf Chinolone und Cotrimoxazol spricht der Erreger an. Mit diesen Maßnahmen kann die Sterblichkeitsrate von 60% auf unter 1% gesenkt werden.
Prophylaxe: Die beste Vorbeugung ist hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Auch eine parenterale Impfung ist möglich, wird allerdings nicht allgemein empfohlen. Neuere Schluckimpfungen sind wirksamer und besser verträglich.
Weblinks: RKI - Cholera
Aeromonas sp.
Enterobacteriaceae
Enterobakterien sind Oxidase-negative, aerob oder fakultativ aerob lebende Mikroorganismen, die ihre Energie durch Fermentation (Gärung und/oder oxidative Fermentation) gewinnen.
Escherichia coli
| Escherichia coli | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Escherichia coli ist ein Gram-negatives, stäbchenförmiges und peritrich begeißeltes Bakterium, das im menschlichen und tierischen Darm vorkommt. Es gehört zur Familie der Enterobacteriaceae. Benannt wurde es 1919 nach seinem Entdecker Theodor Escherich. Es gehört zu den am besten untersuchten Organismen der Welt.
Morphologie und Eigenschaften: E. coli ist ein säurebildendes, Gram-negatives, stäbchenförmiges und peritrich begeißeltes Bakterium. Es ist fakultativ anaerob und kann Energie sowohl durch Atmung als auch durch gemischte Säuregärung gewinnen. Das Bakterium dient als Fäkalindikator in der Trinkwasser- und Lebensmittelhygiene. E. coli stimuliert im Colon die IgA-Sekretion und produziert Vitamin K. Die Teilungsrate ist mit einer Generationszeit von 20min relativ hoch. Auf Blutagar wachsen weissliche Kolonien ohne Hämolyse, auf MacConkey-Agar himbeerote, typischerweise eingedellte Kolonien.
Pathogenität: E. coli bildet einen Großteil der normalen Darmflora und verhindert durch seine Anwesenheit die Ansiedelung von pathogeneren Keimen. Als fakultativ pathogener und oft an nosokomialen Infektionen beteiligter Krankheitserreger verursacht er 70-80 % der akuten und 40-50 % der chronischen Harnwegsinfekte, weiterhin Peritonitis (nach Operationen im Bauchraum), Wundinfektionen, Meningitis bei Neugeborenen (Infektion unter der Geburt), Sepsis und andere Krankheitsbilder.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren: Zum Anheften an bestimmte Zellen der Harnwege besitzen die Bakterien so genannte P-Fimbrien oder PAP (pyelonephritis assoziated pili). Weiterhin kommen Fimbrien und Hämolysine vor. Das Kapselantigen K1 von bestimmten Kapsel tragenden E. coli ist an der Neugeborenenmeningitis beteiligt (s.u.).
Obligat pathogene E-coli-Stämme:
- Einige Stämme von E. coli sind für den Menschen obligat darmpathogen. Hier unterscheidet man einige Subtypen mit unterschiedlichen Pathogenitätsfaktoren:
- EHEC - Enterohämorrhagische E. coli
- ETEC - Enterotoxische E. coli
- EPEC - Enteropathogene E. coli
- EIEC - Enteroinvasive E. coli
- EAEC - Enteroaggregative E. coli
- DAEC - Diffus adhärente E. coli


- Pathogenese bei pathogenen E. coli-Stämmen:
- Darminfektionen wurden vornehmlich unter dem Namen EHEC-Colitis (Enterohämorrhagische Colitis) bekannt. EHEC-Infektionen zählen zu den häufigsten Lebensmittelvergiftungen und betreffen v.a. Säuglinge, Kleinkinder und Immunsupprimierte. Infektionsquellen sind Rinder, Rohmilch, infizierte Menschen oder Trinkwasser. Die Infektionsdosis liegt bei 20-100 Keimen. Das Bakterium enthält ein Toxin mit dem Namen „Verotoxin“, da es toxisch auf Verozellen wirkt, einer Zelllinie aus Affennierenzellen sowie die Shiga-like-toxins 1 und 2 (SLT-1, SLT-2). Bei einer Infektion droht ein Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) mit dauerhaften Nierenschäden durch thrombosierende Nierenkapillaren. Weitere Komplikationen sind eine thrombotisch- thrombozytopenische Purpura (TPP), neurologische Ausfälle, chronische Pankreatitis, Glucose-Intoleranz, Diabetes mellitus und Dickdarmstrikturen. Antibiotika sollten bei EHEC nicht eingesetzt werden, um nicht zusätzlich Toxine durch Bakterienzerfall freizusetzen.
- Der Stamm ETEC ist ein häufiger Erreger der Reisediarrhoe (Montezumas Rache). Grund für diese Erkrankung ist ein hitzelabiles Enterotoxin vom A/B Typ (LT I und LT II). Das 73 kDa große Protein besitzt zwei Domänen, von denen eine an ein G-Gangliosid der Zielzelle bindet (Bindende Domäne). Die andere Domäne ist die Aktive Komponente, die ähnlich dem Choleratoxin die Adenylatcyclase und die Guanylatcyclase aktiviert. Ergebnis ist eine toxinvermittelte, sekretorische Diarrhoe. Die genetische Information erhält das Bakterium von einem lysogenen Phagen durch Transduktion. Weiterhin enthält der ETEC-Stamm noch ein hitzestabiles Toxin (ST), dessen Funktion allerdings noch nicht vollständig bekannt ist.
- Bei Säuglingen löst der Stamm EPEC Durchfall (Mikrovilli-Zerstörung) aus und führt zu Gedeihstörungen.
- Auch EIEC zerstören die Darmschleimhautzelle, indem sie in sie eindringen und das Krankheitsbild der bakteriellen Ruhr imitieren.
- Diagnostik: Erregernachweis: Anzucht auf Selektivnährböden (McConkey-Sorbitol), Toxinnachweis (SLT) mittels ELISA, Gruber-Agglutination
- Therapie: Ausgleich von Wasser- und Elektrolytverlust. Evtl. Antibiotika (Ampicillin plus BLI, parenterale Cephalosporine 2, 3a oder 3b, alternativ Gyrasehemmer oder Cotrimoxazol) in schweren Fällen, bei EHEC-Stämmen sind Antibiotika allerdings kontraindiziert (Gefahr der Niereninsuffizienz)! Der Infektionsnachweis ist meldepflichtig!
- Prophylaxe: Seit Ende 2004 gibt es in Deutschland einen zugelassenen Impfstoff (Dukoral). Dieser imitiert die B-Untereinheit des hitzelabilen ETEC-LT (s.o.) und gleichzeitig die sehr ähnliche B-Untereinheit des Cholera-Toxins. Auf diesem Wege bildet der Körper eine Immunantwort gegen beide Toxine aus (Kreuzreaktivität).
E. coli in der Forschung: Aus E. coli gelang Jonathan Beckwith 1969 als erstem die Isolierung eines einzelnen Gens. Das relativ kleine Genom dieses Prokaryoten (ca. 4,65 ·106 Basenpaare, entspricht etwa 5000 Genen) wurde als eines der ersten vollständig sequenziert.
E. coli ist die in der Molekularbiologie am meisten verwendete Bakterienart. Das komplette Genom ist mittlerweile entschlüsselt worden und viele Einzelstämme wurden isoliert. In der modernen Biotechnologie wird das Bakterium zur industriellen Biosynthese von Insulin, unterschiedlicher Aminosäuren und anderer Verbindungen eingesetzt. Gerade hierfür ist E. coli prädestiniert, da es zur residenten Darmflora gehört und daher beim Menschen keine Allergien verursacht (gegenseitige Anpassung).
Seit 1988 führte Richard Lenski ein Langzeitexperiment über die Evolution von E. coli durch.
Weblinks: RKI - EHEC-Infektionen, RKI - Hämolytisch Urämisches Syndrom (HUS)
Shigellen
| Shigella sp. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Etymologie: Benannt wurden Shigellen nach dem japanischen Bakteriologen Kiyoshi Shiga, dem Entdecker des Erregers der Bakterienruhr.
Morphologie und Eigenschaften: Shigellen sind Gram-negative Stäbchenbakterien der Familie Enterobacteriaceae und leiten sich von E. coli ab (E. coli plus ein 200kB-Virulenzplasmid). Die Bakterien sind unbeweglich (im Ggs. zu E. coli) und fakultativ anaerob. Die Kultur gelingt aus möglichst frischem Stuhl auf Normal- und Selektivnährböden. Die Identifizierung erfolgt biochemisch und mittels Objektträgeragglutination mit Gruppenseren.
Virulenzfaktoren:
- Endotoxine
- Shigella dysenteriae produziert das so genannte Shiga-Toxin, ein Zytotoxin, welches zu einer schwerer wiegenden Vergiftung führt als bei Infektionen mit anderen Shigella-Gruppen und synergistisch mit Endotoxinen z.B. ein Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) verursachen kann (Vgl. E. coli).
Krankheitsbilder: Alle 4 bekannten Shigella-Artengruppen sind medizinisch relevant als Erreger der Shigellosen, besser bekannt als Bakterienruhr (ruora (altdeutsch): heftige Bewegung), und wurden bislang nur beim Menschen und Primaten nachgewiesen. Die Krankheitssymptome (hauptsächlich Fieber, blutig-eitrige Diarrhoe, postinfektiöse Arthritis) stellen eine Reaktion auf die Einwanderung der Bakterien in das Darmgewebe dar.

Shigella-Artengruppen:
- Gruppe A, Shigella dysenteriae: Die Shiga-Toxin-produzierenden Bakterien der Gruppe A sind hauptsächlich in den Tropen und Subtropen verbreitet. Besonders schwer sind Infektionen mit dem Serotyp A (auch Shiga-Kruse-Bakterium), da diese Bakterien neben den normalen Giften auch ein Nervengift bilden.
- Gruppe B, Shigella flexneri: Infektionen dieser Gruppe verlaufen in der Regel weniger schwer als die der Gruppe A, die Bakterien sind weltweit verbreitet.
- Gruppe C, Shigella boydii: Boyd-Bakterien finden sich vor allem in Vorderindien und Nordafrika, Infektionen mit ihnen sind selten und meist harmlos.
- Gruppe D, Shigella sonnei: Diese auch als Kruse-Sonne-Bakterien bekannten Arten stellen vor allem in Mitteleuropa die häufigsten Shigellen dar und verursachen besonders bei Kindern den harmlosen Sommerdurchfall.
Epidemiologie und Übertragung: Weltweit werden jährlich ca. 160 Mio. Menschen infiziert, von denen ca. 1 Mio. sterben. Dabei handelt es sich meist um Kinder, ältere und immungeschwächte Patienten. In Deutschland sind nur S. flexneri und S. sonnei endemisch. Pro Jahr werden über 1.000 Fälle gemeldet, von denen allerdings 70 % importiert sind, darunter praktisch alle Fälle von S. dysenteriae und S. boydii. Die Infektionsdosis ist mit 10-200 Keimen sehr gering. Verbreitet werden Shigellen fäkal-oral, teilweise auch durch Fliegen.
Therapie: Nach Schweregrad symptomatisch oder antibiotisch nach Antibiogramm. Gutes Ansprechen meist auf Ampicillin, Cotrimoxazol und Ciprofloxacin (Cave: HUS!).
Weblinks: RKI - Shigellose
Klebsiellen
| Klebsiellen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|
Etymologie: Klebsiellen wurden nach dem ostpreußischen Bakteriologen Edwin Klebs benannt, geboren 1834 in Königsberg und gestorben 1913 in Bern (Schweiz).
Morphologie und Eigenschaften: Klebsiellen sind Gram-negative, fakultativ anaerobe Stäbchenbakterien der Familie der Enterobacteriaceae. Die Bakterien sind unbeweglich und von einer Polysaccharidkapsel umgeben, die auch für die typischen schleimigen Kolonien verantwortlich ist. Auf MacConkey-Agar wachsen rosa, auf Blutagar weißlich, glänzende Kolonien.
Von den 4 Klebsiella-Arten ist nur Klebsiella pneumoniae als Bewohner des Magen-Darm-Traktes und opportunistischer Krankheitserreger medizinisch relevant. Andere Klebsiella-Arten leben im Boden, im Wasser und auf Getreide. Alle Arten sind unempfindlich gegen Penicillin.
Klebsiella pneumoniae


Klebsiella pneumoniae ist auch bekannt als Friedländer-Bakterium und gehört zur normalen Darmflora des Menschen. Im Normalfall ist das Bakterium ungefährlich, bei Immunschwäche kann es jedoch als Krankheitserreger auftreten und nosokomiale Infektionen wie Harnwegsinfektionen, Wundinfektionen und die Friedländer-Pneumonie verursachen. Das Bakterium gilt im Krankenhaus als Problemkeim und kann auf Neugeborenen- und onkologischen Stationen zu kleinen Epidemien führen.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Polysaccharidkapsel -> Phagozytoseschutz
- Zunehmende Multiresistenzen durch Breitspektrum-β-Lactamasen (ESBL-Stämme) seit Anfang der 80iger.
Therapie: Nach Antibiogramm, wirksam sind oft Cephalosporine parenteral 3a/b (ggf. plus Aminoglycosid), Monobactame, Cotrimoxazol und Gyrasehemmer.
Proteus mirabilis
| Proteus mirabilis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Proteus mirabilis sind Gram-negative, fakultativ anaerobe, nicht sporenbildende, peritrich begeißelte und damit sich lebhaft bewegende stäbchenförmige Bakterien. Sie bilden das Enzym Urease, das Harnstoff spalten kann. Dabei entsteht Ammoniak, der den pH-Wert des Mediums, zum Beispiel von Urin erhöht und dem Bakterium damit bessere Wachstumsbedingungen gewährt (ein niedriger pH-Wert wird von den meisten Bakterien schlecht toleriert). Lactose kann es nicht verstoffwechseln. Die Bakterien können problemlos auf gängigen Kulturmedien kultiviert werden. Sie bilden dabei auf Gelmedien oft nicht umschriebene Kolonien wie die meisten anderen Bakterien, sondern können sich flächig auf dem Medium ausbreiten („Schwärm-Phänomen“). Die Identifizierung erfolgt biochemisch. P. mirabilis ist in der Regel ein harmloser Saprophyt (Destruent organischer Stoffe). Die Bakterien sind in ihrer Länge sehr unterschiedlich, dies führte zur Benennung nach dem alten griechischen Meeresgott Proteus, der sich durch große Wandlungsfähigkeit auszeichnete. Das Genom von P. mirabilis wird momentan vom Sanger Institute (Cambridge, Großbritannien) entschlüsselt.


- Das Schwärm-Phänomen (syn. Schwärmen) findet man typischerweise beim Wachstum von Proteus-Bakterien-Stämmen auf festen Nährböden. Anders als bei anderen Bakterien bilden sich hier kaum Kolonien. Stattdessen findet sich auf der Agar-Platte ein feiner Bakterien-Rasen mit konzentrischen Ringen. Das Schwärmen beruht auf der Fähigkeit von bestimmten Proteus-Stämmen bei eingeschränkter Beweglichkeit der Geißel auf Grund einer hohen Bakterien-Dichte sich zu einem Synzytium mit mehreren Kernäquivalenten zu fusionieren (sog. Schwärmer-Form). Dieses Synzytium besitzt eine etwa um den Faktor 500 höhere Geißelexpression und ist damit enorm beweglich. Das Schwärmen läßt sich durch Kultur auf Cysteine-Lactose-Electrolyte-Deficient-Agar (CLED-Agar) unterdrücken.
Krankheitsbilder: P. mirabilis ist ein fakultativ pathogener (opportunistischer) Krankheitserreger, der auch bei Gesunden häufig im Dickdarm vorkommt. Bei Immungeschwächten kann P. mirabilis Harnwegsinfektionen, Wundinfektionen, Sepsis und Pneumonie verursachen.
Bei chronischen Harnwegsinfektionen durch Proteus mirabilis kann durch die Erhöhung des Urin-pH-Wertes (Urease) die Entstehung von Harnsteinen begünstigt werden.
Epidemiologie: P. mirabilis ist ein seltener Krankheitserreger. Harnwegsinfekte werden in ca. 5-10 % der Fälle durch dieses Bakterium verursacht. Bei Pneumonie und Sepsis bewegt sich der Anteil um 2 %. Diese Zahlen gelten für ambulant erworbene Infektionen, bei nosokomialen Infektionen liegt die Rate tendenziell etwas höher. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich über die Hände und kontaminierte Instrumente.
Diagnostik: Die Diagnosestellung erfolgt durch Kultivierung des Erregers aus Blut- und Urinkulturen, Bronchialsekret oder Bronchoalveolärer Lavage. Nach Anlegen einer Reinkultur kann die Spezies am einfachsten mit biochemischen Methoden („Bunte Reihe“) bestimmt werden.
Therapie: Die Behandlung einer Infektion durch P. mirabilis sollte, wann immer möglich, nach Resistenzprüfung (Antibiogramm) durchgeführt werden. Die anfängliche kalkulierte Therapie kann z.B. mit Amoxicillin plus BLI, einem parenteralen Cephalosporin der 3. Generation, Cotrimoxazol oder mit einem Fluorchinolon erfolgen. Carbapene und Monobactame sind ebenfalls Alternativen.
Problematisch für die Therapie ist insbesondere die Fähigkeit des Bakteriums, extended-spectrum-β-Lactamasen (ESBL) zu produzieren. Damit können die Bakterien Antibiotika vom β-Lactam-Typ (z.B. Penicilline, Cephalosporine) unwirksam machen.
Geschichte: Proteus mirabilis wurde 1885 von dem Erlanger Pathologen Gustav Hauser entdeckt.
Enterobacter sp.
| Enterobacter sp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Enterobacter sp. sind Gramn-negative, begeißelte Stäbchenbakterien und kommen in fast allen Lebensräumen einschließlich des menschlichen Darmes vor, wo sie zur normalen Darmflora gehören.
Insgesamt existieren 5 Arten, von denen Enterobacter aerogenes und Enterobacter cloacae selten als Erreger von Harnwegsinfekten, Meningitis oder Atemwegsinfekten auftreten.
Therapie: Carbapeneme sind die Antibiotika der 1. Wahl. Weiterhin können Piperacillin plus BLI, parenterale Cephalosporine der 3. Generation, Monobactame, Aminoglykoside und Flourchinolone angewendet werden.
Citrobacter sp.

| Citrobacter sp. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Citrobacter sp. sind Gram-negative Stäbchenbakterien der Familie Enterobacteriaceae. Die drei Citrobacter-Arten C. freundii, C. koseri und C. amalonaticus nutzen ausschließlich Citrat als Kohlenstoffquelle.
Vorkommen: Verbreitet sind die Citrobacter-Arten in beinahe allen Lebensräumen wie etwa dem Boden, im Wasser und in Abwässern. Außerdem kommen sie als Teil der Darmflora im Magen-Darm-Trakt des Menschen vor.
Krankheitsbilder : Citrobacter sp. spielen eine (geringe) Rolle als als Erreger opportunistischer Infektionen.
Therapie: Carbapeneme oder Chinolone (beide ggf. plus Aminoglykosid), Monobactame und Fosfomycin können für die initiale Therapie angewendet werden.
Serratia marcescens
| Serratia marcescens | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|

Morphologie und Eigenschaften: Serratia marcescens ist ein gramnegatives, fakultativ anaerobes, nicht sporenbildendes, sich aktiv mit peritrich angeordneten Geißeln bewegendes, stäbchenförmiges Bakterium. Es produziert die hydrolytischen Enzyme DNase, Gelatinase und Lipase. Die Bakterien können problemlos auf gängigen Medien kultiviert werden. Sie bilden in der Regel ein rotes Pigment (Prodigiosin, von lateinisch prodigium = Wunderzeichen, siehe unter Historisches), wodurch die Kolonien rot gefärbt sind. Das Genom von Serratia marcescens wurde vom Sanger Institute (Cambridge, Großbritannien) vollständig sequenziert. Es besteht aus einem einzigen in sich geschlossenen DNA-Strang und hat eine Länge von 5,1 MBp.
Vorkommen: S. marcescens kommt ubiquitär im Boden, Wasser, auf Tieren und Pflanzen vor und sind in der Regel harmlose Saprobionten (Destruenten organischer Stoffe).
Krankheitsbilder: Opportunistische Infektionen wie Harnwegsinfekte, Sepsis und Pneumonie.
Therapie: Serratia marcescens bildet oft extended-spectrum-β-Lactamasen (ESBL). Die kalkulierte Therapie kann mit einem parenteralen Cephalosporin der 3. Generation (z.B. Cefotaxim), einem Fluorchinolon (Ciprofloxacin) oder einem Carbapenem begonnen werden.
Historisches: Serratia marcescens wurde 1819 auf verdorbener Polenta von dem Pharmazeuten Bartalomeo Bizio aus Padua entdeckt.
Man schreibt diesem Bakterium das "Wunder von Bolsena" zu. Der Priester Peter von Prag soll nach Zweifeln am Dogma der Transsubstantiation 1263 in Bolsena das Brot für die Kommunion gebrochen und dabei Blutstropfen darauf entdeckt haben. Er soll seine Zweifel gestanden haben und eine Prozession mit Hostien nach Orvieto zu Papst Urban IV. veranstaltet haben. Dieser führte daraufhin das Fronleichnamsfest (Processione del Corpus Domini) ein und ließ den Dom zu Orvieto errichten. Heute nimmt man an, dass die "Blutstropfen" durch Prodigiosin rot gefärbte Kolonien von Serratia marcescens waren (siehe Bild 1), die auf Brot und Hostien einen guten Nährboden finden („Hostienphänomen“) und darauf wachsen, wenn diese Materialien nicht ausreichend trocken gehalten werden. Das Wunder von Bolsena ist auf einem Fresko des italienischen Malers Raffael in den Stanzen des Vatikans (Stanza d'Eliodoro) dargestellt (Die Messe von Bolsena).
Schon bei der Belagerung von Tyros 332 v. Chr. unter Alexander dem Großen sollen "Blutflecken" auf dem Brot der Soldaten aufgetreten sein, die Alexander als Glückszeichen deutete. Auch später kam das Phänomen der "blutenden Hostien" wiederholt vor, vermutlich bei Aufbewahrung von Hostien in Sakristeien, die im Sommer noch kühl sind und deren Luft deshalb eine hohe relative Luftfeuchtigkeit aufweist. Das Phänomen führte unter anderem in Wilsnack (Prignitz) 1383 zu Wallfahrten zum Wilsnacker Wunderblut mit zahlreichen Beteiligten, die etwa 170 Jahre andauerten.
„Blutende“ Hostien wurden auch oft zum Vorwand für Judenverfolgungen genommen. Man warf den Juden vor, sie hätten die Hostien gestochen und so zum Bluten gebracht. Herzog Wenzel von Luxemburg soll 1369 Juden vertrieben haben, weil in Brüssel "Blutflecken" auf Hostien aufgetreten waren.
1825 will man in Enkirch an der Mosel Blut in Mehl gefunden haben.
Der ursprüngliche Name des Bakteriums Bacterium prodigiosum und die Bezeichnung des von ihm gebildeten Farbstoffs Prodigiosin gehen auf den Zusammenhang mit diesen scheinbaren Wundern zurück: lateinisch prodigium "Wunderzeichen".
Salmonellen
| Salmonellen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|

Morphologie und Eigenschaften: Salmonellen sind Gram-negative, 2-3 µm große, sporenlose und vorwiegend bewegliche, peritrich begeißelte, fakultativ anaerobe, kurze Stäbchen aus der Familie der Enterobacteriaceae. Sie sind eng verwandt mit der Gattung Escherichia. Auf Blutagar wachsen rosa, auf Leifson-Agar schwarze Kolonien.
Vorkommen: Salmonellen gehören (bis auf die an den Menschen adaptierten Typhus/Paratyphus-Serovare) zu den Zoonosen, die sowohl Tiere als auch über die Lebensmittelkette den Menschen infizieren und krank machen können. Die Erreger kommen weltweit vor.
- Salmonellen sind außerhalb des menschlichen bzw. tierischen Körpers wochenlang lebensfähig. In getrocknetem Kot sind sie über 2,5 Jahre lang nachweisbar. Durch Hitzeeinwirkung sterben Salmonellen bei 55°C nach 1 Stunde, bei 60°C nach einer halben Stunde ab. Um sich vor einer Salmonellen-Infektion zu schützen wird die Erhitzung des Lebensmittels auf 70°C im Kern für mindestens 10 min. empfohlen. Durch Einfrieren werden die Bakterien nicht abgetötet. In sauren Medien sterben die Bakterien rasch ab. Gebräuchliche Desinfektionsmittel töten die Salmonellen innerhalb weniger Minuten.
Infektionswege:
- Durch Unsauberkeit im Lebensmittelbereich, insbesondere in Großküchen
- Über Ausscheidungen erkrankter, aber auch klinisch gesund erscheinender Menschen und Tiere (gefährdet: andere Tiere, Pflegepersonal)
- Verunreinigtes Oberflächenwasser
- Durch unhygienisch und schlecht aufgetautes Geflügel (viele Bakterien befinden sich im Tauwasser)
- Durch Eier, die von salmonellenpositivem Geflügel stammen
Arten, Subspezies und Serovare - Überblick: Alle humanpathogenen Salmonellen gehören zur Subspezies S. enterica enterica Serovar, i.d.R. abgekürzt als S. Serovar. Man unterscheidet zwischen den Enteritis-Salmonellen und den Typhus/Paratyphus-Salmonellen, wobei letztere aufgrund spezieller Virulenzfaktoren und eines Kapselproteins (Virulenz-Antigen) schwerere Erkrankungen verursachen (z.B. Salmonella enterica enterica Typhi, kurz S. Typhi und S. Paratyphi). S. Typhi kommt beim Tier nicht vor und ist an den Menschen adaptiert.
Gastroenteritis-Salmonellen (z.B. S. enterica enterica Enteritidis, kurz S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Cholerasuis u.a.m) verursachen beim Menschen meist spontan ausheilende Durchfallerkrankungen, die in der Regel nicht antibiotisch behandelt werden müssen. Allerdings können bei Risikogruppen, wie Säuglingen, Kleinkindern, alten Menschen, HIV-Patienten und immungeschwächten Patienten schwere Erkrankungen (Allgemeininfektionen) hervorgerufen werden.
Epidemiologie: In Deutschland gehören Salmonellosen zu den meldepflichtigen Erkrankungen nach §6 bzw. §7 des Infektionsschutzgesetzes. Die amtlichen Meldungen sind seit 1990 von ca. 200.000 auf ca 58.000 Fälle in 2005 zurückgegangen. Fälle von Typhus und Paratyphus belaufen sich in Deutschland auf etwa 200-300 pro Jahr.
Historie und Nomenklatur:
- 1880 wurde der Erreger des Typhus abdominalis beim Menschen von Karl Joseph Eberth und Robert Koch entdeckt.
- 1884 gelang Georg Gaffky die Züchtung des Erregers in Reinkultur.
- 1885 fand Daniel Elmer Salmon, nach dem die Gattung Salmonella benannt wurde, die "Schweinecholera"-Bakterien.
Die Nomenklatur der Salmonella-Arten ist traditionell gewachsen. In der Fleischbeschau und Lebensmittelüberwachung werden Salmonellen auch als "Fleischvergifter" bezeichnet.
Die meisten „Salmonellenarten“ sind nach heutiger Kenntnis lediglich Serovare der Art Salmonella enterica. Es gibt nach dem Kaufmann-White-Schema insgesamt mehr als 2.500 Salmonellen-Serovare, die sich aufgrund des Vorkommens von unterschiedlichen O- und H-Antigenen unterscheiden. Die O-Antigene bestehen aus den Lipopolysacchariden (LPS) der Zellwand (O, da ohne hauchförmiges Wachstum in Kultur) und die H-Antigene aus den Proteinbausteinen der Flagellen (H für hauchförmiges Wachstum), mit denen sich die Salmonellen fortbewegen können. Zusätzlich verfügen einige Arten über ein Kapselantigen (K-Antigen) und Fimbrien bzw. Pili (F-Antigen).
Pathogenitäts- und Viruenzfaktoren:
- O-Antigen (= somatisches Antigen), lokalisiert in der Zellwand, Lipopolysaccharide, thermostabil, Formaldehydunbeständig -> Endotoxine
- H-Antigen (= Geißelantigen), thermolabil, Formaldehydbeständig ->Beweglichkeit
- K-Antigen (= Kapselantigen), besteht aus 3 Fraktionen mit unterschiedlicher Wärmeempfindlichkeit und wird der Zellwand zugerechnet -> Phagozytoseschutz
- F-Antigen (= Fimbrienantigen) -> Anheftung
Subspezies (früher: Subgenus I - VII)
- S. enterica enterica, vereint die Serovare mit Bedeutung für den Menschen und homoiotherme Tierarten (Enteritische und Typhus/Paratyphus-Gruppe)
- S. enterica salamae
- S. enterica arizonae
- S. enterica diarizonae
- S. enterica houtenae
- S. enterica indica
Epidemiologische Gruppen:
Einordnung der Serovare nach der Anpassung an bestimmte Wirte
- An den Menschen angepasste Serovare, die bei diesem Typhus oder Paratyphus verursachen (z.B. S. Typhi, S. Paratyphi A, B und C).
- An bestimmte Tierarten angepasste Serovare, die tierspezifische Erkrankungen hervorrufen und für andere Tierarten und den Menschen nicht von Bedeutung sind S. Dublin (Rind), S. Choleraesuis (Schwein), S. Abortusovis, S. Abortusequi (Schaf, Pferd).
- Serovare ohne spezielle Wirtsanpassung, die bei allen Tierspezies als Erreger von Enteritiden auftreten und beim Menschen Lebensmittelvergiftungen hervorrufen.
- Serovare ohne spezielle Wirtsanpassung, die bei Mensch und Tier als Erreger von Salmonellosen auftreten und eine hohe Virulenz besitzen.
Medizinisch bedeutsame Vertreter:
- S. Arizonae, bei Kaltblütern, Geflügel, Säugetieren
- S. Choleraesuis (Bacillus Paratyphus B und C), Darmkommensale des Schweines, pathogen bei Immunschwäche; Menschen können sich durch den Verzehr vom Fleisch erkrankter Schweine infizieren.
- S. Enteritidis, Vorkommen im Darm von Rindern, Nagern, Enten (auch deren Eiern) und Menschen; Erreger des Kälberparatyphus und akuter Gastroenteritis des Menschen.
- S. Paratyphi
- S. Paratyphi A, rein humanpathogen, Erreger des "Paratyphus A" (Paratyphöse Gastroenteritis), Übertragung durch Kontakt und infektiöse Lebensmittel oder Wasser.
- S. Paratyphi B, in Mitteleuropa meist humanpathogen, Erreger des "Paratyphus B", Übertragung durch Kontakt und infektiöse Lebensmittel, Wasser oder Fliegenkot.
- S. Typhi, Vorkommen in gemäßigten und subtropischen Zonen, humanpathogener Erreger des Typhus abdominalis, Übertragung durch Kontakt und infektiöse Lebensmittel, Wasser oder Fliegenkot. 3 - 5 % aller Erkrankten bleiben Dauerausscheider.
- S. Typhimurium, Erreger einer meist tödlich verlaufenden, fieberhaften Darminfektion bei Vögeln und Säugetieren, durch kontaminierte Lebensmittel. Auslöser der Salmonellenenteritis ("Lebensmittelvergiftung") des Menschen.
Diagnostik: Kultur aus Stuhl (Selektivmedien wie Leifson, XLD-Agar), Blut oder Gewebe. Differenzierung biochemisch, per Gruber-Agglutination (Antigen- bzw. Erregernachweis) oder Widal-Agglutination (serologischer Antikörper-Nachweis).
Salmonellose
Epidemiologie: Im Gegensatz zu S. Typhi und S. Paratyphi, deren einziger bislang bekannter Wirt der Mensch ist, sind die übrigen Salmonellen-Serotypen Zoonosen und sind in tierischen Produkten (Fleisch, Milch, Eiern, Muscheln, etc.) zu finden. Darüber hinaus können Salmonellen auch bei der Schlachtung und Verarbeitung durch mangelhafte Hygiene und durch Salmonellenausscheider im Personal auf Lebensmittel übertragen werden. Durch den Kot infizierter Tiere und Menschen verunreinigtes Trinkwasser ist demgegenüber in Ländern mit ungenügenden hygienischen Standards die wichtigste Infektionsquelle. Die Infektionsdosis für einen gesunden erwachsenen Menschen liegt bei 10.000 bis 1.000.000 Keimen. Bei Abwehrschwäche bzw. Säuglingen, Kleinkindern und alte Menschen wurden auch Erkrankungen bereits bei Infektionsdosen unter 100 Keimen beobachtet.
In den USA hat sich die Erkrankungsrate in den letzten 25 Jahren verdoppelt. Insgesamt wird vor allem eine Zunahme der Infektionen durch kontaminierte Hühnereier beobachtet. Ursache ist, dass S. Enteritidis bei Hühnern Infektionen der Tuben und Ovarien verursacht, so dass die Eier die Erreger schon enthalten, bevor sich eine Schale bildet. Zusätzlich können die Keime v.a. bei hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Umgebungstemperatur auch dünne oder beschädigte Eischalen durchwandern.
In der Schweiz ist die Anzahl der an das Bundesamt für Gesundheit gemeldeten Fälle seit 1999 rückläufig. In Deutschland erkrankten im Jahr 2003 ca. 63.000 und im Jahr 2004 ca. 57.000 Menschen an einer gesicherten Salmonellen-Infektion, womit sich der seit 1992 rückläufige Trend fortsetzte. 2004 wurden 52 bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit einer solchen Infektion gemeldet. Das Nationale Referenzzentrum für Krankenhaushygiene (NRZ) schätzt zumindest in den Jahren 1999 und 2000, dass dabei weiterhin etwa 10 % der tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle gemeldet wurden. Die Serovare S. Enteritidis und S. Typhimurium sind die am häufigsten nachgewiesenen Erreger.
Krankheitsbilder: Die Symptome einer Salmonellen-Infektion im engeren Sinn sind Erbrechen und Durchfall (Gastroenteritis). Diese können wenige Stunden bis drei (maximal sieben) Tage nach dem Verzehr des befallenen Lebensmittels auftauchen. (Die mittlere Inkubationszeit beträgt 20-24h.) Die Erkrankungdauer beträgt in der Regel nur wenige Stunden oder Tage. In diesen unkomplizierten Fällen erfolgt keine antibiotische Behandlung - einerseits um die weitere Entwicklung multiresistenter Stämme zu verhindern, andererseits, da dadurch die Bakterienausscheidung verlängert werden kann.
Bis zu 5% der Infizierten erleiden systemische Verläufe mit Fieber zwischen 38 und 39°C, massiven Flüssigkeitsverlusten, rascher Gewichtsabnahme und der Notwendigkeit stationärer Einweisung und antibiotischer Therapie. Gefährdet sind hier v.a. Kinder, ältere und immungeschwächte Personen.
Als problematisch ist zu betrachten, dass man durch bestimmte Salmonellenstämme zum Dauerausscheider werden kann.
Diagnostik:
- Erregernachweis: Blutkultur (erste Woche nach der Infektion), Gruber-Widal-Reaktion (serologischer Antikörpersuchtest) (zweite Woche), Anzucht aus Stuhl (dritte Woche)
- Differenzierung: Die Abgrenzung gegen Shigellen und Proteus gelingt auf Selektivnährmedien (XLD-Agar, Hectoen-Agar).
- Die Identifizierung des Subtyps erfolgt über die Grubersche Antigenanalyse: Nachdem die isolierten Keime zunächst mit einer omnivalenten Antikörper-Suspension (Typhus-Paratyphus-Enteritidis-Serum, kurz: TPE-Serum) vorgetestet wurden, folgen gruppenspezifische Antikörper-Suspensionen und zuletzt monospezifische Antikörper. Schrittweise lässt sich so der Erreger in das Kaufmann-White-Schema einordnen, was für epidemiologische Aspekte sinnvoll ist.
Als Parameter für die Einteilung werden die O-Antigene (somatische Antigene), die spezifisch für jeden Subtyp sind, herangezogen.
Therapie: Die Therapie ist primär symptomatisch, eine Antibiose kann die Erregerausscheidung verlängern. Bei invasiven Verläufen, Patienten unter einem Jahr oder mit schweren Grunderkrankungen ist eine Antibiose indiziert, z.B. mit Cotrimoxazol. Die Resistenzbestimmung ist auch hier obligat.
Prophylaxe: Salmonellen vermehren sich bei Temperaturen von 10 bis etwa 50°C. Die Lagerung von rohen Lebensmitteln im Kühlschrank (bei ca. 4-7°C) verhindert ein übermäßiges Ausbreiten der Erreger. Sie werden nur sicher abgetötet, wenn im Inneren des Lebensmittels für mindestens 10 Minuten Temperaturen von über 70°C erreicht werden. Salmonellen vermehren sich zwar nicht bei der Tiefkühllagerung, überleben aber. Deshalb muss bei Lebensmitteln wie Geflügel die Auftauflüssigkeit weggeschüttet werden. Eier sollen gekocht oder gebraten werden, bis das Eigelb fest ist. Industriell gefertigte Eiprodukte müssen pasteurisiert werden.
Meldepflicht: Erkrankungsfälle sind meldepflichtig, da allerdings nicht bei jedem Brechdurchfall eine Erregerbestimmung durchgeführt wird, wird geschätzt, dass maximal 5-10% der Erkrankungsfälle auch gemeldet werden.
Weblinks: RKI - Salmonellose
Typhus
Als (deutsch) Typhus (von (griech.) typhos: Dunst, Nebel, Schwindel), auch Bauchtyphus oder typhoid fever genannt, werden schwere fieberhafte Infektionskrankheiten bezeichnet, welche meist mit Durchfall verbunden sind und durch Salmonellen (Salmonella enteritica enterica Serovar Typhi, kurz S. Typhi) hervorgerufen wird. Unbehandelt können die Krankheiten zum Tod führen. In Deutschland und Österreich sind sowohl der Verdacht als auch Erkrankung und Tod an Typhus meldepflichtig.
Epidemiologie:: Der Erreger des Typhus abdominalis, einer zyklischen Allgemeininfektion, S. Typhi wird fäkal-oral übertragen z.B. durch verunreinigtes Wasser und Nahrungsmittel und ist vor allem in Entwicklungsländern verbreitet. Fälle in den Industrienationen sind meist durch Fernreisen eingeschleppt. Bei Reisen in tropische Gebiete (z.B. Indien) sollte eine Immunisierung erwogen werden, die jedoch nur einen partiellen Schutz bietet. Weltweit erkranken jährlich etwa 16 Millionen Menschen.

Klinik: Die Inkubationszeit beträgt durchschnittlich 10 Tage, Extremwerte von 3 bis zu 60 Tagen sind beobachtet worden. Es kommt zunächst zu unspezifischen Allgemeinsymptomen wie Mattigkeit und Kopfschmerzen sowie zu einem treppenförmigem Fieberanstieg. Nach ca. 8 Tagen wird ein Stadium von anhaltendem hohen Fieber (40 bis 41°C) erreicht, das über Wochen andauern kann (Fieberkontinuum). Dabei findet sich eine relative Bradykardie (relativ zur Körpertemperatur zu niedrige Herzfrequenz). Hinzu kommen bisweilen Bewusstseinsstörungen (daher der Name), Splenomegalie, ein rötlich-fleckförmiges Exanthem am Oberkörper und der charakteristische erbsenbreiartige Durchfall. Darmperforationen, Haarausfall, Knocheneiterungen und Meningitis sind möglich. Während der langen Genesungsphase sinkt das Fieber stufenweise ab.
In der Folge bleiben einige Erkrankte (ca. 5%) Dauerausscheider der Salmonellen, da diese in der Gallenblase und den Gallenwegen persistieren. Diese Personen können, ohne selbst noch Krankheitszeichen zu zeigen, etliche andere anstecken.
Diagnostik: Die Stellung der Diagnose stützt sich auf die typische Klinik zusammen mit der Anamnese (Reise in tropische Regionen), Blutbild (Leukozytose, Eosinophilie) und den Erregernachweis durch Blutkulturen oder aus dem Stuhl. Im Serum lassen sich auch spezifische Antikörper nachweisen.
Therapie: Bei der antibiotischen Therapie finden unter anderem Gyrasehemmer (Ciprofloxazin) und parenterale Cephalosporine der 3. Generation Anwendung. Ferner sind Amoxicillin plus BLI und Cotrimoxazol geeignet. Wichtig ist zudem die Substitution der Wasser- und Elektrolytverluste durch die Durchfälle. Dauerausscheidern ist eine Cholezystektomie zu empfehlen. Bei adäquater Behandlung liegt die Sterblichkeit unter 1 %.
Prophylaxe: Hygiene ist der beste Schutz. Die auf Tropenreisen üblichen Maßnahmen, das heißt der Verzicht auf unzureichend gegarte Speisen und Leitungswasser, sollten auf jeden Fall beachtet werden. Obst, das unmittelbar vor dem Verzehr geschält wurde, ist sicher. Die Impfprophylaxe bietet nur einen Schutz von 60-75 %, mildert aber im Erkrankungsfall den Verlauf.
Meldepflicht: Typhus muss bei Verdacht, Erkrankung oder Tod dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Auch Dauerausscheider sind meldepflichtig.
Typhus levissimus / Typhus ambulatorius: Diese Krankheit wird heute im deutschen Sprachraum als Fleckfieber geführt. Dass es sich um eine eigenständige Erkrankung handelt, entdeckte 1847 William Jenner in London. Im angloamerikanischen Sprachraum ist das deutsche „Fleckfieber“ nach wie vor der „typhus“ und der deutsche „Typhus“ das „typhoid fever“.
Weblinks: RKI - Typhus
Paratyphus
Als Paratyphus bezeichnet man ein abgeschwächtes Krankheitsbild des Typhus, verursacht durch den Erreger Salmonella enterica enterica Paratyphi A, B, oder C, kurz S. Paratyphi A, B, oder C. A und C kommen überwiegend in wärmeren Klimazonen vor, während B weltweit verbreitet ist. Paratyphus ist eine zyklische Allgemeininfektion. Die Erkrankung ist meldepflichtig.
Pathogenese: Die Ansteckung erfolgt fäkal-oral durch verunreinigte Nahrungsmittel und Trinkwasser oder über Schmierinfektion. Die Inkubationszeit beträgt 1-2 Wochen. Die Symptome sind ähnlich wie beim Typhus:
- Mattigkeit, Kopfschmerzen.
- Typischer Hautausschlag (Roseolen) im Brust- und Bauchbereich.
- Treppenförmiger Fieberanstieg.
- Nach etwa acht Tagen anhaltend hohes Fieber (40 bis 41°C), manchmal wochenlang.
- Komplikationen: Bewusstseinsstörungen, Milzschwellung, Durchfall, Darmdperforation, Haarausfall, Knocheneiterungen, Meningitis.
- Stufenweises Absinken des Fiebers mit langer Rekonvaleszenz.
Diagnostik: Die Diagnostik erfolgt in der ersten und zweiten Krankheitswoche über eine Blutkultur, ab der zweiten Woche sind die Erreger im Stuhl nachweisbar. Es kommt zu einem deutlichen Anstieg von Antikörpern.
Therapie: Antibiotika über zwei Wochen. Zur Kontrolle des Therapieerfolgs wird der Stuhl auf Salmonellen untersucht. Einige Patienten entwickeln sich zu Dauerausscheidern.
Meldepflicht: Paratyphus muss bei Verdacht, Erkrankung oder Tod dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Auch Dauerausscheider sind meldepflichtig.
Weblinks: RKI - Paratyphus
Yersinien
Wichtige Spezies:
- Y. enterocolitica ist der Erreger der enteralen Yersiniose, einer fieberhaften Enterocolitis oder Enteritis als Folge einer Nahrungsmittelvergiftung. Häufig treten Begleitscheinungen wie Erythema nodosum, eine Yersinia-Arthritis oder die Reiter-Krankheit mit Ekzemen der Handinnenflächen und der Fußsohlen auf. Therapeutisch können Ciprofloxacin, Doxycyclin und Cotrimoxazol eingesetzt werden.
- Y. pseudotuberculosis ist der Erreger der Pseudotuberkulose
- Y. pestis ist der Erreger der Pest
Yersiniosen können mit Chloramphenicol, Tetracyclinen oder Cotrimoxazol behandelt werden.
Yersinia pestis
| Yersinia pestis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Yersinia pestis wurde von Alexandre Émile Jean Yersin 1894 entdeckt und ursprünglich nach Louis Pasteur Pasteurella pestis getauft, später jedoch Yersin zu Ehren umbenannt.
Morphologie und Eigenschaften: Yersinia pestis ist ein Gram-negatives, unbegeißeltes, sporenloses, fakultativ anaerobes Stäbchenbakterium. Es zählt zu den Enterobakterien und ist der Erreger der Lungen- und Beulenpest. Mit einigen weiteren Bakterien bildet es die Gattung Yersinia.
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Extotoxine
- Endotoxine
- Kapselbildung
Krankheitsbilder: Die Pest (pestis (lat.): Seuche) ist eine ansteckende Krankheit, die in mehreren großen Pandemien wiederholt erhebliche Teile der Weltbevölkerung betraf, wodurch die Menschheitsgeschichte nachhaltig beeinflusst wurde. Den Verlauf der europäischen Geschichte prägte vor allem eine große Pestepidemie im 14. Jahrhundert, die als "Schwarzer Tod" zwischen 1347 bis 1353 schätzungsweise 25 Millionen Todesopfer forderte, was einem Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung entsprach.
Da jedoch zu dieser Zeit noch jegliche Mittel zur exakten Diagnose der Krankheit sowie eindeutig verwertbare Augenzeugenberichte fehlten, ist nicht zweifelsfrei erwiesen, dass es sich bei der damaligen Epidemie um einen Ausbruch der Pest im eigentlichen Sinne (durch Yersinia pestis) handelte oder vielleicht eher um ein virales hämorrhagisches Fieber, wie manche Forscher glauben.
Verlaufsformen der Pest: Man unterscheidet vier Erscheinungsformen der Pest: Beulenpest auch Bubonenpest genannt (bubo (gr.): Beule), Pestsepsis, Lungenpest sowie die abortive Pest. Bei Pandemien treten alle Formen der Erkrankung auf, am häufigsten jedoch die Beulenpest und die Lungenpest. Aus einer Beulenpest entwickelt sich ohne Behandlung fast immer eine Pestsepsis, die zu einer Lungenpest führt.
Beulenpest
Bei der Beulenpest erfolgt die Ansteckung gewöhnlich durch den Biss eines Rattenflohs, der den Erreger als Zwischenwirt in sich trägt. Durch den Wirtswechsel wird das Bakterium von einem infizierten auf ein bislang gesundes Wirtstier übertragen, nachdem es sich im Floh vermehrt hat.
Als stationärer Parasit ist der Rattenfloh eigentlich eng an sein Wirtstier gebunden. Er befällt den Menschen erst dann, wenn er keinen geeigneten Wirt mehr findet. Daher ging zumindest der Beulenpest immer ein massenhaftes Rattensterben voraus.

Die Inkubationszeit liegt bei wenigen Stunden bis sieben Tagen. Die Symptome sind Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, starkes Krankheitsgefühl und Benommenheit. Später kommt es zu Bewusstseinsstörungen. Der Name Beulenpest stammt von den stark geschwollenen, sehr schmerzhaften Beulen am Hals, in den Achselhöhlen und in den Leisten, die durch die Infektion der Lymphknoten und Lymphgefäße im Bereich des Flohbisses entstehen. Diese Beulen können bis zu zehn Zentimeter groß werden und sind aufgrund von Einblutungen blau-schwarz gefärbt. Die Geschwüre zerfallen, nachdem sie eitrig eingeschmolzen sind.
Die Beulenpest als solche ist nicht tödlich und die Beulen sind nach Öffnung heilbar. Allerdings kommt es bei bis zu 75 % der unbehandelten Patienten zur Pestsepsis und auch zur Lungenpest oder zu einer Streuung der Erreger mit ausgedehnten Hautblutungen. Diese Formen führen unbehandelt zum Tod.
Die Beulenpest verbreitet sich im Winter langsamer als im Sommer, da der Überträgerfloh bei Temperaturen unter 12°C in eine Kältestarre fällt. Der epidemische Höhepunkt dieser Pestart fiel stets mit der Fortpflanzungszeit der Flöhe im Herbst zusammen.
Pestsepsis
Die Pestsepsis entsteht durch Infektion von außen, zum Beispiel über offene Wunden oder als Komplikation der beiden anderen schweren Verlaufsformen. Die Infektion bewirkt hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und ein allgemeines Unwohlsein, später großflächige Haut- und Organblutungen. Die Pestsepsis ist unbehandelt immer tödlich, in der Regel spätestens nach 36h. Heute kann durch die Behandlung mit Antibiotika die Sterblichkeit deutlich gesenkt werden.
Lungenpest
Wenn die Erreger bei einer Beulenpest über die Blutbahn im Verlaufe einer Pestsepsis in die Lunge geraten, spricht von sekundärer Lungenpest. Wird sie durch eine Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen, spricht man von primärer Lungenpest.

Die Lungenpest verläuft heftiger als die Beulenpest, weil die Abwehrbarrieren der Lymphknoten durch direkte Infektion der Lunge umgangen werden. Sie beginnt mit Atemnot, Husten, Blaufärbung der Lippen und schwarz-blutigem Auswurf, der extrem schmerzhaft abgehustet wird. Daraus entwickelt sich ein Lungenödem mit Kreislaufversagen, welches unbehandelt nach zwei bis fünf Tagen zum Tod führt.
Die Inkubationszeit beträgt nur ein bis zwei Tage, die Sterblichkeitsrate liegt hier bei 95%.
Abortive Pest
Die abortive Pest ist die harmloseste Variante der Pest. Sie äußert sich meist nur in leichtem Fieber und leichter Schwellung der Lymphknoten. Nach überstandener Infektion werden Antikörper gebildet, die eine lang anhaltende Immunität gegen alle Formen der Krankheit gewährleisten.
Übertragungswege:
- „Am Morgen des 16. April trat der Arzt Bernard Rieux aus seiner Wohnung und stolperte mitten auf dem Flur über eine tote Ratte (...) Am selben Abend sah er aus dem Dunkel des Gangs eine dicke Ratte auftauchen, mit feuchtem Fell und unsicherem Gang. Das Tier blieb stehen, schien sein Gleichgewicht zu suchen, wendete sich gegen den Arzt, blieb wieder stehen, drehte sich mit einem leisen Schrei im Kreis und fiel schließlich zu Boden, wobei aus den halb geöffneten Lefzen Blut quoll...“
Mit diesen Zeilen leitet der französische Literaturnobelpreisträger Albert Camus seinen 1947 erschienenen Roman "Die Pest" ein. Wenn das Werk Camus auch fiktiv ist, so beschreibt er doch treffend das große Rattensterben, das einer Pestepidemie vorauszugehen pflegt. Flöhe, insbesondere der Rattenfloh Xenopsylla cheopsis spielen bei der Übertragung des Pesterregers auf den Menschen eine entscheidende Rolle.

Mit Y. pestis infizierte Flöhe übertragen die Erkrankung beim Wirtswechsel z.B. von der Wanderratte oder der Hausratte auf den nächsten Wirt. Der Rattenfloh bevorzugt dabei als neuen Wirt wiederum Ratten, für die die Pesterkrankung ebenso tödlich ist wie für den Menschen. Fehlt es an Ratten, nimmt der Rattenfloh auch Menschen als neue Wirte an und infiziert dann auch diese mit der Zoonose. Etwa 30 Floharten sind als Überträger von Pestbakterien denkbar, darunter auch der Menschenfloh (Pulex irritans). Das Pestbakterium kann darüber hinaus längere Zeit auch ohne tierischen Wirt überleben – beispielsweise in Erde, Staub, Kot oder in Tierkadavern.
Neben der indirekten Ansteckung durch den Floh als Zwischenwirt ist die direkte Ansteckung an infizierten Nagetieren oder Menschen über offene Wunden und Speichel möglich. Gelangt der Erreger in den Lungenkreislauf entsteht die sekundäre Lungenpest mit hochinfektiösem blutigem Auswurf, die auf Kontakpersonen als primäre Lungenpest übertragen werden kann. Ist der Sprung des Pestbakteriums aus einer Nagerpopulation auf den Menschen erst einmal vollzogen, stellt die direkte Ansteckung sehr rasch den hauptsächlichen Infektionsweg dar. Bereits 100 bis 200 eingeatmete Erreger genügen für eine Infektion.
Auch Raubtiere, die infizierte Ratten gefressen haben, können Bakterien und Flöhe übertragen. Hauskatzen erkranken ebenfalls an der Pest, von Hunden ist dies jedoch nicht bekannt. Diese Übertragungswege sind im Normalfall selten, spielen jedoch im Rahmen von größeren Pandemien eine Rolle.
Wilde Nagetierpopulationen als Rückzugsgebiet des Pestbakteriums

Die Pestbakterien kommen auch heute noch in wild lebenden Nagetierpopulationen vor – wie beispielsweise bei den Präriehunden, Erdhörnchen und Murmeltieren. Diese Populationen sind die natürlichen Reservoire des Pestbakteriums, von denen aus gelegentlich häusliche Nager wie beispielsweise Ratten infiziert werden.
Während in Europa und Australien keine infizierten Tierpopulationen bekannt sind, kommen solche im Kaukasus, in Russland, in Südostasien, der Volksrepublik China, der Mongolei, Süd- und Ostafrika, Mittel- und Südamerika sowie im Südwesten der USA vor.
Nach Nordamerika gelangte der Erreger dabei über ein Handelsschiff während einer Pestepidemie, die ab 1894 in Südostasien grassierte. Obwohl nur sehr wenige Menschen in Nordamerika an der Pest erkrankten, infizierte der Erreger die amerikanische Eichhörnchenpopulation. Gelegentlich kommt es daher auch heute noch in Nordamerika zu Übertragungen von Tier zu Mensch. Meist sind es Jäger, die sich bei einem Nagetier anstecken; Norman F. Cantor verweist jedoch auch auf einen nordamerikanischen Fall aus den 1980er Jahren, bei dem eine Frau ein Eichhörnchen mit einem Rasenmäher überfuhr und sich dabei mit der Pest infizierte.
Der Pestausbruch in der indischen Stadt Surat im Jahre 1994 bestätigt daher die Aussage, die Camus bereits 1947 gegen Ende seines Romans Die Pest macht:
- „Während Rieux den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empor drangen, erinnerte er sich daran, dass diese Fröhlichkeit ständig bedroht war. Denn er wusste, was dieser frohen Menge unbekannt war und was in den Büchern steht: Dass der Pestbazillus niemals ausstirbt oder verschwindet, sondern jahrzehntelang in den Möbeln und der Wäsche schlummern kann, dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung des Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird (...)“
Weltweit registriert die WHO etwa 1.000 bis 3.000 Pestfälle pro Jahr, meistens in Form kleinerer, örtlich begrenzter Epidemien. In Europa gab es den letzten dokumentierten Pestausbruch im Zweiten Weltkrieg. Man nimmt an, dass die Pest gegenwärtig in Europa nicht mehr existiert.
Diagnostik: Der mikrobielle Nachweis wird unter BSL-3-Bedingungen aus Sputum, Blut oder Bubonenaspirat erhoben durch Kultur, Giemsa-/Wright-Färbung (bipolar) und Nachweis des F1-Kapselantigens. Antikörper lassen sich ab dem zehnten Krankheitstag nachweisen.
Therapie: Die Pest wird mit älteren Aminoglykosiden (Streptomycin) plus Doxycyclin, alternativ mit Cotrimoxazol behandelt. Die Heilungsaussichten sind gut.
Prophylaxe: Es stehen Schutzimpfungen zur Verfügung, die allerdings eine Immunität lediglich für drei bis sechs Monate gewähren und dies auch nur bei der Beulenpest, nicht aber bei der Lungenpest. Die Autoren Eberhard-Metzger und Ries weisen jedoch auf die schlechte Verträglichkeit dieser Schutzimpfungen hin. Die WHO empfiehlt die Impfung daher nur Risikogruppen, zu denen beispielsweise Bauern, Landarbeiter und Jäger in Regionen zählen, in denen infizierte Nagetierpopulationen verbreitet sind.
Weitere Maßnahmen, um eine Pestepidemie einzudämmen, sind verbesserte Hygiene, Bekämpfung der Ratten und die Verhinderung des Transports von Ratten auf Schiffen. Da nach dem Tod der Ratten die Flöhe ihren Wirt wechseln, müssen die Menschen mit Insektiziden vor den Flöhen geschützt werden.
Quarantäne und Meldepflicht: Die Pest gehört neben den Pocken, Cholera und dem Hämorrhagischen Fieber in Deutschland zu den vier Quarantäne-Krankheiten. Patienten, die daran erkrankt sind, müssen in speziellen Infektionsabteilungen abgeschirmt werden. Länderübergreifende Quarantäneregelungen für Schiff-, Luft-, Zug- oder Kraftfahrzeugverkehr sind im internationalen Sanitätsreglement von 1971 festgehalten. Verdacht, Erkrankung und Tod durch Pest sind meldepflichtig nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Meldungen werden von den Gesundheitsämtern an die Landesgesundheitsbehörde und das Robert-Koch-Institut weitergeleitet. Das Robert-Koch-Institut meldet sie gemäß internationalen Vereinbarungen an die WHO.
Die Pest als biologische Waffe: Die Pest wird von der WHO zu den zwölf gefährlichen biologischen Kampfstoffen gezählt. Zu diesem sogenannten „schmutzigen Dutzend“ gehören neben der Pest auch Milzbrand-, Tularämie-, Pocken-, Ebola- und Marburg-Erreger.
Der erste historisch belegte Einsatz der Pest als biologische Waffe fand 1346 in der russischen Hafenstadt Kaffa statt, als der Tartarenführer Khan Djam Bek Pestleichen über die Mauern der Stadt werfen ließ und die Belagerten vor der Pest die Flucht ergriffen.
Während des zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges stellte die japanische Armee im "Einheit 731" genannten Gefangenenlager bei Harbin in der Mandschurei Waffen her, die mit Pest infizierte Flöhe enthielten und deren Einsatz in der Republik China in den Jahren 1940 bis 1942 lokale Pestausbrüche verursachten. Bei der Zerstörung der Produktionsstätten durch die japanische Armee 1945 bei Kriegsende kamen mit Pest infizierte Ratten frei und lösten in den Provinzen Heilongjiang und Jilin eine Epidemie mit über 20.000 Todesopfern aus.
Die USA setzten Pesterreger als biologische Waffe im Koreakrieg ein.
Zur Zeit des Kalten Krieges beschäftigten sich russische Wissenschaftler mit dem Einsatz von Pesterregern als biologische Waffe. Wie der ehemalige russische Forscher für biologische Waffen Ken Alibek berichtete, gelang es Russland Ende der 1980er Jahre, die Pest in eine sprühfähige Form zu bringen und gegen Antibiotika resistent zu machen.
In Deutschland beschäftigt sich das Robert-Koch-Institut mit den Gefahren durch biologische Kriegsführung. Dort wurde auch die Informationsstelle des Bundes für biologische Sicherheit (IBBS) eingerichtet. Wie groß die Gefahr eines Angriffs mit biologischen Kampfstoffen tatsächlich ist, ist umstritten. Die IBBS rät nicht zu einer Impfung gegen die Pest in Deutschland. Diese Empfehlung gilt sowohl für die Bevölkerung insgesamt als auch für Risikogruppen.
Geschichte:
Pest, Pocken und Milzbrand
Große Pandemien sind bereits aus der Bibel überliefert: Die Pest gehört zu den Plagen, die in der biblischen Erzählung Ägypten heimsuchen, und sie löst auch das Massensterben der Philister aus, die sich der jüdischen Bundeslade bemächtigt hatten. Da jegliches Mittel zur Diagnostik ebenso wie eindeutig verwertbare Augenzeugenberichte fehlten, ist nicht zweifelsfrei erwiesen, dass es sich bei den Pandemien, die uns aus der Zeit bis zum späten Mittelalter überliefert wurden, wirklich um Pestausbrüche handelte. Historiker nennen eine Vielzahl möglicher anderer Krankheiten. Das Spektrum reicht von Ebola-ähnlichen Krankheiten, Pocken, einer durch Kühe übertragenen Milzbrand-Infektion bis zu Gonorrhoe. Was die Ansteckungswege und die Symptomatik betrifft, kommen als Alternative zur Pest neben den Pocken eher Fleckfieber, Cholera und Typhus in Frage.
Letztendlich stammt das Wort Pest vom lateinischen pestis und bedeutet wie auch das griechische loimós nichts anderes als Seuche. Es steht darüber hinaus für Unglück, Verderben, verderbliche Person oder Sache, Scheusal, Unhold, Qual, Leiden, Hungersnot. Die klassischen Texte, vom altorientalischen Gilgamesch-Epos (um 1800 v.Chr.), von der Aeneis über die Ilias bis zur Bibel, bezeichnen daher alle großen Seuchen als Pest. Von den im nachfolgenden genannten Krankheitswellen sind viele Historiker jedoch überzeugt, dass Auslöser der Epidemien tatsächlich der Pesterreger war.
Antike bis Frühmittelalter
Die große Seuche im antiken Griechenland
Eine Seuche, der viele Menschen zum Opfer fielen, wurde bereits im antiken Griechenland um 430 v. Chr. von Thukydides ausführlich beschrieben. Thukydides berichtet, wie die Krankheit, die jäh in einer entscheidenden Phase des Peloponnesischen Krieges auftrat, im mit Kriegsflüchtlingen überbevölkerten Athen zu wüten begann.
- "Die Körper lagen, während sie verendeten, einer über dem anderen; einige wälzten sich, nach Wasser lechzend, auf den Wegen, die zu den Brunnen führten, halb tot auf der Erde. Die geweihten Stätten, in denen man sich eingerichtet hatte, lagen voller Leichen, die Menschen waren da gestorben, wo sie sich hinbegeben hatten. Vor einer solchen Entfesselung des Leids achteten sie, da sie nicht wußten, was aus ihnen würde, überhaupt nichts mehr, nicht göttliche, nicht menschliche Ordnung." (Thuk. II 52)
Perikles, der berühmte athenische Feldherr und Politiker, starb laut Thukydides an den Folgen der Seuche, ebenso wie eine große Anzahl anderer Athener. Diodor schätzte, dass Athen damals ein Drittel seiner Bevölkerung verlor.
Zwei Jahre lang wütete die Epidemie in Athen und trug mit zu Athens Niederlage im Peloponnesischen Krieg bei, den Athen gegen Sparta führte.
Ob dieser Seuche durch Pesterreger ausgelöst wurde, ist heute jedoch umstritten. Viele Historiker unterstellten lange Zeit, dass es sich hierbei entweder um die Pest oder um die Pocken handelte. Da Thukykides jedoch die typischen Charakteristika wie die Pestbeulen und die schwärzlichen Flecken auf der Haut nicht beschrieb und die beschriebenen Symptome in ihrer Gesamtheit auf keine heute bekannte Krankheit passen, wurden von Historikern und Medizinern lange Zeit auch andere Erreger diskutiert.
Bei neuen Grabungen unter der Leitung des Archäologen Manolis Papagrigorakis konnten als Erreger inzwischen Typhus-Bakterien identifiziert werden. Um Spuren des Keimes zu finden, öffneten die Archäologen ein Grab auf dem antiken Friedhof Kerameikos in Athen und bargen hieraus drei Zahnwurzeln aus der Anfangszeit der Tragödie. In mehreren Gentests konnten sie in den Zahnresten das Erbmaterial von Typhus-Bakterien nachweisen.
Typhus verbreitet sich vor allem unter schlechten hygienischen Bedingungen. Sie ist extrem ansteckend, löst heftigen Durchfall und starkes Fieber aus. In Athen führte der Ausbruch der Epidemie zu einem dramatischen Bevölkerungsrückgang und einem Zusammenbruch des sozialen Gefüges mit fatalen wirtschaftlichen Konsequenzen und einem militärischen und politischen Niedergang - durchaus vergleichbar mit den Auswirkungen späterer, eindeutig belegter Pestepidemien.
Die Pest im Römischen Reich
Auch das Römische Reich wurde mehrfach von großen Epidemien getroffen. Die erste war die so genannte "Antoninische Pest" zur Zeit des Kaisers Marc Aurel (161–180), die von den aus den Partherkriegen 166 zurückkehrenden Soldaten verbreitet wurde. Ob es sich bei dieser Epidemie um die Pest handelte, ist allerdings ebenfalls unklar. Pestwellen mit tiefgreifenden Auswirkungen auf das Römische Reich traten insbesondere in der Zeit zwischen 250 und 650 n. Chr. auf.
Die so genannte "Justinianische Pest" zur Zeit Kaisers Justinians (527–565), die 542 in Konstantinopel ausbrach, trug möglicherweise zum Misserfolg der Restauratio imperii bei und gilt als die größte antike Pestepidemie Europas. Sie brach zunächst im Orient aus von wo aus sie sich rasant im ganzen Mittelmeergebiet ausbreitete.
Anhand der detaillierten Schilderungen des spätantiken Historikers Prokopios geht die Forschung zumeist davon aus, dass es sich bei dieser Seuche tatsächlich um die Beulenpest handelte, die vielleicht zusammen mit anderen Krankheiten auftrat. 544 ließ Justinian, der selbst erkrankt gewesen war, aber überlebt hatte, das Ende der Pestepidemie verkünden. Diese brach jedoch 557 erneut aus, kehrte im Jahre 570 nochmals wieder und trat bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts in etwa zwölfjährigem Rhythmus immer wieder in Erscheinung. Gegen 770 verschwand die Seuche dann für über fünf Jahrhunderte.
Vom frühen Mittelalter an bis zum Ausbruch des so genannten Schwarzen Todes in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts schien Europa von der Pest weitgehend verschont geblieben zu sein.
Der "Schwarze Tod" – die mittelalterlichen Pestepidemien

Mit der Bezeichnung "Schwarzer Tod" wird heutzutage die große Pestepidemie bezeichnet, die in Europa von 1347 bis 1353 wütete.
Verbreitung
Die Seuche war offenbar in den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts in Zentralasien ausgebrochen und breitete sich entlang der Handelswege auch in Richtung Europa aus. 1347 erreichte sie das an der Krim gelegene Kaffa. Kaffa, das heutige Feodosija, war als genuesische Handelsstadt eng in das Handelsnetz der Genueser eingebunden, das sich über den gesamten Mittelmeerraum erstreckte. Von Schiffen verbreitet erreichte die Krankheit noch im selben Jahr die Küstenstädte Konstantinopel, Kairo sowie das sizilianische Messina. Im März 1348 hatte die Epidemie über den Landweg bereits Toulouse erreicht, im Mai erkrankten die ersten Opfer in Paris, im August starben die ersten in Avignon an der Pest. Deutschland, Norwegen, Schweden und Irland wurden 1349 von der Pest erreicht.
Man schätzt, dass etwa 20 bis 25 Millionen Menschen, rund ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas, durch den Schwarzen Tod umkamen. Über die Anzahl der Opfer in Asien und Afrika liegen keine seriösen Angaben vor. Jegliche Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da zeitgenössische Quellen die Anzahl der Toten eher zu hoch ansetzten, um den Schrecken und die Unbarmherzigkeit dieser Pandemie zu unterstreichen.
Der Schwarze Tod wütete nicht gleichmäßig in Europa, sondern ließ einige wenige Gebiete fast unberührt. Große Teile Polens, Belgiens und Süddeutschlands blieben beispielsweise von dieser ersten Pestwelle verschont. Auch Mailand entging der Heimsuchung durch die Pest, während in Florenz vier Fünftel der Bürger starben. In der Einleitung zu seiner Novellensammlung "Decamerone" schildert Giovanni Boccaccio eindrucksvoll, wie verheerend sich die Epidemie auswirkte:

- "So konnte, wer – zumal am Morgen – durch die Stadt gegangen wäre, unzählige Leichen liegen sehen. Dann ließen sie Bahren kommen oder legten, wenn es an diesen fehlte, ihre Toten auf ein bloßes Brett. Auch geschah es, dass auf einer Bahre zwei oder drei davongetragen wurden, und nicht einmal, sondern viele Male hätte man zählen können, wo dieselbe Bahre die Leichen des Mannes und der Frau oder zweier und dreier Brüder und des Vaters und seines Kindes trug." (Boccacio, "Decamerone")
Gesellschaftliche Auswirkungen
Viele der Menschen empfanden die Pest als Gottesstrafe. Religiöse Bewegungen entstanden spontan im Gefolge oder in Erwartung der Pest: Eine der auffälligsten waren die Bewegung der Flagellanten, die sich als Buße für ihre eigenen Sünden so wie die der Gesellschaft in öffentlichen Umzügen selbst geißelten und in den Städten Reue und Umkehr predigten. Sie verstanden sich als direkte Mittler zwischen Himmel und Erde – ohne Einschaltung der kirchlichen Autoritäten. Papst Klemens VI. verbot daher bereits 1348 öffentliche Selbstgeißelungen, ohne dieses Verbot jedoch durchsetzen zu können.

Bereits Anfang 1348 war das Gerücht aufgekommen, die Pest werde durch Brunnenvergiftung verbreitet. In der Karwoche wurden in der Provence erstmals Juden wegen der Pest verfolgt; der Vorwurf, sie träufelten Gift in Brunnen und Quellen und verbreiteten so die Pest, ist wenig später in den Quellen zu finden. In Savoyen bekannten sich im Herbst 1348 jüdische Angeklagte unter der Folter solcher Vergehen für schuldig. Die Geständnisse fanden rasch Verbreitung und bildeten die Basis für eine Welle von Judenpogromen vor allem im Elsass, in der Schweiz und in Deutschland. Nicht selten gerieten die Juden dabei zwischen die Fronten älterer Auseinandersetzungen, so etwa in Straßburg. Die Lage der jüdischen Minderheit im Reich war durch die Auseinandersetzungen zwischen den Häusern der Wittelsbacher und der Luxemburger äußerst prekär.
Nach dem Abflauen einer ersten Pogromwelle etwa im März 1349 war diese Großwetterlage für den Beginn einer zweiten Welle verantwortlich: Im Kampf um die Loyalität einzelner Städte (Frankfurt am Main, Nürnberg) gab Karl IV. die Juden den Interessen der städtischen Führungsgruppen preis. Die oft behauptete Verantwortung der Flagellanten für die Judenpogrome lässt sich in den seltensten Fällen nachweisen, am ehesten noch für Köln. In den meisten Fällen gilt, dass die Juden noch vor dem Eintreffen der Pest ermordet wurden. In Böhmen und Österreich wurden sie von der Landesherrschaft, in Regensburg von der Stadtgemeinde geschützt.
Langfristig bewirkte und beschleunigte die Pest durch den massiven Bevölkerungseinbruch einen tief greifenden Wandel der mittelalterlichen Gesellschaft, deren langfristige Wirkungen auch positiv bewertet wurden. So bezeichnete David Herlihy die Pest als "die Stunde der neuen Männer": Die Entvölkerung ermöglichte einem größeren Prozentsatz der Bevölkerung den Zugang zu Bauernhöfen und lohnenden Arbeitsplätzen. Unrentabel gewordene Böden wurden aufgegeben, was in manchen Regionen dazu führte, dass Dörfer verlassen oder nicht mehr wiederbesiedelt wurden (sogenannte Wüstungen). Die Zünfte ließen nun auch Mitglieder zu, denen zuvor die Aufnahme verweigert worden war, und während der Markt für landwirtschaftliche Pachten zusammenbrach, stiegen die Löhne in den Städten deutlich an.
Zweifel
Die Identifikation der mittelalterlichen Seuchen mit der durch Yersinia pestis verursachten Pest wurde und wird nach wie vor mehrfach angezweifelt, so durch die Historiker David Herlihy, Samuel K. Cohn und Sue Scott, den Zoologen Chris Duncan und den Anthropologen James Wood. Dabei trifft insbesondere der Einwand, dass weder die damalige rasante Ausbreitungsgeschwindigkeit noch die historisch beschriebenen Krankheitszeichen mit den bei einer Beulenpest zu erwartenden übereinstimmten. Auch war damals keine zu erwartende Epizootie bei Hausratten beobachtet worden.
Alternativ wird nunmehr die Möglichkeit diskutiert, dass es sich entweder um Milzbrand oder eine langsame Variante eines hämorrhagischen Fiebers gehandelt haben könnte. Ein Argument dafür liefert auch eine Mutation des Gens CCR5 im Menschen, bei der 32 Basenpaare nicht vorhanden sind. Diese Mutation mit dem Namen CCR5Δ32 wird in ca. 10% der europäischen Bevölkerung gefunden, nicht aber in Asien oder Ostafrika. Mathematische Modelle zur Verbreitung dieser Mutation lassen auf einen großen Selektionsdruck vor etwa 700 Jahren schließen, dem Zeitpunkt der Pest in Europa. Diese Mutation könnte somit ein genetischer Überlebensvorteil des Pesterregers gewesen sein. Die Veränderung auf dem CCR5-Gen bietet heute dem homozygotischen Träger einen beschränkten Schutz vor einer HIV-Infektion. Wenn es nur von einem Elternteil vererbt wird, verzögert es den Ausbruch von AIDS durchschnittlich um drei Jahre. Vor Y. pestis schützt diese Mutation dagegen nicht. Bei der im Mittelalter als Pest bezeichneten Krankheit könnte es sich somit um ein direkt von Mensch zu Mensch übertragenes virales hämorrhagisches Fieber gehandelt haben.
Neuzeit
15. bis 19. Jahrhundert
Nach einer schweren Pestepidemie, die 1347 begann, endemisierte die Seuche: In lokalen Epidemien suchte sie in den nächsten drei Jahrhunderte in nahezu regelmäßigen Abständen verschiedene Gebiete Europas heim. In der Stadt St. Gallen beispielsweise trat die Pest zwischen 1500 und 1640 mindestens vierzehn Mal auf. Nach 1580 kam es außerdem in Zyklen von vier bis fünf Jahren zu Pockenausbrüchen, an denen vor allem jüngere Kinder starben.
Der nur drei Wochen dauernden Pestepidemie von 1555 im hessischen Nidda fielen 300 Menschen zum Opfer. Das war ein Drittel der Bevölkerung dieser Stadt. Ähnliches gilt für die kleine Stadt Uelzen, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts ungefähr 1200 Einwohner hatte. Uelzen gehört zu den Städten, die bereits im 16. Jahrhundert genaue Register über ihre Einwohner führten. So weiß man, dass im Jahr 1566 in Uelzen genau ein Viertel der Einwohner starben, nämlich 295, von denen 279 der Pest erlagen. 1597 - Uelzens Einwohnerschaft war mittlerweile auf ungefähr 1600 Einwohner angestiegen - starben 554 Einwohner, davon 510 an der Pest.
Zu weiteren schweren Epidemien kam es 1665/1666 in London mit etwa 99.000 Toten und 1678/1679 in Wien zu der Zeit, als dort der sogenannte "liebe Augustin" lebte. Die letzten Pestepidemien trafen Europa im 18. Jahrhundert: Von 1709 bis 1711 wütete die Pest in Ostpreußen; starben dort gewöhnlich pro Jahr 15.000 Menschen (von einer Einwohnerschaft von etwa 600.000), kamen in diesen drei Jahren insgesamt 230.000 Menschen ums Leben.
Aus Sorge vor einem Ausbruch auch in Berlin ließ König Friedrich I. (Preußen) dort ein Pesthaus errichten, aus dem die Charité hervorging. Im Mai 1720 trat die Pest wieder in Marseille und in der Provence auf und verschwand erst wieder 1722. Nachdem 1771 in Moskau eine weitere Pestepidemie aufgetreten war, blieben weitere Pestepidemien in Europa aus.

Das Erlöschen der Pest in Europa bringt man damit in Zusammenhang, dass seit dem 16. Jahrhundert die Hausratte allmählich von der Wanderratte verdrängt wurde. Da die Wanderratte scheuer ist als ihre Vorgängerin, kommt es weniger häufig zu direkten Kontakten zwischen Mensch und Tier, was eine Ansteckung durch infizierte Flöhe reduziert. Der Historiker Vasold, der sich sehr intensiv mit der Pest beschäftigte, weist jedoch darauf hin, dass der Ausbruch in Moskau im Jahre 1771 zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die Wanderratte die Hausratte schon längst verdrängt hatte.
Eine weitere mögliche Erklärung ist, dass sich der Pesterreger genetisch verändert hat oder dass Ratten immun gegen den Pesterreger wurden und nach der Infizierung durch den Floh nicht mehr starben, so dass es für die Flöhe keine Notwendigkeit mehr gab, abzuwandern. Auch die Fortschritte im Gesundheitswesen und die Verbesserung der Hygiene haben zum Ausbleiben der Pestepidemien beigetragen.
Die letzte Pandemie begann in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in Zentralasien und kostete während der nächsten 50 Jahre weltweit rund 12 Millionen Menschenleben. Während dieser Pestepidemie konnte der Erreger identifiziert und der Übertragungsweg erklärt werden.
Die Pest heute
Die Pest ist auch heute noch nicht besiegt: Von 1979 bis 1992 meldete die WHO 1451 Todesfälle in 21 Ländern. In den USA gab es beispielsweise 1992 dreizehn Infektionen und zwei Todesfälle.
Die letzte größere Pestepidemie ereignete sich von August bis Oktober 1994 im indischen Surat. Die WHO zählte 6.344 vermutete und 234 erwiesene Pestfälle mit 56 Toten. Der dort festgestellte Pesterreger wies dabei bislang noch nicht beobachtete Eigenschaften auf. Er zeichnete sich durch eine schwache Virulenz aus und gilt aufgrund einiger molekularbiologischer Besonderheiten als neuartiger Erregerstamm.
Im Februar 2005 breitete sich die Lungenpest im Nordwesten Kongos aus. Nach Berichten der WHO gab es 61 Tote. Durch das Eingreifen der Organisation Ärzte ohne Grenzen konnte eine weitere Verbreitung verhindert werden.
Die Pest in Literatur und Kunst:

Kaum eine andere Katastrophe prägte die kollektive Vorstellung von Machtlosigkeit, Untergang und Unglück so sehr wie die Heimsuchung durch die Pest.
Die frühesten Seuchenberichte stammen von antiken Autoren wie Homer, Thukydides, Lukrez, Prokopios von Caesarea und Ovid. In Buch VII, 501-613 seiner Metamorphosen berichtet er sehr detailliert über die Pest von Aegina.
Vor allem jedoch die Pestepidemie des 14. Jahrhunderts hat sich stark auf Kunst und Literatur ausgewirkt. Die Menschen erwarben sogenannte Pestblätter, um sich mit Hilfe der darauf abgebildeten Heiligen vor der Pest zu schützen. Boccaccio schrieb vor dem Hintergrund der Pest, die 1348 in Florenz wütete, seine Novellensammlung „Decamerone“: Sieben Damen und drei junge Männer fliehen vor der Pest aus Florenz auf einen Landsitz. In einem bemerkenswerten Kontrast zu der Düsterkeit und Dramatik der Pestschilderungen stehen hierbei die erotisch-heiteren Geschichten, die sich die zehn Florentiner zur Unterhaltung erzählen. Sie finden einen Ausweg aus der Katastrophe in einem leichteren Leben. Die außergewöhnliche Situation der Pest gibt ihnen die Möglichkeit, in ihren Erzählungen die mittelalterlichen Normen und Werte zu hinterfragen.
In Lübeck entstand 1350 unter dem Eindruck der verheerenden Pestepidemie das Gemälde "Totentanz" in der neu erbauten Marienkirche. Im selben Jahr schuf Francesco Traini die Wandmalereien des Campo Santo von Pisa. Der Tod ist hier kein Knochenmann, sondern eine schwarz gekleidete, alte Frau, die mit wehenden Haaren und einer breitschneidigen Sichel in der Hand auf eine Gruppe sorgloser, junger Menschen herabfährt. Zu den Meisterwerken der Sepulkralkunst, das auf das veränderte Bild des Todes in der spätmittelalterlichen Kunst hinweist, zählt auch das gegen Ende des 14. Jahrhunderts entstandene Grabmal des Kardinals La Grange. Der Kardinal ist als fast nackter, verwesender Leichnam dargestellt und die Inschrift mahnt alle noch Lebenden, wie nichtig das Leben sei: „Was blähst du dich auf in deinem Stolz. Staub bist du und Staub musst du werden, ein verfaulter Kadaver, die Speise der Würmer“.
Die vermutlich erste medizinische Dissertation über die Pest verfasste der aus Nidda stammende Arzt Johannes Pistorius der Jüngere: De vera curandae pestis ratione (Über die rechte Art, die Pest zu behandeln), Frankfurt 1568.
In Wien entstand 1879 die – als solche heute oft gar nicht mehr erkannte – Pestballade"O du lieber Augustin, alles ist hin." (vgl. Marx Augustin), die der Pest einen Galgenhumor entgegensetzt.
1722 erschien in London Daniel Defoes „Journal of the Plague Year“ (zu deutsch: „Die Pest zu London“). Die Erzählung wurde zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, als ein Pestausbruch in Südfrankreich eine erneute Heimsuchung durch diese Krankheit befürchten ließ, und fand eine breite Leserschaft. Lange Zeit galt sie als Augenzeugenbericht des Pestausbruchs im Jahre 1665. Defoe war jedoch zum Zeitpunkt des Ausbruches noch ein Kind von vier oder fünf Jahren; die Erzählung aber schildert den Pestausbruch aus der Sicht eines erwachsenen Mannes, der in sachlichem Ton die Ereignisse beschreibt und mitleidsvoll und einfühlsam die Reaktionen seiner Mitbürger verfolgt. Gemeinsam mit „Robinson Crusoe“ und „Moll Flanders“ begründete diese Erzählung den Ruf von Daniel Defoe als Schaffer der Kunstform des realistischen Romans.

In den "I Promessi Sposi" schildert Alessandro Manzoni das Wüten der Pestepidemie im Mailand des Jahres 1630. Seiner Darstellung liegen Berichte mehrerer Zeitzeugen zugrunde, namentlich die „Historiae Patriae“ des Historiografen Giuseppe Ripamonti (1573 – 1643) und die Pestchronik des Arztes Alessandro Tadino („Ragguaglio dell’origine et giornali successi della gran peste contagiosa, venefica et malefica, seguita nella città di Milano...“), die 1648 erschienen war. Johann Wolfgang Goethe – vermutlich der erste deutsche Leser von Manzonis Roman (dieser hatte ihm die "Promessi Sposi" gleich nach dem Druck des dritten Bandes 1827 zugesandt) – bemerkte zwar, der Autor stehe in den Pestkapiteln „als nackter Historiker“ da und bemängelte das „umständliche Detail“ bei Dingen „widerwärtiger Art“. Dessen ungeachtet gilt die erbarmungslos präzise Schilderung der Seuche in den „Promessi Sposi“ heute als ein Glanzpunkt der italienischen Prosa. – Mit Ereignissen in Mailand während des Pestjahrs 1630 beschäftigt sich auch Manzonis 1829 entstandene „Storia della Colonna Infame“.
Edgar Allan Poe schuf 1842 die Erzählung "Die Maske des Roten Todes", die eigentlich durch einen Zeitungsbericht über eine Choleraepidemie in Paris inspiriert war, aber Ähnlichkeit zu anderen Pesterzählungen aufweist. Obwohl eine Krankheit (der Rote Tod, Red Death) das halbe Land dahinrafft, gibt der Herzog Prince Prospero, der auf sein Schloss geflüchtet ist, einen pompösen Maskenball. Die Rahmenhandlung, bei der man vor der Epidemie in den Hedonismus flieht, erinnert hier an Boccaccios Decamerone, doch nimmt Poes Geschichte eine andere Wendung. Am Ende dringt der Rote Tod auch in das Schloss ein, und weil sich der Herzog nicht um sein Land gekümmert hat, wütet die Epidemie weiter.
In der Rahmennovelle „Die schwarze Spinne“ verarbeitete Jeremias Gotthelf 1843 alte Sagen über einen Handel mit dem Teufel zu einer gleichnishaften Erzählung über die Pest.
Arnold Böcklin schuf zu diesem Thema 1889 in Italien das Bild „Pest/Der Schwarze Tod“, das heute im Basler Kunstmuseum ausgestellt ist. Böcklin personifiziert die Pest in seinem Bild als fliegendes, blindes Monstrum, vor dem es kein Entrinnen gibt. Die Sense und die skelettartige Gestalt greifen auf die mittelalterliche Todessymbolik zurück.
Albert Camus schrieb den Roman „Die Pest“ (fr. „La Peste“) über einen neuzeitlichen Pestausbruch in der algerischen Stadt Oran (publiziert 1947). Darin trifft ein Arzt trotz der Aussichtlosigkeit und Absurdität des Kampfes gegen die Pest auf Menschlichkeit und Solidarität. Die Pest wird hierbei oft als Symbol auf den Nationalsozialismus interpretiert.
Zitierte Werke
- Boccaccio; Il decamerone - Eine englische Übersetzung aus der Einleitung, aus der die obigen Zitate stammen, findet sich unter Introduction to il decamerone
- Albert Camus: Die Pest, 1947
- Thukydides berichtet in seinem Werk über den Peloponnesischen Krieg ausführlich über die Seuche, die die Athener heimsuchte. Neben der "Reclam"- (oder der "Bibliothek der Alten Welt") Übersetzung ist diese auch nachlesbar unter folgender englischsprachiger Website: "Peloponnesischer Krieg": Thukydides; "Der Peloponnesische Krieg" (Reclam), hrsg. von H. Vrestka und W. Rinner, Stuttgart 2000. ISBN 3-150-01808-0
Literatur und Weblinks:
- Manolis J. Papagrigorakis, Christos Yapijakis, Philippos N. Synodinos, Effie Baziotopoulou-Valavani: DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens in "International Journal of Infectious Diseases", Volume 9 ISSN 1201-9712
- Pauline Allen: The Justinianic Plague, in: Byzantion 49 (1979), S. 5-20.
- Klaus Bergdolt: Der schwarze Tod in Europa, Becksche Reihe, C.H. Beck Verlag, München 2003, ISBN 3-406-45918-8
- Norman F. Cantor: In the Wake of the Plague – The Black Death and the Word it made, London 1997, ISBN 0-7434-3035-2
- Claudia Eberhard Metzger, Renate Ries: Verkannt und heimtückisch – Die ungebrochene Macht der Seuchen, Basel 1996, ISBN 3-7643-5399-6
- Franz-Reiner Erkens: Buße in Zeiten des Schwarzen Todes: Die Züge der Geissler, in „Zeitschrift für historische Forschung“, 26. Band 1999, Berlin, S. 483–513
- František Graus: Pest - Geißler - Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Göttingen 1987, ISBN 3-525-35622-6
- David Herlihy: Der Schwarze Tod und die Verwandlung Europas, Berlin 1997, ISBN 3-8031-3596-6
- Kay Peter Jankrift: Krankheit und Heilkunde im Mittelalter, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, ISBN 3-534-15481-9
- Arno Karlen; Die fliegenden Leichen von Kaffa - Eine Kulturgeschichte der Plagen und Seuchen, Berlin 1996, ISBN 3-353-01054-8
- Mischa Meier (Hg.): Pest. Die Geschichte eines Menschheitstraumas, Klett-Cotta, Stuttgart 2005, ISBN 3608943595. Gesamtdarstellung der Pestgeschichte von der Antike bis in die Moderne.
- William Naphy, Andrew Spicer: Der schwarze Tod, Magnus Verlag, Essen 2003, ISBN 3-88400-016-0
- Norbert Ohler: Sterben und Tod im Mittelalter, Patmos Paperback, ISBN 3-491-69070-6
- Jacques Ruffié, Jean-Charles Sournia: Die Seuchen in der Geschichte der Menschheit, Stuttgart 1987, ISBN 3-423-30066-3
- Barbara Tuchman: Der ferne Spiegel – das dramatische 14. Jahrhundert, Düsseldorf 1980, ISBN 3-546-49187-4
- Manfred Vasold: Die Ausbreitung des Schwarzen Todes in Deutschland nach 1348, in Historische Zeitschrift Band 277, 2003, S. 281–308
- Manfred Vasold: Pest, Not und schwere Plagen - Seuchen und Epidemien vom Mittelalter bis heute, München 1991, ISBN 3-406-35401-7
- Manfred Vasold: Die Pest, Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2003, ISBN 3-8062-1779-3
- Stefan Winkle: Kulturgeschichte der Seuchen, 2000, ISBN 3933366542
- Karl Georg Zinn: Kanonen und Pest, Opladen 1989, ISBN 3-531-12107-3
- Sue Scott, Christopher Duncan: Return of the Black Death: The World's Greatest Serial Killer, John Wiley & Sons, Canada 2004, ISBN 0470090006
- RKI - Pest
- www.cdc.gov/ CDC - CDC Plague Home Page
- www.edjewnet.de/ Das jüdische Museum Göppingen - Pest und Judenverfolgung
Atypische Bakterien
Intrazelluläre Erreger
Chlamydien
| Chlamydia | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
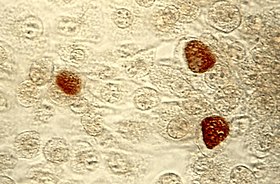 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Chlamydien sind kleine (unter 0,5µm), Gram-negative (Zellwand-positiv, Peptidoglycan-negativ) mit einer Doppelmembran versehene Eubakterien. Da sie keinen eigenen Energiestoffwechsel besitzen leben sie obligat intrazellulär. Auf normalen Nährmedien können sie nicht angezüchtet werden.
Lebenszyklus: Chlamydien durchlaufen in ihrem Entwicklungszyklus zwei Formen. Außerhalb ihrer Wirtzellen existieren sie als Elementarkörperchen (EK) von ca. 0,2-0,4μm Durchmesser. In dieser Form können Chlamydien Wirtszellen infizieren. Einmal in die Zelle aufgenommen, wandeln sich die Elementarkörperchen in Retikularkörperchen (RK) um, die einen aktiven Stoffwechsel besitzen und sich innerhalb der Wirtszelle vermehren. Vor dem Tod der Wirtszelle wandeln sich die RK wieder in EK um, die dann bei der Zerstörung der Zelle freigesetzt werden und weitere Zellen infizieren können.
Krankheitsbilder: siehe unten bei der Beschreibung der einzelnen Spezies
Diagnostik: Goldstandard ist die Zellkultur, daneben sind PCR und Serologie möglich.
Therapie: Infektionen durch Chlamydien werden meist mit Makroliden oder Tetracyclinen behandelt. Eine akute Chlamydien-Infektion wird z.B. mit Doxycyclin oder mit Azithromycin behandelt. Antibiotikaresistenzen sind bei Chlamydien sehr selten, weshalb von der gut wirksamen Therapie mit Chinolonen oft abgesehen wird, die teils mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen behaftet ist. Mit Blick auf Begleitinfektion mit Gonokokken ist diese Variante jedoch zu diskutieren. Die Infektion mit C. trachomatis gehört zu den infektiösesten sexuell übertragbaren Krankheiten, daher müssen alle Sexualpartner mitbehandelt werden. Nach Abschluss der Therapie sollte der Behandlungserfolg durch erneute Testung aller Patienten überprüft werden. Auch eine Untersuchung auf andere sexuell übertragbare Infektionen ist aufgrund der ähnlichen Verbreitungswege dieser Krankheiten anzuraten.
Geschichte: Aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer rein intrazellulären Vermehrung wurden Chlamydien bis in die sechziger Jahre hinein den Viren zugerechnet. 1966 wurden sie schließlich als eigene Ordnung Chlamydiales den Bakterien zugerechnet.
Weblinks: RKI - Chlamydiose
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)
Krankheitsbilder: Die Ornithose ist eine in Deutschland meldepflichtige Tierseuche, die vor allem von Vögeln übertragen wird (Zoonose). Die Psittakose (Papageienkrankheit)ist die Ornithose bei Psittaciden (anzeigepflichtig). Diese schwere, grippeartige Allgemeinerkrankung verläuft in der Regel unter vorwiegender Beteiligung der Lungen (Bronchopneumonie) ab.
Erregerreservoir: Das Reservoir des weltweit verbreiteten Erregers sind Tiere (Zoonose), insbesondere Vögel (Papageien, Sittiche, Tauben u. a.). Die Tiere selbst zeigen, wie bei Reservoirwirten üblich, in der Regel wenig oder keine Symptome.
Übertragung: Der Erreger wird in der Regel inhalativ durch Einatmen von infektiösem Kot-Staub bzw. Aerosol aufgenommen. Kontaktinfektionen und Schmierinfektion sind bei Menschen mit engem Kontakt zu infektiösen Tieren möglich (Anerkennung als Berufskrankheit!).
Krankheitsbilder: Neben der atypischen Pneumonie, die im folgenden ausführlicher besprochen wird, gibt es Hinweise dafür, dass Chlamydia psittaci die Entwicklung von Lymphomen der okulären Adnexe (LOA) triggert.[1][2]
Pathogenese: Die Vermehrung des Erregers erfolgt primär wahrscheinlich im respiratorischen Epithel des oberen Respirationstraktes (->trockener Reizhusten), nach Bakteriämie dann sekundär im RES, v.a. in der Milz (->Splenomegalie), selten auch in der Leber (->Hepatosplenomegalie). Die Lunge wird wahrscheinlich erst sekundär über den Blutweg infiziert. Hier kommt es zu dem Bild einer atypischen Pneumonie. Das respiratorische Epithel in den Bronchien bleibt intakt.
Verlaufsformen: Je nach Alter und Immunkompetenz entwickeln sich unterschiedliche Verläufe:
- inapparent
- Grippe-ähnlich
- atypische Pneumonie mit z.T. schweren Verläufen
- typhöse Form (selten)
Klinik: Die Krankheit beginnt nach einer Inkubationszeit von etwa 6 bis 20 Tagen mit Gliederschmerzen, Schläfen- und Stirnkopfschmerz, Kreuzschmerzen, hohes Fieber über 39°C, und Bradykardie. Nach ca. 5 Tagen folgen Husten, anfangs trockener Reizhusten, später mukopurulent bei atypischer Pneumonie, Spleno(hepato)megalie, selten auch Myokarditis, Enzephalitis und Hepatitis. In der vierten Woche langsamer Fieberrückgang und Erholung, völlige Genesung und Normalisierung der Lunge besonders nach schweren Krankheitsverläufen erst nach vielen Wochen. Nach überstandener Erkrankung wird eine viele Jahre andauernde Immunität erworben. Unbehandelt oder bei einer Fieberdauer von mehr als drei Wochen verläuft hingegen die Erkrankung besonders bei einer Infektion mit hochvirulenten Erreger-Stämmen oft tödlich (Letalität 20 - 50%).
Diagnose: Die Diagnose einer Psittakose wird in der Regel anhand des klinischen Bildes bei exponierten Personen gestellt. Typisch sind neben dem pulmonalen Befund und Anamnese (Kontakt zu Vögeln) eine leichte Leukopenie von ca. 4000-6000/mm³ mit Linksverschiebung, relative Lymphopenie und eine erhöhte BSG. Der indirekte Nachweis des Erregers erfolgt am besten anhand von Titerverläufen von Chlamydien-spezifischen Antikörpern im Serum des Patienten (Komplementbindungsreaktion, ELISA). Eine genaue Bestimmung der Chlamydienart kann durch Immunfluoreszenz gegen spezifische Initialkörper erfolgen. Die Kultur des Erregers erfolgt in der Regel nur in Spezial-Laboratorien wegen der Infektiosität des Erregers und der schwierigen Kulturbedingungen.
Differentialdiagnose: Bei der Differentialdiagnose kommen andere Erreger in Betracht, die eine atypische Pneumonie auslösen können, z.B. die Legionärskrankheit, das Q-Fieber und die Influenza. Weiterhin sind Typhus, Fleckfieber und Sepsis auszuschließen.
Therapie: In der Regel erfolgt eine Antibiotika-Therapie mit Tetracyclinen, (z.B. Tetracyclin, Doxycyclin) oder Makroliden (z. B. Clarithromycin, Erythromycin) über 2 bis 3 Wochen.
Weblinks: RKI - Ornithose
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)
Krankheitsbilder: Chlamydophila pneumoniae verursacht Pneumonien, die Symptome sind nicht erregerspezifisch und beinhalten Husten, Fieber und Dyspnoe, evtl. kombiniert mit Halsschmerzen, Heiserkeit und Nebenhöhlenentzündungen.
Diagnostik: Die Diagnose von Chlamydophila pneumoniae kann durch Untersuchung des Sputum oder Sekreten des Rachenraums die Bakterien zeigen. Eine Blutuntersuchung kann Antikörper gegen das Bakterium aufzeigen. Falls es aber eine frühere Infektion gab, können die Antikörper auch daher stammen. Deshalb ist eine Analyse der Antikörper nach 6 Wochen notwendig um eine neue oder alte Infektion zu diagnostizieren. Die Blutuntersuchung kann ebenfalls Proteine (Antigene) von Chlamydophila pneumoniae zeigen, entweder durch ein direct fluorescent antibody testing, auch enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) genannt oder PCR.
Weblinks: RKI - Chlamydiose
Chlamydia trachomatis

Krankheitsbilder: Infektionen durch Chlamydia trachomatis können sich als Geschlechtskrankheit bei beiden Geschlechtern durch Ausfluss im Genitalbereich und Schmerzen beim Wasserlassen äußern. Bei 80 % der infizierten Menschen treten jedoch keine Symptome auf, diese Menschen fungieren also als Überträger. Es wird empfohlen sich einmal im Jahr auf eine Infektion untersuchen zu lassen. Die perinatale Infektion führt beim Neugeborenen zum Trachom, einer schweren Augeninfektion die oft zur Erblindung führt. Bei Erwachsenen kann Chlamydia trachomatis das Paratrachom (Schwimmbadkonjunktivitis) hervorrufen. Das durch C. trachomatis-Subtypen L1-L3 hervorgerufene Lymphogranuloma venereum, dessen Symptomatik sich von der einer durch die anderen Subtypen hervorgerufenen C. trachomatis - Infektion unterscheidet, ist in Deutschland selten.
Epidemiologie: Die Infektion mit Chlamydia trachomatis ist die in Europa am häufigsten auftretende sexuell übertragbare Krankheit mit bakterieller Ursache. In Deutschland beträgt die Prävalenz einer Chlamydia trachomatis-Infektion in minderjährigen Mädchen 5,4% (Quelle: Dt. Ärzteblatt, Ausgabe 28, 2005) und steigt in Abhängigkeit mit der Zahl der Sexualpartner. Das Trachom ist nach Katarakt und Glaukom weltweit die dritthäufigste Ursache der Erblindung, davon betroffen sind 6 Millionen Menschen bei 500 Millionen Infizierten.
Weblinks: RKI - Chlamydiose
Mycoplasma sp.
| Mycoplasmen | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|
Bei Mycoplasmen handelt es sich um die kleinsten selbstständig vermehrungsfähigen Bakterien aus der Klasse der Mollicutes. Mit einer Größe von 580-1.380 kbp haben die Gattungen Mycoplasma und Ureaplasma das kleinste Genom der zur Auto-Replikation befähigten Prokaryonten mit Ausnahme des Tiefsee-Archaeums Nanoarchaeum equitans (~500 kbp). Sie sind zellwandlos, enthalten DNA und RNA und sind aufgrund von Cholesteroleinlagerungen in die Zellmembran extrem verformbar ("Mollicutes"). Mycoplasmen sind parasitär, intra- und extrazellulär lebende Bakterien, die beim Menschen, Tieren und Pflanzen die Ursache für zahlreiche Krankheiten sind. Sie leben aerob bis fakultativ anaerob. Neben den pathogenen Eigenschaften der Mycoplasmen spielt die Infektion von Zellkulturen mit Mycoplasmen (hauptsl. Mycoplasma orale) eine wichtige Rolle.
Diagnostik: Der Nachweis von Mycoplasmen kann über verschiedene Methoden erfolgen. Als schnelle und billige Standardmethode hat sich die PCR etabliert. Sie lassen sich nicht mit der Färbung nach Gram anfärben.
Arten und Krankheitsbilder:
- Mycoplasma pneumoniae ist wichtigster Erreger der atypischen Pneumonie. Aber auch Tracheobronchitis, Pharyngitis und weitere Krankheitsbilder können von M. pneumoniae verursacht werden. Zudem wird der Organismus mit Störungen des hämatopoetischen Systems, des zentralen Nervensystems, der Leber und Pankreas sowie kardiovaskulären Syndromen in Verbindung gebracht.
- Mycoplasma genitalium ist neben Chlamydia trachomatis ein wichtiger Erreger der so genannten "non-gonococcal-Urethritis", einer nicht durch Neisseria gonorrhoeae (den sog. "Gonokokken") verursachten Harnröhren-Entzündung.
- Ureaplasma urealyticum besiedeln den unteren weiblichen Genitaltrakt und werden bei Schwangerschaft häufig von der Mutter auf das Kind übertragen, wo sie u.a. die Ursache für neonatale Infektionen wie Pneumonien oder chronische Infektionen des zentralen Nervensystems sein können. U. urealyticum ist ebenfalls ein Erreger der "non-gonococcal-Urethritis".
Pathogenitäts- und Virulenzfaktoren:
- Neuraminsäure-Rezeptoren
- Adhäsine
- Superantigene -> Autoimmunphänomene
Diagnostik: Serologie (Kultur, PCR)
Therapie: Tetracycline, Makrolide
Rickettsien
| Rickettsia | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|
Rickettsien sind intrazellulär-parasitäre Organismen, die sich in vielen Vektoren (Überträger) wie Zecken, Flöhen, Milben und Läuse finden. Beim Menschen verursachen sie eine ganze Reihe von Krankheiten (Rickettsiosen), z.B. Fleckfieber, Rickettsien-Pocken, Brill-Zinsser-Krankheit, Boutonneuse-Fieber (Mittelmeer-Zeckenfleckfieber) und das Rocky-Mountain-Fleckfieber.
Etymologie und Geschichte: Namensgebend war der Pathologe Howard Taylor Ricketts (1871 - 1910), der u. a. das Rocky-Mountains-Fleckfieber erforschte, dessen Erreger er im Blut infizierter Menschen und in der als Vektor aktiven Viehzeckenart nachweisen konnte. 1909 reiste er nach Mexiko-Stadt, mit dem Ziel den "Typhus" zu erforschen. (Vorsicht: Während "Typhus" im angloamerikanischen Sprachraum Rickettsiosen bezeichnet, ist der "Typhus" im Deutschen gleichbedeutend mit dem Salmonellen-Typhus durch Salmonella enteritica Serovar typhi!) Dabei infizierte er sich mit Rickettsien, so dass er 1910 an der Erkrankung verstarb.
Morphologie und Eigenschaften: Rickettsien sind unbewegliche, nicht nach Gram färbbare, hochgradig polymorphe und intazelluläre Parasiten, die keine Sporen bilden. Häufig handelt es sich um runde (kokkoide) bis ovale Bakterien mit einem Durchmesser von 0.1µm; sie können auch als Stäbchen (1-4μm lang) oder Faden-artig (10μm lang) auftreten. Gelegentlich bilden sie Ketten, meist kommen sie jedoch einzeln oder in Paaren vor.

Lebensweise: Als obligatorische intrazelluläre Organismen, hängt das Überleben der Rickettsien völlig von ihrer eukaryotischen Wirtszelle (meist Endothelzellen) ab, in deren Zytoplasma sie eindringen müssen um vor dem Abwehrsystems des Wirts geschützt zu sein. Auch die Vermehrung durch Querteilung findet im Inneren der Wirtszelle statt. Die Freisetzung der Bakterien erfolgt anschließend durch Abschnürung aus der Zellmembran (Exozytose) oder durch Lyse, wodurch die Wirtszelle zerstört wird.
Pathogenese:
- Befall von Endothelzellen (intrazelluläre Vermehrung -> Aktinpolymerisierung -> Invasion der Nachbarzelle)
- Zytokineproduktion -> lokale Entzündung, Thrombosierung, Exanthem -> Fleckfieberknötchen
Mechanismus der Zellinvasion: Wie es Rickettsien gelingt in eukaryotische Zellen einzudringen war bislang ein Rätsel. Wissenschaftler vom Institut Pasteur inParis ist es Ende 2005 gelungen anhand von Rickettsia conorii zwei am Eindringvorgang beteiligten Schlüsselproteine zu identifizieren. Es handelt sich um das Säugerprotein Ku70' und um das bakterielle Protein OmpB. Ku70 findet sich normalerweise im Zellkern von Säugetierzellen. Offensichtlich kann es aber auch zur Zellmembran wandern, wo es vom Rickettsien-eigenen rOmpB festgehalten und zum Eindringen in die Zelle genutzt wird. Die Wissenschaftler bezeichneten rOmpB aufgrund dieser "verräterischen" Eigenschaft auch als "molekularen Handlanger" der Rickettsien.
Spezies und Krankheitsbilder: Bezüglich ihrer Eigenschaft als Humanpathogen werden Rickettsien gewöhnlich in folgende drei Gruppen gegliedert:
- Fleckfieber-Gruppe (engl. „typhus“)
| Organismus | Erkrankung | Vorkommen | Vektor |
| R. prowazekii | Klassischer Typhus exanthematicus, klassisches Fleckfieber, epidemisches Fleckfieber, Brill-Zinsser-Krankheit (endogene Zweitinfektion) | weltweit | Kleiderlaus / Mensch |
| R. typhi | Murines Fleckfiber (endemischer Typhus) | weltweit | Rattenfloh / Ratte |
- Zeckenbißfieber-Gruppe (engl. "spotted fever")
| Organismus | Erkrankung | Vorkommen | Vektor |
| R. rickettsii | Rocky-Mountain-Fleckfieber (RMSF) | westliche Hemisphäre | Schildzecke, Zecke, Nagetiere |
| R. akari | Rickettsien-Pocken | USA, frühere Sowjetunion | Milben, Nagetiere |
| R. conori | Boutonneuse-Fieber leichter Verlauf: Lymphadenitis, stark ausgeprägte Primärläsion, Exanthem |
Mittelmeer-Länder, Afrika, Südwestasien, Indien | Schildzecke, Nagetiere |
| R. sibirica | Sibirian tick typhus (nordasistisches Zeckenbissfieber) | Sibirien, Mongolei, nördliches China | Schildzecke, Nagetiere |
| R. australis | Australian tick typhus (australisches Zeckenbissfieber) | Australien | ? |
| R. japonica | Japanisches Fleckfieber | Japan | ? |
- Tsutsugamushi (scrub typhus) Gruppe (Anm.: Bezeichnung unklar!)
| Organismus | Erkrankung | Vorkommen | Vektor |
| R. tsutsugamushi (jetzt eine eigene Gattung, Orientia) |
Tsutsugamushi-Krankheit (scrub typhus) schwerer Verlauf: Enzephalitis, Lymphadenitis, stark ausgeprägte Primärläsion, Exanthem |
SW-Asien, nördliches Australien, Pazifische Inseln | Milbenlarven, Nagetiere |
Diagnostik: Aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Wirtszelle können die Parasiten im Labor nicht in künstlichen Nährmedien gehalten werden. Man züchtet sie daher entweder in biologischen Geweben oder Embryo-Kulturen (Hühnerembryonen).
Therapie und Hygiene: Die Mehrzahl aller Rickettsien sind empfindlich gegenüber Tetracyclinen. In feuchten Medien erfolgt eine Abtötung bei 50 °C in 15 Minuten. Auch mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln lassen sich die Pathogene wirksam zerstören.
Weblinks: RKI - Fleckfieber
Bartonella
Bartonella quintana
| Bartonella quintana | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Bartonella quintana, der Erreger des Fünf-Tage-Fiebers (Wolhynisches Fieber), rief während des Ersten Weltkrieges große Epidemien unter den alliierten Soldaten der Westfront hervor, weswegen die Krankheit auch den Namen Schützengrabenfieber erhielt. Die Erkrankung zeichnet sich durch plötzlich einsetzende Kopfschmerzen, aseptische Meningitis, Endokarditis, persistierendes Fieber sowie andere unspezifische Symptome aus und wird von Mensch zu Mensch durch die Kleiderlaus (Pediculus humanus corporis), übertragen. Mit dem Rückgang der Epidemien nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahm auch das Interesse an Bartonella quintana ab, bis das Bakterium 1992 als einer der Erreger der bazillären Angiomatose (BA) identifiziert wurde. Neuere Erkenntnisse zeigen, dass der Erreger maßgeblich zum Verlust von Napoleons Armee auf dem Rückzug vom Russlandfeldzug 1812 beigetragen haben könnte.
Bartonella henselae
| Baronella henselae | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Bartonella henselae ist ein nicht nach Gram färbbares Stäbchenbakterium.
Krankheitsbilder: Die Katzenkratzkrankheit wird durch Kratzverletzungen von Katzen übertragen (Zoonose) und ist eine meist gutartig verlaufende, selbstlimitierende Infektionskrankheit, die axilläre oder zervikale Lymphknotenvergrößerungen hervorruft. Die Katzen selber sind asymptomatische Überträger der Krankheit. Auch im Katzenfloh sind die Erreger der Katzenkratzkrankheit nachweisbar und über den Floh wird die Krankheit wahrscheinlich von Katze zu Katze übertragen. Nach einer Inkubationszeit von 2 - 10 Tagen kann es an der Kontaktwunde zu einer rot-braunen schmerzlosen Papel kommen, welche nach einigen Tagen oder Wochen wieder von alleine verschwindet. Später sind dann im Lymphablußgebiet der Wunde schmerzlose oder schmerzhafte Lymphknotenschwellungen nachweisbar. In einigen Fällen kommt es zu eitrigen Einschmelzungen der Lymphknoten. Die Lymphknoten können über Wochen vergrößert bleiben. Schwere atypische Verlaufsformen mit hohem Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen sind möglich. Insbesondere bei Immunschwäche kann es zu einer Infektion des Zentralnervensystems oder einer Sepsis kommen. Komplikationen sind Befall des Nervensystems (Enzephalitis, Lähmungen, Neuroretinitis, Radikulitis, Polyneuritis), systemische Ausbreitung der Hautpapeln, Osteomyelitis, Pneumonie, Hämolyse, Thrombopenie und Endokarditis.
- Synonyme: Katzenkratzfieber, Katzenkratzlymphadenitis, cat scratch disease or fever, benign inoculative lymphoreticulosis, benigne Inokulationslymphoretikulose, Maladie des griffes de chat, cat scratch disease
Weitere Krankheitsbilder sind die Bazilläre Angiomatose und die Peliose.
Verbreitung: Die Krankheit ist weltweit verbreitet. Sie kann bei Kindern und Erwachsenen vorkommen. Da sie meist gutartig verläuft, werden die meisten Krankheitsfälle gar nicht erkannt. Der Erreger läßt sich bei Katzen in Deutschland zwischen 10 - 70 % nachweisen. Ein familiäres Auftreten der Krankheit kann durch eine neu angeschaffte Katze in der Familie ausgelöst werden. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher nicht beschrieben.
Diagnostik: Anamnese (Kontakt mit Katzen), klinisches Bild und Ultraschalluntersuchung der Lymphknoten, ggf. serologischer Antikörpernachweis, PCR zum Nachweis von genomischer B. henselae-DNA, Entzündungswerte (CRP, Leukos), Lymphknotenbiopsie (evtl. mit PCR, histologisch: Granulomatöse Entzündung mit zentraler Nekrose)
Differentialdiagnose: Lymphadenitis durch andere Erreger (Tuberkulose, Infektiöse Mononukleose, Lymphogranuloma inguinale, Aktinomykose, Brucellose, Tularämie), Lymphknotenmetastasen bösartiger Tumoren, Lymphome.
Therapie: In der Mehrzahl der Fälle heilt die Krankheit auch ohne Therapie aus. Falls dies nicht der Fall ist kann mit Makroliden (Azithromycin) oder Terazyklinen behandelt werden. Siehe : http://www.antibiotikamonitor.at/12_99/12_99_3.htm
Literatur und weblinks:
- Ridder GJ, Boedeker CC, Technau-Ihling K, Sander A. Cat-scratch disease: Otolaryngologic manifestations and management. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 Mar;132(3):353-8.
- http://www.medizin.de/gesundheit/deutsch/905.htm
- http://www.ikmi.ch/Publikationen/Info/inf_0203.pdf
- http://www.kleintiermedizin.ch/katze/halter/halter4.htm
- http://www.infektionsnetz.at/InfektionenKatzenkratzkrankheit.phtml
Coxiella burnetii
| Coxiella burnetii | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Coxiella burnetii ist ein nicht nach Gram färbbares, strikt intrazellulär lebendes und sporenbildendes Bakterium.
Krankheitsbilder: Coxiella burnetii ist der Erreger des Q-Fiebers (Q = query), eine Zoonose, die nach einer Inkubationszeit von 9 bis 40 Tagen in etwa 60% der Fälle asymptomatisch und selbstlimitierend verläuft.
- Synonyme: Queensland-Fieber oder Query-Fieber (daher: Q-Fieber), Balkan-Grippe, Euboea-Fieber, Kretafieber, Krim-Fieber, Pneumorickettsiose, Schlachthausfieber, Siebentagefieber, Wüstenfieber
Übertragung: Träger des hochinfektiösen und umweltresistenten Bakteriums in Deutschland sind vor allem Schafe (Kot der Buntzecke). Die Übertragung erfolgt meist durch Inhalation sporenhaltigen Staubs oder durch Kontakt bei Tiergeburten oder mit kontaminierten Produkten wie Wolle, Milch oder Fleisch. Zecken können den Erreger auch auf andere Tiere übertragen.. Q-Fieber ist eine in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtige Erkrankung.
Klinik: Symptomatisch wird die Erkrankung am häufigsten durch ein grippeähnliches Erscheinungsbild mit abrupt einsetzendem Fieber, starker Abgeschlagenheit, starken Kopfschmerzen, Myalgien, Appetitverlust, trockenem Husten, Brustschmerz, Schüttelfrost, Verwirrtheit, und - seltener - Magen-Darm-Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Das Fieber hält etwa 7 bis 14 Tage an. Im anfänglichen Verlauf der Erkrankung können eine atypische Pneumonie auftreten, welche in ein lebensbedrohliches akutes Atemnot-Syndrom ARDS münden kann. Weiterhin kann sich das Q-Fieber als granulomatöse Hepatitis, Endokarditis und Perikarditis manifestieren. Die Langzeitletalität sinkt bei angemessener Behandlung auf etwa 10%.
Epidemiologie: Der Erreger ist weltweit verbreitet (außer in Neuseeland und der Antarktis). Im Mai 2003 infizierten sich etwa 20 Menschen im westfälischen Soest nach einer Geburt von Zwillingslämmern auf einem Bauernmarkt. Zwischen Ende Juni und Anfang August 2005 wurden im Stadtgebiet von Jena (Winzerla) ca. 300 Personen mit der Diagnose Q-Fieber registriert. Auslöser war eine Schafherde, die Anfang Juni im Bereich des Wohngebiets geweidet hatte. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden sowohl bei zwei Dutzend Schafen als auch bei mehreren Dutzend der erkrankten Personen Antikörper gegen Coxiella brumetii serologisch nachgewiesen ([4]).
Diagnostik: Serologischer Antikörpernachweis. Der direkte Erregernachweis im Blut gelingt in der Regel nicht.
Therapie: Die Behandlung der akuten Form ist in aller Regel erfolgreich und erfolgt in Absprache mit Infektiologen durch Antibiotika für eine Dauer von zwei bis drei Wochen. Empfohlen werden Chinolone, Tetracycline, Makrolid-Antibiotika. Ebenso in Frage kommen Doxycyclin, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Ofloxaxin, Hydroxychloroquin. Die Behandlung der chronischen Form kann bis zu vier Jahren Behandlung mit Doxycycline und Hydroxychloroquine erfordern. Sie ist auch weniger häufig erfolgreich.
Prophylaxe: Besonders gefährdete Personen, z. B. Tierärzte, Schlachthofpersonal oder Labormitarbeiter, sollten vorsorglich geimpft werden.
Geschichte: Die Krankheit wurde zuerst 1937 von Edward Holbroock Derrick bei Schlachthausarbeitern in Brisbane, Queensland, Australien als Erkrankung unbekannter Ursache wissenschaftlich beschrieben, was zu dem Namen Q-Fieber (von "query" für "fraglich") führte. Das Bakterium wurde ebenfalls 1937 von Frank MacFarlane Burnet und Freeman aus einem von Derrick's Patienten isoliert und als Rickettsia-Spezies identifiziert. H.R. Cox and Davis isolierten den Erreger aus Zecken in Montana, USA im Jahre 1938, beschrieben den Übertragungsweg, und der Organismus wurde im gleichen Jahr offiziell als "Coxiella Burnetii" anerkannt. Inzwischen wird Coxiella burnetii nicht mehr als naher Verwandter der Rickettsien betrachtet.
Militärische Verwendung: Aufgrund des Infektionsweges kann der Erreger auch als biologische Waffe verwerdet werden und verschiedene Armeen haben ihn in ihrem Biowaffenarsenal.
Literatur und Weblinks:
- Q Fever In: Clinical Microbiology Reviews, Oct. 1999, 518 - 583
- RKI - Q-Fieber
Ehrlichia
Krankheitsbilder: Humane granulozytäre Ehrlichiose (HGE) und die Humane monozytäre Ehrlichiose (HME). Es handelt sich um akute grippeähnliche Systemerkrankungen, die zu ARDS, Schock und in 2-5 % zum Tod führen können.
Epidemiologie: In Zentraleuropa nur HGE mit unklarer Prävalenz
Diagnostik: Serologie (IFT). Daran gedacht werden sollte immer bei FUO (Fever of unknown origin).
Therapie: Tetracycline
Tropheryma Whippelii
Krankheitsbild: Tropheryma Whippelii ist der Erreger des Morbus Whipple. Symptome sind Diarrhoe und Malabsorption, extraintestinal können Polyarthritis, Uveitis und neurologische Symptome auftreten.
Diagnostik: Histologie, PCR (Kultur, Serologie)
Therapie: Penicillin plus Aminoglykosid, Cotrimoxazol
Spirochäten
Spirillen, Bakterien mit spiraligem Aussehen.
Borrelien
| Borrelien | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|
Borrelien sind eine Gruppe relativ großer, schraubenförmiger Bakterien aus der Gruppe der Spirochäten. Benannt wurden sie nach Amédée Borrel, einem bekannten Bakteriologen aus Strasbourg (1867–1937). Borrelien haben sehr wenige, relativ große Windungen und lassen sich im Unterschied zu anderen Spirochätengattungen mit üblichen Färbemitteln gut darstellen. Reservoirwirte sind unter anderem kleine Nager wie beispielsweise Ratten und Mäuse, von denen sie dann mittels Vektoren wie zum Beispiel Zecken auf die unterschiedlichsten Lebewesen übertragen werden. Viele Tiere sind gegen die Borrelien immun, andere wiederum nicht, so z.B. Pferd, Hund und Mensch.
Die wichtigsten Borrelien sind:
- Borrelia burgdorferi: Diese Bakterien wurden erst 1982 bekannt, als die Erreger der durch Zecken (in Deutschland Holzbock Ixodes ricinus, in den USA Ixodes dammini) übertragenen Lyme-Borreliose. Aufgrund der Zeckenaktivität häufen sich die Infektionen vor allem im Sommer und Herbst, die Durchseuchung der Zecken kann sehr stark regional variieren (5 % bis 60 %). Kennzeichen der Erkrankung sind vor allem Kopfschmerzen, Erythema migrans und arthritische Beschwerden, viele weitere Symptome können folgen.
- Borrelia recurrentis: Bei diesen Borrelien handelt es sich um die Erreger des Läuserückfallfiebers und werden durch die Kleiderlaus (Pediculus humanus) übertragen. In früheren Zeiten kam es zu regelrechten Epidemien der Krankheit, vor allem in Gegenden mit mangelnder Hygiene und starken Läusebefall, heute ist sie vor allem in den kühleren Gebieten Afrikas, Südamerikas und Asiens verbreitet. Kennzeichnend für die Krankheit sind starke Fieberschübe.
- Borrelia duttoni: Auch diese Borrelien werden durch Zecken (Lederzecke Ornithodorus moubata) übertragen und sind die Ursache des Zeckenrückfallfiebers. Diese Krankheit entspricht im wesentlichen dem Läuserückfallfieber, ihr Vorkommen ist jedoch auf die wärmeren Gebiete der Tropen und Subtropen beschränkt.
Daneben kommen regional verbreitet weitere Borrelien vor, die Erkrankungen ähnlich dem Rückfallfieber auslösen können.
Weblinks:
Borrelia burgdorferi
Ep.: Mitteleuropa, USA, Asien
Unterarten: Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. b. garinii, B. b. afzelii, B. b. valaisiana.
Vektor: Zecken der Gattung Ixodes („Holzbock“).
Inkubationszeit: Wenige Tage bis 5 Monate
Krankheitsbilder und Erreger:
| Erreger | Vorkommen | Rel. Häuf. in Europa | Häufigste Manifestation | Krankheitsbilder |
|---|---|---|---|---|
| Borrelia burgdorferi sensu stricto | USA, Europa | 1 | Gelenke | Erythema migrans, Lyme-Disease, Arthritis |
| B. b. garinii | USA, Europa, Asien | 7 | Nerven | Erythema migrans, Neuroborreliose |
| B. b. afzelii | Europa | 3 | Haut | Erythema migrans, Acrodermatitis chronica atrophicans |
| B. b. valaisiana | Europa | Erythema migrans |
Borrelia burgdorferia befällt hauptsächlich Haut, Gelenke und Nervensystem. In Europa dominieren die Unterarten garinii und afzelli, so dass sich die Borreliose bei uns in folgender Verteilung präsentiert: 50 % Erythema chronicum migrans, 39 % neurologische Symptome, 10 % Arthritis, 7 % Acrodermatitis chronica atrophicans, 1 % Karditis, 0,2 % Augenbefall. Die Borreliose verläuft meist in mehreren Stadien.
Verlauf:
- I. (Tage – Wochen): Erythema chronicum migrans, Lymphozytom, Arthralgien, Myalgien
- II. (Wochen – Monate): Akut intermittierende Mono-/Oligoarthritiden, Meningopolyneuritis (Garin-Bujadoux-Bannwarth), Fazialisparese, Peri- und Myocarditis (AV-Block)
- III. (Monate – Jahre): Acrodermatitis chronica atrophicans, chronische Oligoarthritis, Enzephalopathie
Manifestationen:
- Haut
- Erythema chronicum migrans („Wanderröte“): Scheibenförmiges Erythem, das sich langsam zentrifugal um die Zeckenstichstelle ausbreitet, auch multipel auftretend. Evtl. Begleitsymptome mit Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen. Im roten Randsaum befinden sich die Borrelien.
- Acrodermatitis chronica atrophicans (Morbus Herxheimer): Im infiltrativen Stadium findet man eine meist oligosymptomatische lividrote ödematöse Schwellung meist eines Beines. Im Verlauf atrophiert die Haut irreversibel, die Atrophie erscheint „zigarettenpapierartig“.
- Lymphozytom (Lymphadenosis cutis benigna): Mäßig weiche livid-rötliche Knoten mit Prädilektionsstellen an Ohrläppchen, Mamillen und Genitalbereich. Die Inkubationszeit beträgt Wochen bis Monate. DD.: Lymphom, Pseudolymphom, Mastozytom.
- Myositis, Karditis
- Nervensystem, hier ist von peripher bis zentral alles möglich.
- Vasculäre Neuritis, Mononeuritis, Mononeuritis multiplex, Polyneuritis, Neuritis cranialis (Fazialis, Trigeminus u.a.)
- Plexusneuritis, Meningopolyneuritis GBB (Garin-Bujadoux-Bannwarth), Meningoradikulitis
- Myelitis, Polyradikulomyelitis, Polyradikulomyelomeningitis
- Enzephalomyelitis, Meningitis, Akute Herdenzephalitis, zerebrale Vasculitis (Schlaganfall!), Akute Meningoenzephalitis
- Gelenke: Arthralgien, Arthritis
- Augen: Konjunktivitis, Iritis, Uveitis
Diagnostik: Neuroborreliose: Anamnese (Zeckenstich, Erythema migrans, Beruf/Freizeitverhalten) und Klinik, im Liquor sind Zellzahl und Eiweiß erhöht (DD: Polyradikulitis Guillain-Barré, parainfektiös, Im Liquor Zellzahl normal, Eiweiß erhöht durch Schrankenstörung). Mikrobiologisch: EIA oder indirekte Immunfluoreszenz. Positive Antikörpertiter sind wenig aussagekräftig, da sehr verbreitet.
Therapie: ECM: Doxycyclin p.o., Kinder Amoxicillin. Neuroborreliose: Ceftriaxon o.a. i.v.
Leptospira interrogans
| Leptospira | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
|
Leptospiren (in Westeuropa vor allem Leptospira interrogans) sind die Erreger der Zoonose Leptospirose oder Weil-Krankheit, auch Morbus Weil oder Weilsche Krankheit (nach dem deutschen Mediziner Adolf Weil).
Morphologie und Eigenschaften: Leptospiren sind Spirochaeten.
Krankheitsbild: Der Morbus Weil äußert sich durch schlagartigen Beginn mit grippeähnlichen Symptomen, Fieber, Hepatitis, Meningitis oder Nierenentzündung.
Infektionsweg: Der Infektionsweg erfolgt über die Aufnahme von z.B. mit infektiösem Ratten- oder Schweineurin kontaminierten Medien, wie verunreinigtes Abwasser oder Erdreich, über die aufgeweichte oder nicht intakte Haut oder über die Schleimhaut. Möglich ist auch eine aerogene Aufnahme, d.h. eine Aufnahme über die Atemwege. Die Inkubationszeit beträgt 7 bis 12 Tage.
Epidemiologie: In Deutschland werden 15 bis 20 Fälle pro Jahr gemeldet. Die Leptospirose tritt in Europa vor allem bei Personen auf, die mit Medien in Kontakt kommen, welche durch den Urin von Ratten kontaminiert sind, allerdings kommen auch Schweine als Überträger in Betracht.
Diagnostik: Anamnese (Bodensanierung, Abwasser, Landwirtschaft), klinisches Bild, ?
Therapie: Die Erkrankung geht unbehandelt im Gegensatz zu anderen Leptospirosen oft tödlich aus. Eine frühzeitige antibiotische Therapie ist daher obligat.
Prophylaxe:
- Rattenbekämpfung (Da Ratten ihre Nachwuchsrate am Nahrungsangebot und an der Rattenpopulationsdichte ausrichten ist Nahrungsverknappung sinnvoller als jedes Rattengift, d.h. Küchenabfälle und andere organische Abfälle, die als "Rattennahrung" in Betracht kommen sollten nicht offen gelagert, nicht über die Toilette oder in der Landschaft entsorgt werden.)
- Arbeitsschutz: die Vermeidung von Haut-, Augen- und Schleimhautkontakt mit Abwasser oder kontaminierten Böden, die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe und Wathosen im Abwasser) sowie nach der Arbeit im Abwasserbereich oder bei der Bodensanierung Kleidungswechsel, Hautreinigung, Händedesinfektion.
Weblinks: RKI - Leptospirose
Treponema pallidum
| Treponema sp. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||
|
Treponema pallidum pallidum ist ein schraubenförmig gewundenes Bakterium aus der Familie der Spirochäten. Bei dem Bakterium handelt es sich um den Erreger der Syphilis. Die Subspezies T. pallidum endemicum ist Erreger der nicht venerischen Syphilis, T. pallidum pertenue der Framboesie und T. pallidum carateum der Pinta.
Morphologie und Eigenschaften: Das Bakterium überlebt Temperaturen von über 40°C weder außerhalb noch innerhalb des Körpers. Es ist 5-15µm lang und 0,2µm breit, besitzt 10-20 Windungen und kann sich durch Rotation um seine Längsachse bewegen. Aufgrund der feinen Struktur ist die Darstellung mit Färbungen in der Mikroskopie schwer möglich, die Methode der Dunkelfeldmikroskopie lässt aber Lebendbeobachtungen zu. Ein kultureller Nachweis ist bislang nicht möglich.
Treponema p. pallidum
Krankheitsbild: Treponema p. pallidum ist der Erreger der Syphilis (lat. Lues venerea), auch Lues oder Ulcus durum (harter Schanker), einer ansteckenden und meldepflichtigen Geschlechtskrankheit.
Infektionsweg: Die Übertragung erfolgt sexuell oder perinatal.
Stadien: Primärstadium, L1 (Lues 1) - Drei bis vier Wochen nach der Ansteckung erscheint an der Stelle der Infektion (Oropharynx, Genitalien, Enddarm o.a.) ein schmerzloses, hartes, gerötetes Geschwür mit erregerreicher farbloser Sekretabsonderung (Primäraffekt, Schanker). Ein bis zwei Wochen später schwellen die regionären Lymphknoten an und werden hart (daher der Name "harter Schanker"). Von diesem Zeitpunkt an kann die Krankheit mit dem TPHA-Test (Treponema pallidum Hamagglutinationstest) nachgewiesen werden. Auch unbehandelt heilen die Geschwüre von selbst nach einigen Wochen ab, wodurch die Erkrankung oft ignoriert oder nicht erkannt wird.
Sekundärstadium, L2 - Etwa acht Wochen nach der Ansteckung kommt es durch die Ausbreitung der Erreger im Körper oft zu grippeartigen Beschwerden wie Fieber, Abgeschlagenheit oder Kopf- und Gliederschmerzen mit generalisierter Lymphadenopathie. Nach etwa zehn Wochen erscheint bei den meisten Erkrankten ein Exanthem. Zunächst sind es nur schwachrosa gefärbte Flecken, die sich in derbe, kupferfarbene Knötchen (Papeln) verwandeln. Breite Papeln, die besonders in Hautfalten auftreten, nennt man Condylomata lata. Wenn diese aufgehen und nässen, ist die austretende Flüssigkeit wieder hoch infektiös. Seltener treten auch Schleimhautveränderungen im Mund und an den Genitalien auf. Manchen Patienten fallen die Haare aus. Alle Hauterscheinungen (Syphilide) heilen nach ungefähr vier Monaten ab, so dass manche Patienten von ihrer Infektion nichts wissen. Unbehandelt kommen sie aber innerhalb verschiedener Zeitabstände wieder. Typischerweise tritt bei allen Hauterscheinungen der Syphilis kein Juckreiz auf.




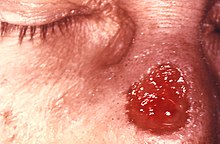
Latenzphase - Für viele Erkrankte kann die Syphilis jetzt zu einem Stillstand kommen, der jedoch jederzeit, nach Monaten oder Jahren unterbrochen werden kann und dann zur Spätsyphilis führt. Die Erreger sind jedoch immer noch im Körper des Betroffenen. Er ist somit immer noch ansteckend, auch wenn diese Gefahr sinkt, je länger der Patient beschwerdefrei bleibt.
Tertiärstadium, L3 - Drei bis fünf Jahre später sind haben sich die Erreger im ganzen Körper ausgebreitet und befallen die inneren Organe. Es bilden sich Knoten, die oft gummiartig verhärtet sind (Gummen). Auf der Haut bilden sie mitunter große Geschwüre, am Gaumen entsteht unter Umständen ein Loch zur Nasenhöhle. Wenn diese Knoten aufbrechen, zerstören sie das umgebende Gewebe. Besonders gefährlich ist ein syphilitischer Knoten an der thorakalen Aorta (Mesaortitis luica). Ab L3 sind die Erreger nicht mehr nachweisbar.
Quartärstadium, Neurolues, L4 - Ohne Behandlung kommt es zehn bis zwanzig Jahre nach Beginn der Erkrankung zum Befall des Nervensystems (progressive Paralyse, Tabes dorsalis). Ein Viertel der unbehandelten Patienten erkrankt an chronischer Enzephalitis (Syphilis cerebrospinalis), die zu Demenz führt. Neben der progressiven Lähmungen treten oft Kreislauf- oder Knochenschäden auf.
Geschichte: 1495 trat die Syphilis zum ersten Mal bei der Belagerung Neapels durch den französischen König Karl VIII. auf. Daraufhin überzog innerhalb von fünf Jahren eine Syphilis-Epidemie ganz Europa. Den Verlauf ihrer Ausbreitung kann man an den Namen erkennen, die die verschiedenen Völker ihr gaben, je nachdem, wo man die Quelle der Ansteckung vermutete:
- Italien: Französische oder keltische Krankheit
- Frankreich: Italienische oder neapolitanische Krankheit
- Spanien: Französische Krankheit
- England: Französische Krankheit
- Schottland: Englische Krankheit
- Deutschland: Französische Krankheit
- Polen: Deutsche Krankheit
- Ungarn: Französische Krankheit
- Russland: Polnische Krankheit
- Mongolei: Russische Krankheit
- Japan: Chinesisches Himmelsstrafengeschwür
Nach der Kolumbus-Theorie wurde die Syphilis von Christoph Kolumbus bzw. seinen Matrosen eingeschleppt, als er 1493 nach der Entdeckung Amerikas 1492 nach Europa zurückkehrte. Inzwischen gilt die Kolumbus-Theorie als widerlegt. Der Engländer Dr. Simon Mays begründet seine präkolumbianische Theorie auf Knochenfunde, die auf die Zeit von 1296 - 1445 datiert wurden. Spezifische Veränderungen an den Knochen lassen mit großer Sicherheit auf eine Infektion mit Syphilis schließen. Die bedeutendsten Funde dieser Art stammen aus Riverhall, Essex in England. Demnach trat die Syphilis also bereits deutlich früher als 1495 zuerst in England auf. Es gibt weitere Hinweise, dass die Syphilis in einer harmloseren Form, als Hautkrankheit, schon im alten Griechenland oder im präkolumbianischen Amerika existierte.
Der Name Syphilis geht auf ein 1530 veröffentlichtes Gedicht des venezianischen Gelehrten Girolamo Fracastoro zurück. Die Reinzüchtung des Syphiliserregers gelang 1911 erstmals dem japanischen Bakteriologen Noguchi Hideyo.
Eine der größten Medizinskandale der USA war die Tuskegee Syphilis Study im Ort Tuskegee im US Staat Alabama, in dem etwa 400 schwarze und gleichzeitig meist arme und analphabetische Einwohner mit bekannter Syphilis bewusst nicht mit dem zur Verfügung stehendem Penicillin behandelt wurden, um die Spätfolgen der Infektion beobachten zu können. Die beobachteten Personen wurden nicht über die Studie informiert und auch nicht darüber, dass in der Zwischenzeit eine effektive Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung stand. Die „Studie“ begann im Jahre 1932 und endete erst 1972, als Einzelheiten an die Öffentlichkeit durchsickerten.
Das Robert-Koch-Institut in Berlin gab im Oktober 2004 bekannt, dass die Zahl der Syphilisinfektionen in Deutschland 2003 im Vergleich zum Vorjahr um weitere 20% angestiegen sei und schlug vor allem für die bundesdeutschen Großstädte Alarm.
Behandlungsmethoden früher und heute: Die Syphilis wurde bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem hochgiftigen Quecksilber behandelt, mit dem man den Körper des Erkrankten großflächig bestrich, was gewöhnlich zu einem vollständigen Ausfall der Körperbehaarung sowie sämtlicher Zähne führte und den rapiden Verfall sämtlicher Körperfunktionen einleitete.
 |
 |
- Die südamerikanischen Indianer verfügten über eine kombinierte Syphilistherapie, die ihnen in der Regel auch Heilung verschaffte, denn die Krankheit verlief bei ihnen weniger schwer als bei Europäern. Sie verwendeten Abkochungen aus dem Holz oder der Rinde des Guajakbaumes (Guaiacum officinale und G. sanctum) oder der Sarsaparillewurzeln (Smilax regelii u.a. Arten) in Kombination mit einem Schwitzbad und einer Fastenkur. Das Schwitzbad, dem sich die Indianer nach Einnahme von Guajak unterzogen, bestand in einer gezielten Heißbedampfung der äußeren Genitalien.
- Der Humanist Ulrich von Hutten hat diese Methode im Selbstversuch erprobt und in seinem 1519 erschienenen Werk "De guajaci medicina et morbo gallico liber unus" beschrieben. Tatsächlich trat durch die Behandlung zeitweilig eine Verbesserung ein.
- Um 1900 fand man heraus, dass Treponema pallidum Temperaturen von über 41 °C nicht überlebt. Daraufhin infizierte man Syphiliskranke absichtlich mit Malaria. Häufig genügten die hohen Malariafieberschübe, den Syphiliserreger abzutöten (Malariatherapie). Die Risiken und Nebenwirkungen waren nicht unerheblich, einer tertiären Syphilis waren sie jedoch durchaus vorzuziehen. 1909 entwickelt Paul Ehrlich Salvarsan, ein weniger giftiges, aber wirksames arsenhaltiges Mittel.
Heute wird die Syphilis mit Antibiotika behandelt und ist im ersten und zweiten Stadium heilbar. Im dritten Stadium bleiben oft Spätschäden.
Literatur und Weblinks:
- Birgit Adam: Die Strafe der Venus. Eine Kulturgeschichte der Geschlechtskrankheiten. Orbis, 2001, ISBN 3-572-01268-6
- RKI - Syphilis
- RKI - Sexuell übertragbare Erkrankungen (STD)
- www.cdc.gov CDC - Tuskegee Experiment
- GPC - Internet Resources on the Tuskeegee Study
Quellen
- ↑ Ferreri AJ et al. “Bacteria-Eradicating Therapy With Doxycycline in Ocular Adnexal MALT Lymphoma: A Multicenter Prospective Trial”. J Natl Cancer Inst, 98(19):1375-82, Oct 4 2006. DOI:10.1093/jnci/djj373. PMID:17018784
- ↑ . “Antibiotikum hilft gegen Augen-Lymphom”. Deutsches Ärzteblatt, 5. Okt 2006.
Allgemeine medizinische Mykologie

Pilze (Fungi, Mycetes) sind heterotroph lebende, chlorophyllose, eukaryontische Lebewesen. Sie besitzen häufig eine Zellwand, die aus Zellulose, Chitin, Proteinen, Glucan- und Mannanpolymeren aufgebaut sein kann. Von den etwa 100.000 beschriebenen Pilzarten verursachen etwa 100 regelmäßig Mykosen und einige hundert sind als Erreger opportunistischer Pilzinfektionen bekannt.
Morphologie
Es gibt prinzipiell zwei Wachstumsformen. Hyphomyzeten (Schimmelpilze, Dermatophyten) bilden sich verzweigende Pilzfäden, sog. Hyphen, die septiert oder unseptiert sein können. Die Gesamtheit des Hyphengeflechts nennt man Myzel. Das vegetative Myzel ist die Wachstumsform, das fruktitative Myzel dient der Fortpflanzung. Die Hyphomyzeten lassen sich in die (ungefärbt) transparenten Hyalohyphomyzeten und die melaninhaltigen, braunen bis schwarzen Phaeohyphomyzeten einteilen.
Neben dem Hyphenwachstum der Hyphomyzeten stellt die Zellsprossung den zweiten wichtigen Wachstumsmodus bei Pilzen dar. Einige Candida-Arten können ein Pseudomyzel durch Längenwachstum der aussprossenden Tochterzellen (Blastosporen) ausbilden, wobei zwischen den Zellen deutliche Einziehungen verbleiben (im Ggs. zum echten Myzel, wo zuerst die Zellwand und dann die Septen gebildet werden). Invasiv ins Gewebe wachsender C. albicans kann auch echte Myzelien bilden. Zusätzlich findet man bei einigen Hefepilzen dickwandige Dauersporen, sog. Chlamydosporen, deren Aussehen sich bei manchen Arten, z.B. C. albicans auch zur Spezies-Differenzierung heranziehen läßt.
Vermehrung
Pilze können sich ungeschlechtlich (als Anamorph) und geschlechtlich (als Teleomorph) vermehren. Beides geschieht über die Bildung von Sporen. Bei Spezies, von denen nur die erste Form bekannt ist spricht man von Fungi imperfecti. Letzteres trifft auf die meisten pathogenen Pilze zu.
Die ungeschlechtlichen Sporen heißen Konidiosporen bzw. [[Konidien.
Einteilung der Pilze
Pilze lassen sich taxonomisch nach dem Verwandtschaftsgrad einteilen. Für den klinischen Gebrauch hat sich die Einteilung der Pilze nach dem DHS-Schema (nach Rieth) eingebürgert in
- Dermatophyten
- Schimmelpilze und
- Hefen
Eine Zwischenstellung nehmen dimorphe Pilze ein, die sowohl als Hefe (Y-Form), als auch als Schimmel (M-Form) vorkommen können.
Krankheitsbilder
Man unterscheidet 5 Mykopathien, d.h. durch Pilze verursachte Erkrankungen:
- Myzetismus - Pilzvergiftungen durch den Genuß von Giftpilzen (z.B. von Amanita phalloides).
- Mykotoxikosen - Vergiftungen durch mit Pilzgiften (z.B. Aflatoxin) verunreinigte Lebensmittel.
- Mykoallergosen - Allergische Erkrankungen durch Pilzbestandteile.
- Mykotisation - Lokal begrenzte, nicht-invasive Besiedelung von (pathologischen) Hohlräumen, z.B. das Aspergillom in einer Tbc-Kaverne.
- Mykosen - Invasives Wachstum von Pilzen im lebende Gewebe.
Einteilung der Mykosen
Die Mykosen lassen sich nach der bevorzugten Lokalisation einteilen in (Sub)Kutane Mykosen, Schleimhautmykosen, opportunistische System- und Organmykosen und außereuropäische System- und Organmykosen durch obligat pathogene Pilze.
Opportunisten
Klinische Konstellationen, die an eine opportunistische Mykose denken lassen sollten!:
- Disponierende Risikofaktoren: (Zelluläre) Immundefekte, Neutropenie, Immunsuppression (Kortikoidtherapie, Immunsuppressiva z.B. nach Transplantation), Malignome, Chemotherapie, schwere Allgemeinerkrankungen, Diabetes mellitus, Katheter u.a.m.
- Klinisches Bild mit uncharakteristischem, Antibiotika-refraktärem Fieber mit untypischen Befunden.
Candida albicans
| Candida albicans | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||
|
Candida albicans ist ein Pilz der Candidagattung, die zu den Hefepilzen gehören. 90% der Kandidosen (auch Candidiasis oder Soor) werden von Candida albicans verursacht und er ist der häufigste Erreger opportunistischer Mykosen.
Morphologie und Eigenschaften: Candida albicans ist ein Gram-positiver, polymorpher Pilz, d.h. er bildet unterschiedliche Wachstumsformen aus. Die einzelnen Pilzzellen sind rundlich-oval und haben einen Durchmesser von ungefähr 4µm . Typisch für Candida albicans sind sowohl die Bildung von Pseudomyzelen (Fadenform) als auch die Bildung von echten Hyphen, d.h. septierten Myzelien (eher bei invasiven Wachstumsformen). Einzelne Myzelfäden können bereits mit bloßem Auge im Untersuchungsmaterial erkannt werden. Candida bildet auch elongierte Sprosszellen, sog. Blastokonidien. Auch Dauersporen, die sogenannten Chlamydosporen, sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von C. albicans zu anderen Hefen. Die Chlamydosporen bilden eine widerstandsfähige Zellwand und sind größer als Blastokonidien. C. albicans besitzt als diploider Organismus ein Genom mit einer Größe von 16 Megabasenpaaren, welches auf 2x8 Chromosomen verteilt ist. Bislang ist bei diesem Pilz kein sexuelles Stadium bekannt, so dass er zu den Fungi imperfecti zählt. Candida lässt sich gut unter Zugabe von Antibiotika (Unterdrückung von Bakterienkolonien) auf einfachen Nährböden anzüchten und bildet z.B. auf Sabourraud-Glucose-Agar cremefarbene, meist glatte Kolonien. Die Identifizierung gelingt bspw. mit Hilfe des Germinationsschlauch-Tests (GTT), biochemisch oder mittels Antigentest.
Vorkommen: Candida albicans ist bei Warmblütern häufig symptomlos auf den nasopharyngealen, intestinalen und urogenitalen Schleimhäuten zu finden, ebenso in den Interdigitalfalten. Etwa 75% der Gesunden sind Träger, im Darm ist er bei jedem zweiten Gesunden zu finden.
Krankheitsbilder: Als fakultativ pathogener Kommensale kann er unter geeigneten Bedingungen, bes. bei Störungen der zellulären Immunität (AIDS, Zytostatikatherapie, Antibiotikatherapie, Diabetes mellitus, Immundefekte...) eine endogene, opportunistische Mykose, die Kandidose (auch Candidose, Candidiasis, Candidamykose) hervorrufen. Die Candidamykose kann sich kutan (interdigital), mucokutan (Soor: Stomatitis candidomycetica, Soorösophagitis, Vaginitis usw.), Organbezogen (Organkandidose) oder systemisch als Candida-Sepsis manifestieren. Der Soor zeichnet sich durch weisse bis gelbliche, abwischbare Beläge auf schmerzhaft gerötetem und leicht blutendem Grund aus, die Umgebung ist meist nicht schmerzhaft.

Für die Existenz eines "Candida-Hypersensitivitäts-Syndroms" bzw. "Candidasyndroms" alias "Darmpilze" als mutmaßliche Ursache unterschiedlichster Beschwerden, die mit speziellen "Anti-Pilz-Diäten" (und Antimykotika) behandelt werden soll gibt es bisher keine wissenschaftliche Evidenz (Siehe Weblinks).
Diagnostik: Die Diagnose einer Candidiasis lässt sich mikroskopisch stellen, entweder durch den Nachweis aus Sterilkompartimenten oder bei Haut- oder Schleimhauterkrankung bioptisch-histologisch (der Abstrich reicht nicht aus, Normalflora!). Das Anlegen einer Kultur ist allerdings obligat. Die Identifizierung erfolgt z.B. über den Germinationsschlauchtest (GTT), biochemisch oder über Antigennachweis. Bildgebende Verfahren wie Gastroskopie, Sonographie, Röntgen und CT zeigen das Vorhandensein einer Infektion innerer Organe an. Systemische Infektionen mit Candida sind dann nur aus Blut-, Liquor- und Urinkulturen nachzuweisen. Falsch positive und - gerade bei der Sepsis - auch falsch negative Befunde sind nicht selten. Die Aussagekraft von Antikörpernachweisen im Venenblut ist umstritten, da Antikörper lange nach einer Infektion erhalten bleiben.
Therapie: An erster Stelle steht die Behandlung der Grunderkrankung und das Beseitigen disponierender Faktoren. Der Candida-Befall der Haut und Schleimhaut kann mit Nystatin, Amphotericin B oder Azolen behandelt werden, invasive Mykosen mit Amphotericin B (+ Nystatin) und Azolen.
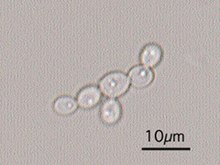 |
 |
 |
Weblinks:
Aspergillus sp.
| Aspergillus sp. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
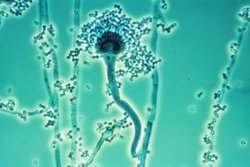 | ||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||
|
Aspergillus sp. ist eine Schimmelpilzgattung mit rund 200 Arten weltweit. Der Pilz tritt in zwei morphologischen Formen auf: In Schimmelform und in Hefenform.

Seine natürlichen Lebensräume sind Heu und Kompost. 1729 wurde Aspergillus vom italienischen Priester und Biologen P. Micheli zum erstenmal beschrieben. Das mikroskopische Bild des Pilzes erinnerte ihn an einem Aspergil (Weihwasserwedel), daher stammt der Name. Es ähnelt auch einem Gießkannenkopf, oder einem Aspergil, aus dem gerade Wasser austritt. Daher rührt auch der gelegentlich verwendete deutsche Name Gießkannenschimmel.
Morphologie und Eigenschaften:

Aspergilli sind aerobe Pilze mit Spezies-spezifischer Morphologie. Sie leben praktisch in allen sauerstoffreichen Umgebungen, gewöhnlich auf kohlenhydratreichen Substraten (Brot, Pistazien, Heu u.a.). Manche Aspergillus-Arten könne auch Ammoniak und Nitrate verwerten.
Wirtschaftliche Bedeutung: Aspergillus-Arten sind die wirtschaftlich wichtigsten Pilze. Sowohl primäre als auch sekundäre Stoffwechselprodukte werden verwendet. A. niger z.B. produzieren über 99% des weltweiten Zitronensäure-Bedarfes. Diese Art wird auch für die Produktion von Lysozym und Glucoseoxidase verwendet.
Krankheitsbilder: Aspergillus sp. können verschiedene Krankheitsbilder verursachen:
- Allergie: Die allergische bronchopulmonale Aspergillose bzw. die exogen-allergische Alveolitis durch A. fumigatus und A. clavatus
 |
 |
- Mykotoxikose: Vergiftungen durch Schimmelpilzgifte. Das Aflatoxin B1 von A. flavus kann beispielsweise Leberkarzinome auslösen.
- Nicht invasive Aspergillose: Das Aspergillom ("Pilzball") kann Nasennebenhöhlen, Emphysemblasen und Tbc-Kavernen ausfüllen.
- Invasive Aspergillose: Diese tritt vorwiegend bei Immunsupprimierten auf, pulmonal oder systemisch-disseminiert. Die Affinität zu Blutgefäßen führt gerne zu hämorrhagischen Nekrosen. Sie ist nach der Candidose die zweithäufigste invasive Mykose. In 80 % der Fälle wird A. fumigatus isoliert.
Diagnostik: Mikroskopie, Kultur von Proben (BAL, Biospie), Serologie (Antigen- und Antikörper), Röntgen Thorax
Therapie: Allergie: Expositionsvermeidung, medikamentös ähnl. Asthmatherapie; Aspergillom: Amphotericin B i.v. und Chirurgie; Invasive Aspergillose: Amphotericin B (evtl. plus Flucytosin), Azol-Antimykotika.
Weblinks: The Aspergillus Website
Cryptococcus neoformans
| Cryptococcus neoformans | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||
|
Cryptococcus neoformans ist der wichtigste Erreger der Kryptokokkose. Es ist ein Hefe-ähnlicher, bekapselter Pilz mit weltweiter Verbreitung. Im Gegensatz zur Backhefe (Schlauchpilze) gehört der Kryptokokkose-Erreger zu den Basidienpilzen.
Morphologie und Eigenschaften: Cryptococcus neoformans-Spezies sind etwa 4µm große, Gram-positive Hefepilze, die im Präparat Sprossungen und charakteristische Größenunterschiede zeigen. Der Pilz ist von einer mehrere Mikrometer dicken Schleimkapsel umhüllt, die sich z.B. im Tuschepräparat darstellen lässt.
Das ungeschlechtliche Stadium von Cryptococcus neoformans, die Anamorphe, heißt Filobasidiella neoformans und wurde 1976 durch Kwon-Chung beschrieben.


Vorkommen und Übertragung: Reservoir des Pilzes sind vor allen Vögel. Die Übertragung erfolgt durch Einamtmung von erregerhaltigem Stäuben von Vogelkot.
Krankheitsbilder: Die Kryptokokkose ist insgesamt selten, wird als opportunistische Pilzerkrankung aber z.B. häufig bei AIDS-Patienten beobachtet. Sie kann sich pulmonal, zerebral und mukokutan manifestieren.
Therapie: Amphotericin B (ggf. plus Flucytosin), Azole
Pneumocystis jiroveci
| Pneumocystis jiroveci | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|


Morphologie, Eigenschaften und Lebenszyklus: Pneumocystis jiroveci ist ein 1,5 bis 2µm rundlicher Pilz. Nach der Einatmung von sporenhaltigen Zysten in die Lunge entwickeln sich darin je 8 amöboid bewegliche Trophozoiten, die nach kurzer Zeit schlüpfen und sich asexuell durch Teilung vermehren. Zwei dieser Trophozoiten können zu einer Zygote fusionieren (sexuelle Phase) und sich zu einer neuen Zyste entwickeln, in der durch Teilung wieder 8 neue Sporozoiten bilden.
Histologisch zeigen sich in der Grocottfärbung 4-7µm große, runde bis tassenförmige Zysten mit oder ohne kleine dunkle Punkte (Sporozoiten).
Im Labor kann er nicht auf Nährmedien gezüchtet werden. Der Erreger wird den Schlauchpilzen (Ascomycota) zugeordnet.
Vorkommen: Der Pilz wird bei vielen Tieren inklusive dem Menschen symptomlos in der Lunge gefunden.
Krankheitsbilder: P. jiroveci ist ein opportunistischer Erreger einer interstitiellen Pneumonie, die besonders bei Defekten der zellulären Immunität, z.B. bei AIDS auftritt.
Taxonomie: Früher wurde der P. jiroveci als P. carinii bezeichnet. Diese Bezeichnung ist heutzutage zwar noch verbreitet, aber formal nicht mehr zulässig. Es konnte gezeigt werden, dass der im Mensch vorkommende Erreger sich von dem in der Ratte entdeckten P. carinii unterscheidet.
Diagnose: Der Erreger kann nicht in vitro kultiviert werden. Der Nachweis erfolgt direkt mikroskopisch im Material aus der bronchoalveoläre Lavage (BAL) oder Lungenbiopsie, mit Immunfluoreszenz oder PCR.
Therapie: Cotrimoxazol oder Pentamidin
Zygomyzeten (Mucorales)
| Mucorales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||
|
Pilze der Ordnung Mucorales (Köpfchenschimmel) mit den Gattungen Absidia, Cunninghamella, Mucor, Rhizomucor und Rhizopus sind typische Opportunisten und Auslöser der eher seltenen Mucor-Mykosen (Zygomykosen). Die Mucorales können ein breites Spektrum anatomischer Lokalisationen befallen. Typische Manifestationen sind
- korneal (meist nach Verletzungen)
- rhinozerebral
- pulmonal
- enteral und
- kutan
 |
 |
Primärpathogene invasive Pilze
Histoplasma capsulatum
| Histoplasma capsulatum | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
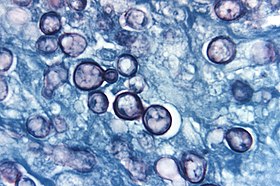 | ||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|
Morphologie unmd Eigenschaften: Histoplasma capsulatum ist ein temperaturabhängig dimorpher Pilz, der bei 25°C die Schimmelform, bei 37°C die Hefeform annimt. Der Pilz zeigt Mikro- und Makrokonidien. Die bei Körpertemperatur geformten ovoiden Hefezellen, die sich im Gewebe oft in Makrophagen finden, sind bei Histoplasma capsulatum var capsulatum kleiner (2-4µm) als bei Histoplasma capsulatum var duboisii (12-15µm).

Vorkommen: Histoplasma ist vor allem in den (sub)tropischen Gebieten der Erde zuhause, z.B. in den wärmeren Regionen der USA (Tennessee, Ohio, Mississippi), in Mittel- und Südamerika, in Afrika und Indonesien. Der Pilz findet sich im Boden, besonders gerne im Zusammenhang mit Vogel- oder Fledermauskot.
Krankheitsbilder:
H. capsulatum var capsulatum ist der Erreger der endemisch auftretenden Histoplasmose, einer systemischen Infektionskrankheit mit vorwiegendem Befall der Lunge, die auch bei Gesunden auftreten kann.

Der Erreger vermehrt sich nach Phagozytose im RES. Das klinisch Bild ist variabel und schließt akute, leichte pulmonale Infekte, chronische und disseminierte Verläufe mit ein, wobei die chronischen Verlaufsformen vorwiegend bei pulmonalen Grunderkrankungen und die disseminierten vor allem bei Immunkompromittierten beobachtet werden.
Var. duboisii befällt eher die Knochen und die Haut in Form der afrikanischen Histoplasmose.
Diagnostik: Probengewinnung und Kultur
Therapie: Amphotericin B oder Voriconazol
Coccidioides immitis
| Coccidioides immitis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Coccidioides immitis ist ein atypischer, dimorpher Pilz, der in Kultur ein wolliges Myzel bildet und sich über asexuelle Arthrosporen vermehrt. Im Gewebe bildet der Pilz weder Hyphen noch Sprosszellen, sondern (deswegen atypisch) dickwandige, etwa 15-60µm große, kugelige Gebilde, sog. Sphaerulae, die bis zu 100 kugelig-ovale Endosporen enthalten. Aus freigesetzten Endosporen können wiederum Sphaerulae entstehen.

Vorkommen und Übertragung: Coccidioides immitis ist endemisch im Erdboden in ariden Landstrichen der USA (Kalifornien, Arizona, Texas, Neumexiko und Utah) zu finden.
Krankheitsbilder: Die Infektion mit Coccidioides immitis durch inhalierte Arthrosporen verläuft in 60% der Fälle inapparent. Die manifeste Erkrankung der Kokzidioidomykose äußert sich als Lungenentzündung mit grippeähnlichem Verlauf, Exanthem und Arthralgien („Wüstenrheumatismus“). Die Pilzinfektion kann chronisch-kavernös oder mit septisch-granulomatoiden Absiedelungen in allen Organen und hoher Letalität verlaufen.
Diagnostik: Erregernachweis im Sputum, Kultur (Cave: Hochinfektiöse Arthrosporen!), Serologie
Therapie: Azole per os, bei schweren Formen Amphotericin B oder Voriconazol
 |
Dermatophyten
| Dermatophyten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||
|
Dermatophyten sind keratinophile Fadenpilze, die im wesentlichen drei Gattungen angehören: Trichophyton, Mikrosporum und Epidermophyton. Vom Erscheinungsbild der Erkrankung kann allerdings nicht auf den verantwortlichen Dermatophyten rückgeschlossen werden.
Daneben gibt es noch einige Hefen, die zu Hauterkrankungen führen können, wie z.B. Malassezia spp..
 |
 |
 |
Trichophyton sp.



Morphologie und Eigenschaften: Trichophyton sp. gehört zu den Fadenpilzen (Schimmel).
Vorkommen und Übertragung: Trichophyton spp. besiedeln je nach Art Tiere, Menschen und den Erdboden. Die einzelnen Spezies sind z.T. weltweit verbreitet, z.T. auch nur regional endemisch. Die Übertragung erfolgt direkt von Mensch/Tier zu Mensch oder über unbelebte Gegenstände (Duschen, Umkleideräume).
Krankheitsbilder: Trichophyton ist ein bedeutender Erreger von Haut-, Haar- und Nagelmykosen und kann folgende Hautmykosen auslösen:
- Tinea capitis - T. tonsurans
- Tinea barbae (Bartflechte) - T. rubrum, T. mentagrophytes
- Tinea corporis (Ringelflechte) - T. mentagrophytes
- Tinea cruris - T. rubrum, T. mentagrophytes
- Tinea pedis (Sportlerfuß) - T. rubrum, T. mentagrophytes
- Onychomykose (Nagelmykose) - T. rubrum, T. mentagrophytes
Diagnose: Mikroskopischer Nachweis (Hautgeschabsel, Haare)
Therapie: Azole, Terbinafin
Prophylaxe: Kontaktvermeidung. Desinfektion von Duschen und Umkleiden.
 |
 |
 |
 |
Epidermophyton floccosum

Morphologie und Eigenschaften: Epidermophyton floccosum ist ein Fadenpilz (Schimmelpilz) mit septierten hyalinen Hyphen.
Vorkommen und Übertragung: Die Pilz ist weltweit verbreitet. Die Übertragung erfolgt direkt von Mensch zu Mensch oder über unbelebte Gegenstände.
Krankheitsbilder: Alle Variationen der Tinea (außer Tinea capitis)
Diagnostik: Mikroskopie (Geschabsel, Haare), Kultur
Therapie: Azole lokal, z.B. Ciclopiroxolamin. In schweren Fällen Terbinafin oder Griseofulvin oral.
Prophylaxe: Kontaktvermeidung. Desinfektion von Duschen und Umkleiden.
Mikrosporum sp.
 |
 |
Arten: M. audouinii, M. canis, M. gypseum
Morphologie und Eigenschaften: Mikrosporum ist ein Fadenpilz (Schimmelpilz)
Vorkommen und Übertragung: Mikrosporum ist weltweit verbreitet. Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch, die geophile Spezies M. gypseum führt bei andauernder Exposition zur Erkrankung (Gärtner).
Krankheitsbilder: Alle Formen von Tinea
Diagnostik: Mikroskopie (Geschabsel, Haare), Kultur
Therapie: Terbinafin lokal
Prophylaxe: Kontaktvermeidung. Desinfektion von Duschen und Umkleiden.
Malassezia spp.
| Malassezia spp. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Malassezia spp. sind lipophile Hefen. Mikroskopisch beobachtet man vor allem die hefenartigen Konidien, die oft ein größeres, rundes und ein kleineres, ebenfalls rundes oder zigarrenähnliches Ende besitzen.
Vorkommen und Übertragung: Der Hefepilz ist weltweit verbreitet und Bestandteil der normalen Hautflora (90 % der Erwachsenen).
Krankheitsbilder: Malassezia spp. können verschiedene Hauterkrankungen hervorrufen, so z.B. die Pityriasis versicolor oder Kleienpilzflechte (M. furfur, M. globosa, M. sympodialis). Der meist harmlose epidermal lokalisierte Pilz führt zu überpigmentierten, auf sonnengebräunter Haut zu unterpigmentierten solitären oder konfluiierenden Flecken. Weitere Hautaffektionen sind möglich, so z.B. die Follikulitis oder eine Seborrhoische Dermatitis (M. furfur). Weiterhin können Malassezia spp. Katheter-assoziierte Infektionen (besonders bei Lipidgabe) hervorrufen. Die zoophile und weniger lipophile Spezies M. pachydermatis kann ebenfalls an systemischen Infektionen beteiligt sein.
Diagnostik: Blutkultur, Kultur aus Hautgeschabsel oder Katheterspitze.
Therapie: Azole lokal oder systemisch
 |
 |
 |
Erreger subkutaner Mykosen
Pilzinfektionen der Unterhaut sind hierzulande selten, in Entwicklungsländern häufiger und kommen durch Verletzungen zustande, bei denen Pilzsporen in die Wunde gelangen. Erkrankungen sind:
- Sporotrichose - Sporothrix schenckii
 |
 |
 |
- Chromomykose - Fonsecaea spp., Phialophora spp. u.a.
 |
 |
- Phaeohyphomykose - Cladosporium spp., Wangiella spp., Curvularia spp., Bipolaris spp., Exserohilum spp., Alternaria spp. u.a.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Eumyzetome (Mykotische Myzetome) - Pseudoallescheria spp., Madurella spp., Acremonium spp., Exophiala spp. u.a. Die Erreger bilden schwarze mykotische Granula im befallenen Gewebe.
 |
 |
 |
Literatur und Weblinks
- Robert-Koch-Institut zu Mykosen (Pilzinfektionen)
- Doctor Fungus
Protozoen (Einzeller)
Helminthen (Würmer)
Arthropoden (Gliederfüsser)
Literatur und Weblinks
- http://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/index.html Animal Parasitology - Bilder zahlreicher Parasiten
- http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm CDC’s Division of Parasitic Diseases (DPD) - Parasitologie (CDC)
Protozoen
Flagellaten
Giardia lamblia
| Giardia lamblia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Giardia lamblia syn. intestinalis ist ein einzelliger humanpathogener Parasit. Benannt wurde er nach Alfred Mathieu Giard und Vilem Dusan Lambl. Der Einzeller gelangt üblicherweise als Zyste in kontaminiertem Oberflächenwasser, oder seltener über Kontakte mit Fliegen in den menschlichen Darm. Giardia lamblia ist ein urtümlicher Einzeller, dessen Evolution unter Biologen noch viele offene Fragen aufwirft.
Morphologie und Eigenschaften: Giardia besitzt vier Geißeln, zwei davon entspringen inmitten der Zelle, zwei weitere seitlich. Seine Länge beträgt um die 20μm, außerdem besitzt es eine Haftscheibe, um sich im Darmepithel festzuhalten.
Besondere Merkmale von Giardia lamblia:
- Das Protozoon besitzt keine Mitochondrien und auch keine Peroxisomen, aber Erbgut, das Mitochondriengene enthält. Im Laufe der Evolution hat Giardia ihre Mitochondrien wieder verloren, so die gängige Hypothese.
- Das Genom ist sehr variabel. Es enthält 12 bis etwa 80 Millionen Basenpaare, die auf 8 bis 50 Chromosomen verteilt sind.
- Sexuelle Reifeteilung (Meiose) wird bei dem Urtierchen nie beobachtet, es wurden aber für diesen Prozess zuständige Gene gefunden.
- Im Jejunum liegen nur Trophozoiten vor, im Ileum nur noch Cysten. Fehlendes Cholesterin ist dafür verantwortlich, dass die Trophozoitenoberfläche nicht mehr gebildet werden kann. Dies führt zur sogenannten Encystierung.
Lebenszyklus: Trophozoiten sind die aktive Form des Einzellers im Darm und nur sie pflanzen sich fort. Sie haben eine ovale, langgestreckte Form und in jedem Individuum findet man zwei Zellkerne. Auffallend sind auch mehrere Geißeln und die Haftscheibe, mit der sie sich an das Darmepithel anheften können. Cysten sind die Übertragungsformen und sehr resistent gegenüber Umwelteinflüssen. Sie werden von infizierten Menschen ausgeschieden und können bis zu vier Monate lang im Oberflächenwasser überleben. Im Darm wandeln sich diese wieder in Trophozoiten um.
Krankheitsbild: Im Gegensatz zu Entamoeba histolytica ist Giardia lamblia nicht invasiv, die Schleimhautzellen werden nicht zerstört. Es kommt aber zu einer Einschränkung ihrer Funktion und zu einer Entzündung. Die Symptome einer Giardiasis (Lamblienruhr) sind Durchfall, Blähungen und selten Fieber, in schweren Fällen kommt es zum Malabsorptionssyndrom. In Kanada findet sich die landläufige Bezeichnung Biberfieber (beaver fever), da die Erreger vermeintlich durch Biberkot in das Wasser gelangen.
Ein Problem sind asymptomatische Träger. Diese scheiden unbemerkt monatelang Zysten aus, die bei unzureichender Hygiene andere Personen infizieren können. Das Immunsystem eliminiert die Trophozoiten normalerweise innerhalb weniger Wochen. Die Inkubationszeit beträgt eine bis etwa zehn Wochen.

Epidemiologie: Jedes Jahr erkranken rund 200 Millionen Menschen an Giardiasis und die Krankheit kann in Entwicklungsländern ein bedeutendes Problem darstellen. Die Zahl der Todesfälle, die auf Giardia lamblia zurückzuführen sind, ist jedoch, etwa im Vergleich zu der von Malaria, völlig unbedeutend.
Gardia lamblia wurde bisher in über 140 Ländern gefunden und ist somit weltweit verbreitet. In gemäßigten Zonen sind bis zu 25% der Kinder und 10% der erwachsenen Bevölkerung von ihr befallen. Noch höhere Durchseuchung findet man in den Tropen. In europäischen Ländern führt der Einzeller sehr selten zu Infektionen, aber unter Rückkehrern aus den Tropen beträgt die Prävalenz etwa 4%. Rinder und Schafe sind aber je nach Gegend bis zu 30% infiziert.
Therapie: Zur Behandlung eignet sich Metronidazol, Tinidazol oder Albendazol per os.
Prophylaxe: Trinkwasserhygiene, Händewaschen.
Meldepflicht: In Deutschland besteht eine Meldepflicht bei Infektion durch G. lamblia, nicht jedoch in Österreich und der Schweiz.
Literatur und Weblinks:
Trichomonas vaginalis
| Trichomonas vaginalis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||
|
Trichomonas vaginalis ist ein parasitisch im Urogenitaltrakt des Menschen lebendes Protozoon und Auslöser der Trichomoniasis.

Verbreitung und Übertragung: Der Parasit wird nur durch direkten Kontakt übertragen (Schleimhautkontakt von Mensch zu Mensch). Der Befall gilt daher als echte Geschlechtskrankheit. Trichomonas vaginalis kommt weltweit vor.
Morphologie und Eigenschaften: Trichomonas vaginalis ist unregelmäßig oval und verformbar. Die Länge beträgt bis zu 25µm. Eine Vermehrung findet durch Längsteilung statt. Der Erreger lebt u.a. von Lactobazillen.
Genom: Das Genom von T. vaginalis ist mit 160 Megabasen und 26.000 Genen außerordentlich groß. Der Erreger hat auf seinem evolutionären Weg vom Darm in den Urogenitaltrakt zahlreiche bakterielle Gene akquiriert und sein genetisches Material zusätzlich durch Amplifikationen stark vergrößert. Der Benefit bestand offensichtlich in einer Zunahme der Körpergröße und damit einer Zunahme der Haftfläche an der Schleimhaut.[1]
Lebenszyklus: Trichomonas vaginalis bilden keine Cysten oder Trophozoiten aus und wird nur direkt von Wirt zu Wirt übertragen.
Krankheitsbild: Bei den meisten Männern ist der Befall symptomlos. Vor allem nisten sich Trichomonaden in der Prostata, der Harnröhre und unter der Vorhaut ein. Gelegentlich kommt es zu einer schmerzhaften Urethritis. Selten werden die Samenblasen oder die Prostata befallen. Da bei Männern selten Symptome auftreten, wissen sie nichts von der Infektion und sind hauptsächliche Überträger der Parasiten. Trichomonaden sind außerhalb ihres Lebensraumes nicht lange lebensfähig.

Bei etwa 80 % der Frauen kommt es nach einer längeren Phase ohne Symptome ebenfalls zu Entzündungen in Form einer Trichomonadenkolpitis mit dünnflüssigem, gelblichem Fluor vaginalis, in dem sich neben den Trichomonaden auch Bakterien und Granulozyten finden. Bei Dreiviertel der Patienten ist die Harnröhre befallen. Dagegen sind Infektionen der Gebärmutter und der Harnblase selten. Auch zeitweilige Unfruchtbarkeit wurde beobachtet.
Ist eine Frau mit Trichomonaden infiziert, so erhöht sich ihr Risiko um etwa 50%, sich beim Geschlechtsverkehr mit HIV-1 zu infizieren (RR 1,52; 95%-CI 1,04–2,24). Ein Grund könnten vermehrte Schleimhautläsionen sein. [2]
Diagnostik: Mikroskopischer Nachweis von Trichomonaden im Vaginalabstrich.
Therapie: Metronidazol oder Tinidazol
Prophylaxe: Kondome
Weblinks: . “Trichomonaden-Genom sequenziert – Evolutionäre Herkunft aus dem Darm”. Deutsches Ärzteblatt, 15. Jan 2007.
Leishmania sp.
| Leishmanien | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||
|
Leishmania sp. sind geißeltragenden Protozoen, die als obligat intrazelluläre Parasiten leben und einen Wirtswechsel zwischen Insekten (Phlebotomus sp.: Sandmücken, Schmetterlingsmücken) und Wirbeltieren (Schafe, Hunde, Menschen) vollziehen. Sie verursachen das Krankheitsbild der Leishmaniose.
Verbreitung: Leishmanien sind bis auf Australien auf der ganzen Welt verbreitet und gelten als Auslöser vieler Tierseuchen. Der Mensch wird von weniger Arten befallen, deren Verbreitungsgebiet in den Tropen liegt, besonders im östliche Afrika, aber auch im Mittelmeerraum.

Morphologie und Eigenschaften: Wie alle Flagellaten ändern Leishmanien ihre Form und die Position der Geißel je nach Wirt und Entwicklungsstadium (Nomenklatur wie bei Trypanosomen). Jedoch sind die Leishmanien im Durchschnitt etwas kleiner (Promastigot: 20µm, Amastigot: 2µm).
| Form | Position der Geißel |
|---|---|
| trypomastigot | hinter dem Kern |
| epimastigot | vor dem Kern |
| promastigot | vorderer Zellpol |
| amastigot | Geißel (fast) unsichtbar |
Lebenszyklus: Die Vermehrung der Leishmanien läuft in zwei Wirten ab. Die Sandmücke überträgt beim Stich promastigote Formen auf Wirbeltiere, wo sie von Makrophagen phagozytiert werden und sich in die amastigote (unbegeißelte) Form umwandeln. Die amastigoten Formen vermehren sich durch Teilung und werden nach der Zerstörung der Wirtszelle freigesetzt und können weitere Zellen befallen. Nimmt eine Sandmücke (Phlebotomus sp.) den Erreger aus dem Gewebe oder dem Blut auf, ist der Kreislauf geschlossen.
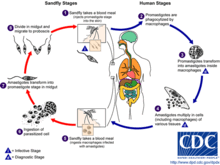
Im Mückendarm wandeln sich die Leishmanien wieder zur promastigoten Form um. Diese wandert über eine abermals amastigote Form im Darmepithel nun in die Speicheldrüse der Mücke und eine Infektion kann erneut erfolgen.

Krankheitsbilder: Bei den Krankheiten, die von Leishmania hervorgerufen werden (Leishmaniosen), unterscheidet man zwischen cutanen Formen ("Orientbeule") und viszeralen Formen ("Kala Azar"). Bei der Orientbeule siedeln sich die Leishmanien bevorzugt in Makrophagen unter und im Hautgewebe an. Diese verläuft meist nicht tödlich. Wenn sie jedoch in bestimmte Organe eindringen und dort Makrophagen befallen kann es zu Hepatosplenomegalie-Symptomen kommen, die meist tödlich verlaufen. Formen der Leishmaniose:

Viszerale Leishmaniose (Kala Azar)
Erreger: L. donovani, in Europa L. infantum Bei der viszeralen Leishmaniose (auch bekannt als Dum-Dum-Fieber oder Kala-Azar) werden die inneren Organe befallen. 1977 wurde in Indien (Nordbihar) eine große Epidemie mit ca. 70.000 erkrankten Personen beobachtet. Der Begriff Kala-Azar stammt aus dem Hindi und bedeutet "Schwarze Haut". Die viszerale Leishmaniose ist allerdings nicht auf Indien und China beschränkt. Sie tritt auch in Europa, z. B. im Mittelmeerraum, von Portugal bis in die Türkei auf und ist auch in Südamerika, dort besonders in Brasilien vertreten. Ohne Therapie enden ca. 3 % der Krankheitsfälle tödlich.
Kutane Leishmaniose (Hautleishmaniose, Orientbeule)
Erreger: L. tropica, L. major, L. aethiopica, L. mexicana oder L. brasiliense
Die kutane Leishmaniose (auch bekannt als Bagdad-, Orient- oder Aleppobeule) befällt im Gegensatz zur viszeralen Leishmaniose lediglich die Haut (lateinisch cutis = Haut) und verschont die inneren Organe. Die Vermehrung der Parasiten ist häufig auf den Ort beschränkt, an dem die Infektion stattfand.
Mukokutane Leishmaniose (Schleimhautleishmaniose, Espundia)
Erreger: L. brasiliense
Diagnostik:
- Viszerale Leishmaniose: Direktnachweis (Milz-, Leber-, Knochenmarkspunktion), Serologie
- (Muko)Kutane Leishmaniose: Direktnachweis, Serologie (unsicher), Intrakutantestung
Therapie: Antimonpräparate, Amphotericin B, Pentamidin, Paramomycin
Literatur und Weblinks:
- RKI - Leishmaniose
- http://www.leishmaniose.de
- http://www.parasitus.com/krankheiten/protozoen/leishmaniose/leishmaniose.html
- http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/Medizin/Kala-Azar.php
Trypanosoma spp.
| Trypanosoma spp. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||
|
Trypanosomen (griech. Bohrkörper) sind eine Gruppe von geißeltragenden Protozoen (Flagellaten), die als Parasiten in vielen Warm- und Kaltblütlern vorkommen. Trypanosoma brucei rhodesiense und Trypanosoma brucei gambiense sind die Erreger der afrikanischen Schlafkrankheit, während Trypanosoma cruzei die Chagas-Krankheit hervorruft.
Verbreitung: Trypanosomen kommen weltweit vor, jedoch sind die medizinisch bedeutendsten Arten in den Tropen und Subtropen Afrikas, Mittel- und Südamerikas beheimatet. Jede Art hat ein begrenztes Spektrum an Zwischenwirten, daher können sie nur in den Lebensräumen ihres Wirtes existieren (z.B. im "Tse-Tse Gürtel" bei T. brucei).
Morphologie und Eigenschaften: Die Bezeichnung Trypanosoma (Bohrkörper) stammt von der Art der Bewegung der Flagellaten. Sie haben ein gedrungenes wurmartiges Aussehen. Trypanosoma ändern häufig ihre Gestalt, es variiert dabei vor allem die Position der Geißel zum Kern der Zelle und ihre Länge selbst.
Man kann daher mehrere Formen unterscheiden:
| Trypanosomenform | Position der Geißel | Länge (o. Geißel) |
|---|---|---|
| trypomastigot | hinter dem Kern | 30μm |
| epimastigot | vor dem Kern | < 30μm |
| promastigot | vorderer Zellpol | 40μm |
| amastigot | Geißel (fast) unsichtbar | < 30μm |
Lebenszyklus: Alle Trypanosomen machen einen Wirtswechsel durch zwischen Insekt und Wirbeltier. Bei manchen Arten findet jedoch nur eine mechanische Übertragung statt (T. evansi, T. equiperdum). Dabei sind die sich im Darmtrakt der Insekten entwickelnde Formen epimastigot oder promastigot, während sich im Wirbeltierwirt trypomastigote oder amastigote Formen ausbilden.
Krankheitsbilder: Trypanosomen sind Auslöser unterschiedlicher Krankheiten, die weiter unten ausführlich besprochen werden. Zwei Arten sind humanpathogen, sie besitzen mehrere Unterarten.
- Trypanosoma brucei
- T. brucei brucei (Nagana, nur bei Tieren)
- T. brucei gambiense (Afrikanische Schlafkrankheit)
- T. brucei rhodesiense (Ostafrikanische Schlafkrankheit)
- Trypanosoma cruzi (Chagas-Krankheit)
- T. cruzi cruzi
- T. cruzi marinkellei
Trypanosomen kommen vor allem in flüssigen Körpergeweben vor, insbesondere dem Blut, in der Lymphe, dem Knochenmark, der Rückenmarksflüssigkeit und im Gehirn. Sie können unter dem Mikroskop nativ und nach Giemsa-Färbung von Blut oder Liquor nachgewiesen werden.
Einige Trypanosomen entziehen sich recht erfolgreich der Immunabwehr, indem sie einen variablen Proteoglycan-Mantel besitzen, der ständig seine antigene Zusammensetzung ändert. Auch die Proteine sind durch Transspleißen hochvariabel. Dieser Mechanismus wurde bei vier Arten nachgewiesen (T. brucei, T. congolense, T. evansi, T. equiperdum). Andere Arten wie T. cruzi, verbergen sich durch das Eindringen in eine Wirtszelle.
Trypanosoma sp. und ihre Entdecker:
- Trypanosoma evansi, 1880 von Griffith Evans entdeckt, Erreger der Surra bei Pferd, Kamel und Elefant. Mechanische Übertragung bes. durch Tsetse und Tabaniden
- Trypanosoma equiperdum, entdeckt 1894 von Rouget als Erreger der Beschälseuche bei Pferden
- Trypanosoma brucei brucei, entdeckt 1894 von Sir David Bruce, Erreger der Nagana bei Tieren
- Trypanosoma brucei gambiense, entdeckt 1901 von Joseph Everett Dutton
- Trypanosoma brucei rhodesiense, eine Variante der Trypanosoma gambiense, Erreger der Schlafkrankheit
- Trypanosoma equinum, Voges 1901, entdeckt 1901 von Elmassian, Erreger der Mal de Caderas, einer nur bei Equides in Südamerikas vorkommenden Krankheit, der Kreuzlähme der Pferde.
- Trypanosoma rangeli, scheinbar nicht humanpathogen, ähnlich T.cruzi
- Trypanosoma theileri, entdeckt 1903 von Adolph Theiler, Erreger einer Rinderkrankheit
- Trypanosoma cruzi, entdeckt 1909 von Carlos Chagas, Erreger der Chagas-Krankheit
- Trypanosoma vivax, Erreger der Nagana bei Rindern und Schafen.
Literatur und Weblinks:
- August Stich, Dietmar Steverding: Die Rückkehr einer Seuche: Trypanosomen. Biologie in unserer Zeit 32(5), S. 294 - 302 (2002), ISSN 0045-205X
- Stevens JR, Noyes HA, Schofield CJ, Gibson W.: The molecular evolution of Trypanosomatidae. 2001
Trypanosoma brucei
Trypanosoma brucei ist der Erreger der Schlafkrankheit (syn. Afrikanische Trypanosomiasis). Man unterscheidet 2 Unterarten:
- Trypanosoma brucei gambiense (Erreger der Westafrikanischen Schlafkrankheit)
- Trypanosoma brucei rhodesiense (Erreger der Ostafrikanischen Schlafkrankheit)
Das Erbgut der Erreger wurde im Juli 2005 durch Forscher sequenziert, wodurch sie sich neue Möglichkeiten der Krankheitsbekämpfung erhoffen.


Vorkommen und Übertragung: Als Erregerreservoir der Trypanosomen dienen Menschen, Rinder und Antilopen. Anders als bei der Malaria sind die Überträger der Schlafkrankheit tagaktive, stechende und blutsaugende Zungenfliegen (Tsetse-Fliegen, Glossina sp.). Es handelt sich dabei um kleinere bis mittelgroße Fliegen (7,3-13mm n. Meyers 1909) mit einem relativ schmalen Körper. Charakteristisch ist die Haltung der Flügel: Diese werden beim Sitzen in Ruhestellung, ähnlich wie wir es von einer Schere kennen, der Länge nach auf dem Hinterleib genau übereinandergelegt und bilden eine Zungenform (lat. Glossa), daher auch ihr Name. Durch diese Flügelhaltung kann die Tsetsefliege gut von anderen Stechfliegen unterschieden werden.
Man trifft Glossinen im tropischen Afrika vorwiegend in Feuchtgebieten (Flussläufe, Sümpfe) aber auch in trockenen Savannenlandschaften (z.B. Kalahari) an. Der Stich ist sehr schmerzhaft und kann auch durch die Bekleidung hindurch erfolgen. Die Erreger gelangen mit dem gerinnungsaktiven Fliegenspeichel in den Stichkanal. Durch einen Stich werden mehrere tausend Erreger übertragen. Bremsen und Stechfliegen könnten (in besonderen Fällen) möglicherweise eine Rolle durch mechanische Übertragung spielen. [3]
Infektionsrisiko: Nicht alle Tsetse-Fliegen sind Trypanosomen-Überträger, so dass nicht jeder Stich zwangsläufig zu einer Infektion führt. Das Infektionsrisiko bei einem Tsetsestich ist regional sehr unterschiedlich und liegt durchschnittlich in der Größenordnung 1:100, denn auch die Durchseuchungsrate der Tsetse-Fliege variiert stark. Das Risiko steigt damit proportional zur Zahl der Stiche. Die Infektion trifft überwiegend die einheimische Bevölkerung, seltener Touristen.
Epidemiologie: Die Schlafkrankheit kommt mit einem schwer erfassbaren regionalen Verteilungsmuster im gesamten Tropengürtel Afrikas vor. Insgesamt sind nach Schätzungen der WHO mehr als 500.000 Menschen von der Schlafkrankheit betroffen. Durch die instabile politische Situation in vielen Regionen (Flüchtlinge) hat die Erkrankungsrate in den letzten Jahren zugenommen.

Das Parasitenreservoir von T. b. gambiense besteht nach Dönges (1988) hauptsächlich aus den infizierten, eventuell auch nur latent infizierten Menschen, einigen Haustieren, besonders dem Hausschwein (auch bei Desowitz (1981)) und der Hamsterratte Cricetomys gambianus (Langschwanzmäuse). Piekarski (1962) nennt die Antilope unter den Wildtieren. Oft wird T. b. gambiense während des 1. Stadiums im Menschen nicht diagnostiziert und es folgt (oft erst nach Jahren) das schwerer zu behandelnde 2. Stadium.
T. b. rhodesiense fand sich weiterhin am häufigsten bei der Schirrantilope, gefolgt von dem Hausrind, der Kongoni, dem Afrikanischen Büffel, der Fleckenhyäne und dem Löwen (Dönges). In begrenzterem Umfang als bei T. b. gambiense ist auch hier der erkrankte Mensch ein Erregerreservoir. Piekarski nennt für beide Trypanosomenunterarten noch Ziegen und Schafe.
Welche Tierarten bei der Übertragung auf den Menschen die bedeutendste Rolle spielen, ist nicht abschließend geklärt, da ein kompliziertes Geflecht von anderen epidemiologischen Parametern beachtet werden muss (z.B. 31 Tsetse-Arten mit Vorlieben für bestimmte Wirtstiere, sowie Regenzeiten, soziale Faktoren, unterschiedliche Erregerstämme etc.). Das Infektionsrisiko ist deswegen lokal und regional sehr unterschiedlich. Die Parasitenreservoire sind zum großen Teil auch für jene Trypanosomen relevant, die bei afrikanischen Haus- und Nutztieren die sog. Nagana verursachen.
Symptomatik: Der Krankheitsverlauf ist abhängig vom auslösenden Erreger. Bei Infektion mit Trypanosoma brucei gambiense ist der Krankheitsverlauf langsamer, bei Infektion mit Trypanosoma brucei rhodesiense in der Regel schneller und ausgeprägter.
- Stadium I (Hämolymphatische Phase): In der ersten Woche nach der Infektion kann es an der Einstichstelle zu einer schmerzhaften Schwellung mit zentralem Bläschen, dem sog. "Trypanosomenschanker" kommen. Dieses Symptom tritt jedoch nur bei einem Teil der Infizierten (5-20%) auf. 1-3 Wochen nach der Infektion beginnt die eigentliche Parasitämie, die von Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Ödemen, Jucken, Exanthem und Lymphknotenschwellung begleitet wird. Hinzu treten Anämie und Thrombozytopenie, sowie erhöhte IgM-Spiegel.
- Stadium II (Meningoenzephalitische Phase): Ca. 4-6 Monate nach Infektion - bei T. b. rhodiense oft schon nach wenigen Wochen - dringen die Erreger in das Zentralnervensystem ein. Die Patienten leiden unter zunehmenden Verwirrungszuständen, Koordinations- und Schlafstörungen, Krampfanfällen, Apathie und Gewichtsverlust. Es können extrapyramidale Störungen oder ein Parkinson-ähnliches Krankheitsbild auftreten.
Im Endstadium fallen die Patienten in einen kontinuierlichen Dämmerzustand, der der Krankheit ihren Namen gegeben hat. Im Liquor ist eine Pleozytose nachweisbar. Nach einem Verlauf von Monaten bis Jahren endet die Krankheit tödlich.
Immunreaktion: Die Trypanosomen sind von Glykoproteinen, den so genannten "variable surface glycoproteins" (VSGs) umgeben. Die VSGs werden von den Einzellern im Rahmen der Vermehrung ständig variiert, um der Immunantwort des Wirts zu entgehen (Antigenvariation). Im Trypanosomen-Genom sind über 1000 verschiedene VSG-Gene codiert, die abwechselnd exprimiert werden. Das menschliche Immunsystem kann zwar Antikörper gegen die vorherrschenden Antigene produzieren, aber immer nur einen Teil der Erreger eliminieren, da bereits neue Varianten im Blutkreislauf zirkulieren.
Diagnostik: Im Stadium I werden die Erreger mikroskopisch im Blut ("dicker Tropfen") oder mittels Lymphknotenbiopsie nachgewiesen. Zum Ausschluss des Stadium II erfolgt bei Parasitennachweis zusätzlich eine Untersuchung des Liquor cerebrospinalis. Als immundiagnostische Verfahren werden ELISA, IFT und PHA eingesetzt.
Prophylaxe: Zur Zeit ist weder eine medikamentöse Prophylaxe der Schlafkrankheit noch eine vorbeugende Impfung verfügbar. In der Mitte des letzten Jahrhunderts wurde Pentamidin i.m. erfolgreich als Prophylaxe eingesetzt. Diese war für mindestens 6 Monate effektiv (T. b. gambiense). Die heute einzig mögliche Vorbeugung besteht in der Vermeidung von Insektenstichen. Touristen sollten sich mit Repellents, Moskitonetzen und langärmeliger Kleidung schützen. Wichtig könnte auch das Tragen von heller Kleidung sein, da die Tsetse-Fliege besonders von blau und schwarz angezogen wird. Diese Maßnahmen sind jedoch nur bedingt erfolgreich, da die aggressiven Tsetse-Fliegen schnell eine ungeschützte Stelle am Körper finden.
Therapie: Aufgrund der Toxizität der verfügbaren Medikamente wird die Schlafkrankheit in den meisten Fällen stationär behandelt. Im Stadium II werden Arsenverbindungen eingesetzt, die ausgeprägte Nebenwirkungen auslösen. Die Letalität kann hier bis zu 5% betragen.
- Stadium I: Gabe von Suramin (T. b. rhodesiense/gambiense) oder Pentamidin (T. b. gambiense). Beide Medikamente wirken nicht auf Erreger im Zentralnervensystem, da sie die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden.
- Stadium II: Gabe von Melarsoprol oder Eflornithin (T. b. gambiense). Beide Medikamente wirken gegen Erreger im ZNS, sind jedoch neurotoxisch.
Historie: Sir David Bruce erforschte als einer der Ersten die Epidemiologie der Krankheit in Afrika. Robert Koch erforschte die Wirkung von Atoxyl gegen die Erkrankung. Paul Ehrlich entwickelte daraus das Salvarsan. Ein wichtiges Medikament ist seit etwa 1920 Germanin (Suramin, Bayer 205 der Bayer AG).
Literatur und Weblinks:
- Johannes Dönges, Parasitologie, 1988, 2.Aufl., Georg Thieme Verlag Stuttgart/ New York , ISBN 3135799026
- Dr. Gerhard Piekarski, Medical Parasitology in Plates, 1962, Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, Germany, Pharmaceutical Division
- Ein Kapitel in: Robert S. Desowitz, New Guinea Tapeworms and Jewish Grandmothers, tales of parasites and people, 1987, Norton Verlag, ISBN 0393304264, bes.zur Geschichte des Viktoriasees
- WHO - African trypanosomiasis (sleeping sickness)
- http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/Medizin/Schlafkrankheit.php
Trypanosoma cruzei
 |
 |
Der Einzeller Trypanosoma cruzi ist der Erreger der Chagas-Krankheit (auch als Amerikanische oder Südamerikanische Trypanosomiasis bezeichnet), eine infektiöse Erkrankung und Parasitose.
Verbreitung: Die Chagas-Krankheit ist nur in Mittel- und Südamerika verbreitet und wird durch (vorwiegend nachtaktive) Raubwanzen übertragen. Die Raubwanzen infizieren sich auch gegenseitig durch Koprophagie und "Kannibalismus". Ein Erregerreservoir der Zoonose besteht u.a. bei Wildtieren (z.B. Gürteltieren, Opossums, Zweifinger-Faultiere), aber auch bei Hunden, Katzen und Ratten. Auch der infizierte Mensch ist ein wichtiges Parasitenreservoir. Insgesamt soll es mehr als 16 Millionen infizierte Menschen geben, in Bolivien könnte etwa ein Viertel der Bevölkerung betroffen sein.

Vektor: Trypanosoma cruzi wird durch Raubwanzen (Fam. Reduviidae) übertragen, welche umgangssprachlich auch assassin bug, kissing bug, vinchuca, barbeiro oder chipo heißen. Die Insekten sind 3 bis 4 Zentimeter groß und gehören den Gattungen Triatoma, Rhodnius oder Panstrongylus an (alle aus der Unterfamilie Triatominae), wobei Triatoma infestans der wichtigste Zwischenwirt darstellt. Alle Stadien (auch die Larven, s. Bild) sind empfänglich für T. cruzi.
Infektionswege: Die Raubwanze attackiert den Schlafenden (auch andere schlafende Säugetiere, Reptilien, Vögel), sticht ihn und saugt meist unbemerkt Blut mit Vorliebe in den dünneren Regionen der Haut z.B. an den Lippen oder am Auge. Währenddessen defäkiert das Insekt. Die Infektion des Menschen erfolgt nicht durch den Stich an sich, sondern durch Einreiben des erregerhaltigen Kotes einer infizierten Raubwanze in die frische Stichwunde durch den irritierten, aufwachenden Menschen selbst, oder auch durch Eindringen des Erregers in unverletzte Schleimhaut (bes. des Auges). Der Kot kann vermutlich jahrelang infektiös bleiben. Die diaplazentare Infektion des Fötus durch die Mutter ist möglich. Auch Muttermilch ist infektiös.

Verlauf: Die Chagas-Krankheit tritt beim Menschen in zwei Stadien auf:
- Das akute Stadium tritt kurz nach der Infektion auf. Es ist meistens gekennzeichnet durch leichtes Fieber und eine Schwellung um die Stichwunde: Ödem mit Entzundungserscheinungen, sog. Chagom. Da dieses oft im Gesicht auftritt (weiche Hautstellen), nennt man ein Chagom im Augenbereich Romana-Zeichen oder Romana´sches Zeichen.
- Das chronische Stadium tritt bei circa 10–30 % der akut Erkrankten erst nach einigen Jahren auf.
Von der chronischen Chagas-Krankheit werden vor allem das Nervensystem, das Herz und der Darm betroffen. Es können verschiedene neurologische Störungen, die bis zur Demenz gehen können, auftreten. Am Herzen kommt es zu einer Schädigung des Herzmuskels, die Jahrzehnte nach Infektion zum plötzlichen Herztod führen kann. Am Gastrointestinaltrakt kann es zu einer starken Dilatation des Darmes (Megacolon) und der Speiseröhre kommen.
Unbehandelt kann die Chagaskrankheit in bis zu 10 % der Fälle tödlich enden. Besonders gefährdet sind Säuglinge und Kleinkinder.
Diagnose: Der Erreger lässt sich besonders in der akuten Phase in den ersten Wochen mikroskopisch im Blut (Blutausstrich oder dicker Tropfen) nachweisen.
In der chronischen Krankheitsphase wird der Erreger mit Antikörpertests (z.B. IFT) nachgewiesen.
In Südamerika gibt es den Trypanosomentest in Form der sog. Xenodiagnose. Dazu lässt man laborgezüchtete Raubwanzen, die erregerfrei sind, auf der Haut des Patienten eine Blutmahlzeit nehmen. Nach zwei bis vier Wochen (nach unterschiedlichen Quellen) wird der Darm der Raubwanzen auf einen Erregerbefall untersucht.
Im Gehirn lässt sich die Auswirkung der Erkrankung mittels CT oder NMR nachweisen. Im Herzen kann man dazu die Echokardiografie nutzen.
Prophylaxe: Es gibt bisher keine Impfung. Zur Vorbeugung der Krankheit werden die Raubwanzen bekämpft. DDa die Raubwanzen auch gerne nahe den Schlafplätzen der Haustiere leben, sind jene Orte abzusondern. Ausreichend geschlossene Wohnungen sowie zeltartige, auch bodenseitig durchgehend geschlossene Moskitonetze mit dichtschließendem Reißverschluss bieten einen sehr guten Schutz, sofern man das Netz beim Schlafen nicht berührt. Notfalls muss das herkömmliche Moskitonetz bis unter die Matratze gesteckt werden. Die gefährdetsten Schlafplätze liegen in offenen, einfachen Häusern z.B. mit Wänden und Dächern aus Stroh und ähnlichem Flechtwerk. Viele unspezifische Insektizide oder Repellents sind bei Raubwanzen meist unwirksam.
Eine durchgehende Kontrolle von Blutspenden soll die Möglichkeit der Übertragung der Infektion bei Bluttransfusionen und Transplantationen verhindern. Dies geschieht in den entsprechenden Ländern jedoch nicht immer.

Therapie: Medikamente wie Nifurtimox und Benznidazol wirken vor allem in der akuten Phase der Erkrankung, die medikamentöse Therapie ist schwierig. Durch bessere Kontrolle der Erkrankungen bei Kindern sollen die schwerer zu behandelnden chronischen Formen vermieden werden. Die Zahl der Neuinfektionen ist nach den Statistiken der WHO allerdings wegen der Bekämpfung des Insekts sehr zurückgegangen. Wegen unterschiedlichster Verbreitungskarten, die im Internet angeboten werden, sollte vorsichtshalber im gesamten Verbreitungsgebiet der Krankheitsüberträger eine angemessene Prophylaxe getroffen werden, dazu könnten auch noch Gebiete in den USA gehören.
Geschichte: Die Ursache der Erkrankung wurde von dem brasilianischen Wissenschaftler Carlos Chagas 1909 aufgeklärt. Er arbeitete am Oswaldo-Cruz-Institut in Rio de Janeiro. Lange Zeit hielt Chagas den Stich fälschlicherweise für die Hauptinfektionsquelle.
Literatur und Weblinks:
- WHO - Chagas disease
- http://www.unibio.unam.mx/chagmex
- http://memorias.ioc.fiocruz.br/94sup1/
- http://chagaspace.org/eng/index.htm
Rhizopoden
Entamoeba histolytica
| Entamoeba histolytica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Entamoeba histolytica ist ein einzelliger Parasit, der v.a. den Menschen, experimentell aber auch andere Säugetiere befällt. Das Protozoon ist der Verursacher der Amöbenruhr.
Epidemiologie: Entamoeba histolytica ist weltweit verbreitet und besonders in Gebieten mit schlechten hygienischen Zuständen im Abwasser oder in verschmutzem Trinkwasser anzutreffen. Es werden einzelne Ausbrüche bei Katastrophen verzeichnet, da dort oft ungenügend sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht. Auch Fehler im Abwassersystem können Amöbenruhr hervorrufen, so wurden beispielsweise bei der Weltausstellung 1933 in Chicago über 1000 Fälle mit 58 Toten beobachtet, verursacht durch ein Übertreten von Abwässern in die Trinkwasserversorgung.
Es wird geschätzt, dass weltweit etwa 500 Millionen Menschen infiziert sind und etwa 50.000-100.000 Menschen pro Jahr an der Infektion versterben.

(Noch weiter verbreitet ist Entamoeba dispar. Diese wurde früher als Stamm von E. histolytica betrachtet gilt jedoch aufgrund genetischer Unterschieden als eigene Art. Sie kann jedoch keine Magna-Formen ausbilden und ist von den Minuta-Formen der Histolytica-Amöben optisch nicht zu unterscheiden und ruft meist nur selbslimitierende Durchfälle hervor.)
Morhologie und Eigenschaften: E. histolytica haben die für Amöben typische sich ständig verändernde, polymorphe Gestalt. Die Fortbewegung geschieht über Pseudopodien (Scheinfüßchen), die aus der Zelle ausgestülpt werden. Es sind zwei Formen vorhanden. Die für die Krankheitssymptome verantwortliche Vegetativform bzw. die Trophozoiten, deren Minuta-Form bis zu 5μm, deren Magna-Form bis zu 50μm groß wird und die der Weiterverbreitung dienenden Zysten von etwa 15μm Durchmesser.

Lebenszyklus: Die Amöben gelangen als Zysten in den Dünndarm, dort schlüpft ein vier-kerniger Organismus, der sich in vier oder acht Trophozoiten teilt. Die Trophozoiten können im Darm parasitieren, aber auch in die Darmwand und die Blutbahn eindringen, zum anderen können sie encystieren und den Darm mit den Faeces verlassen (etwa 45 Millionen Zysten pro Tag), um einen neuen Wirt zu befallen. Große, mit Erythrozyten vollgestopfte Amöben nennt man wegen ihrer Größe Magna-Form.
Krankheitsbild: Die erste bedeutende wissenschaftliche Monographie über die Ruhr war Johann Georg Zimmermanns "Von der Ruhr unter dem Volke im Jahr 1765, und denen mit derselben eingedrungenen Vorurtheilen, nebst einigen allgemeinen Aussichten in die Heilung dieser Vorurtheile (Zürich 1767)".
Die Trophozoiten dringen in die Darmwand ein und gelangen mit dem Blutstrom in die inneren Organe, z.B. die Leber, wo sie Abszesse hervorrufen.
Die von E. histolytica hervorgerufene Krankheit bezeichnet man als Ruhr, genauer Amöbenruhr beziehungsweise Amöbiasis. Durch Gewebe auflösende (histolytische) Enzyme verursachen sie dabei eitrige Darmgeschwüre, die aufbrechen können. Die Folge können Unterleibsschmerzen, himbeergeleeartiger Durchfall, Bauchfellentzündungen und durch Streuung Abszesse der Leber und anderer Organe sein. Oft bricht die Krankheit erst Jahre oder Jahrzehnte nach der Infektion aus.
Diagnostik: Direktnachweis im Stuhl, bei extraintestinaler Amöbiasis helfen bildgebende Verfahren und serologische Methoden weiter.
Therapie: Metronidazol bei allen Manifestationsformen plus ein Medikament zur Sanierung des Darmlumens (Diloxanidfuroat, Paromomycin, Diiodohydroxyquin).
Literatur und Weblinks:
Sporozoen
Cryptosporidium parvum
 |
 |
Crytosporidium parvum ist ein ovaler Dünndarmparasit, der die Zoonose Kryptosporidiose verursacht. Bei immunkompetenten Personen verläuft die Infektion meist als selbstlimitierende Durchfallerkrankung. Dagegen können Personen mit reduziertem Immunstatus chronische Diarrhöen und andere Organbeteiligungen (z.B. pulmonale Cryptosporidiose) erleiden. Die Infektion mit Oocysten erfolgt fäkal-oral oder über kontaminierte Nahrungsmittel/Trinkwasser.
Epidemiologie: Reservoir des Erregers sind Geflügel, Kälber (Ausscheidung von Oocysten in etwa 50%) und andere Tiere.C. parvum ist einer der infektiösesten und häufigsten Enteritis-Erreger beim Menschen. Die Durchseuchungsrate beträgt 10-20% bei Patienten mit AIDS-assoziierter Diarrhoe, 1,2-2% bei Immunkompetenten in den Industrienationen und 0,5-10% in Entwicklungsländern.
Diagnostik: Direkter Erregernachweis im Stuhl (die Kinyoun-Färbung, die säurefeste Organismen färbt ist besonders geeignet) oder Antigennachweis im Stuhl (z.B. mit Floureszenz-markierten Antikörpern). Am zuverlässigsten sind Biopsien des terminalen Ileums und histologische Standardfärbung.
Therapie: Keine spezifische Therapie bekannt
Toxoplasma gondii
| Toxoplasma gondii | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
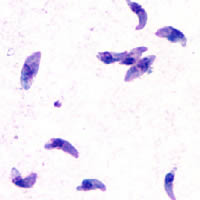 | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
|
Toxoplasma gondii ist ein bogenförmiges Protozoon mit parasitischer Lebensweise. Sein Endwirt sind Katzen, als Zwischenwirt dienen andere Wirbeltiere.
Entdeckung und Forschungsgeschichte: Toxoplasma gondii wurde erstmalig 1908 in Tunesien als Parasit im Gundi (Ctenodactylus gundi) entdeckt und als Angehöriger der Sporozoen identifiziert. Aufgrund der Halbmondform wurde es von den Entdeckern Nicolle und Manceaux als Toxoplasma (griech. toxon: Bogen) und aufgrund des Wirtstieres als Toxoplasma gondii benannt. Erst viel später konnte es auch beim Menschen als Krankheitserreger gefunden werden, die von ihm ausgelöste Krankheit wurde Toxoplasmose genannt. 1948 entwickelten Sabin und Feldmann einen serologischen Test auf der Basis von Antikörpern, den sie Dye-Test nannten. Mit Hilfe dieser Methode konnte festgestellt werden, dass Toxoplasma gondii weltweit verbreitet ist und beim Menschen sehr häufig vorkommt.
Verbreitung: Der Parasit ist weltweit verbreitet, die Bevölkerung weist eine hohe Durchseuchung auf, da die Infektion meist ohne Symptome verläuft. Etwa 60% der Bevölkerung in Deutschland besitzt Antikörper gegen Toxoplasma gondii, war also bereits einmal mit dem Parasiten infiziert. Die Prävalenz steigt pro Lebensjahr um etwa 1%. Nach Schätzungen erleiden 7 von 1.000 Schwangeren eine Infektion. Nach der Infektion besteht eine lebenslange Immunität, wenn das Immunsystem nicht erkrankt ist.
Morphologie und Eigenschaften: Toxoplasma gondii variiert je nach Stadium sowohl in der Form als auch in der Größe. Die Zellen der freien und infektiösen Form sind in flüssigen Medien oder Frischpräparaten bogenförmig und erreichen Größen von 2 bis 5μm. Betrachtet man sie in Gewebeproben oder fixierten Schnitten, erscheinen sie dagegen eiförmig oval. Außerdem können sie sowohl einzeln als auch zu mehreren in sogenannten Pseudozysten im Gewebe vorkommen. Pseudozysten bestehen aus der Zellmembran der Wirtszelle und den sich darin ungehemmt teilenden und die Zelle aufblähenden Sporozoiten. Die Oozysten messen bis zu 11μm, die Gewebspseudozysten bis zu 300μm. Aus den Oozysten bilden sich zwei verschiedene Populationen von Sporozoiten: Die Tachyzoiten bilden sich nach dem Eindringen in den Zwischenwirt und vermehren sich dort rapide. Später treten Bradyzoiten auf, deren Vermehrung stark verlangsamt ist. Strukturell unterscheiden sich diese beiden Formen nicht.
Das Genom des Erregers umfasst etwa 4.000 Gene.
Virulenzfaktoren: 90% der Virulenz des Erregers können durch die Kinase ROP18 erklärt werden, die der Erreger produziert und mit der er den Wirtszellstoffwechsel zu seinen Gunsten beeinflusst.[4]
Entwicklungszyklus:
Die Oozysten werden vom Endwirt (Katzenartige) mit den Feces ausgeschieden und gelangen als infektiöse, sporulierte Oocysten in den Zwischenwirt. Sie enthalten zwei Sporocysten mit je vier Sporozoiten, die sehr lange (bis zu 5 Jahre) infektiös bleiben können und Frost überstehen, allerdings nicht sehr hitzeresistent sind. Im Zwischenwirt (Wirbeltiere und Vögel) schlüpfen die Sporocysten, die nun aktiv in kernhaltige Zellen des Zwischenwirtes eindringen, vor allem in lymphatischen Geweben (Lymphknoten, retikuloendotheliales System (RES)). .




Nun setzt eine besondere Art der Vermehrung durch ungeschlechtliche Teilung ein, die sog. Endodyogenie oder innere Knospung. Dabei bilden sich in der Mutterzelle zwei Tochterzellen, die durch Auflösung der Mutterzelle freigesetzt werden. Dieser Vorgang läuft nun so lange ab, bis die Wirtszelle komplett ausgefüllt ist und aufplatzt, so dass die Tachyzoiten (griech. tachys: schnell) frei werden. Dieser Vorgang wiederholt sich nun alle 6 Stunden. Die Tachyzoiten breiten sich im Blut aus (Parasitämie) und können auch die Plazentarschranke überwinden. Nachdem die Immunreaktion eingesetzt hat verlangsamt sich die Teilungsdauer und man spricht nun von Bradyzoiten (griech. bradys: langsam). Es bilden sich in den Zellen Gewebezysten, die vor allem in der Muskulatur, aber auch im Gehirn oder in der Retina des Auges latent bleiben. In dieser Form werden sie dann wiederum von der Katze, die den Zwischenwirt frisst aufgenommen. (Der Mensch ist somit für die Toxoplasmen ein Fehlwirt). Die Bradyzoiten werden nun im Darm frei und dringen in die Epithelzellen ein. Dort findet eine Schizogonie (ungeschlechtliche Fortpflanzung) statt, sodann werden fertige Oocysten in den Darm entlassen. Diese werden nun mit dem Kot ausgeschieden und reifen in der Außenwelt in 2 - 4 Tagen zu infektionsfähigen, sporulierten Oocysten heran. Sie sind bis zu 5 Jahre infektionsfähig. Falls die Oocysten nun von Katzen aufgenommen werden, so entwickeln sich Tachyzoiten, Bradyzoiten und Gewebecysten. Diese verbleiben jedoch nur zu einem geringen Teil im Gewebe und wandern in das Darmepithel der Katze ein wo sie erneut durch Schizogonie Oocysten ausbilden. Der Lebenszyklus wird in drei Phasen unterteilt: 1. die extraintestinale Phase, 2. die externe Phase und 3. die enteroepitheliale Phase.
Krankheitsbild: Beim Menschen ruft der Parasit die Krankheit Toxoplasmose hervor. Er kann T. gondii über halbrohes Fleisch oder über Schmierinfektion (Katzenkot) aufnehmen und übernimmt dann die Rolle des Zwischenwirtes, das heißt die Erreger durchdringen die Darmwand, um so in der Muskulatur und in anderen Organen Zysten zu bilden, die ein Leben lang im Gewebe überdauern. Die Inkubationszeit beträgt ein bis drei Wochen, die Infektion verläuft bei gesundem Immunsystem für ca. 90% der Betroffenen symptomlos. Es kann einige Monate lang zu grippalen Beschwerden wie Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen und Lymphknotenschwellungen kommen. Bei einem schubweisen Verlauf der Erkrankung kann sich die Ausbreitung über Wochen und Jahre hinziehen. Hierbei bleiben die Erreger im Organismus in Zysten eingeschlossen. Sie platzen zu beliebiger Zeit und gelangen so in das Blut- und Lymphsystem. Bei einer durchgestandenen Erkrankung ist eine Immunität anzunehmen.
Wenn die Erstinfektion der Mutter in der Schwangerschaft erfolgt, kann T. gondii beim Ungeborenen zu schweren Schäden führen. Dabei nimmt das Übertragungsrisiko mit der Dauer der Schwangerschaft zu, die Schwere der Schäden jedoch ab. Im ersten Trimenon entwickeln 70% der infizierten Kinder eine konnatale Toxoplasmose, die meist zum Abort führt. Im zweiten und dritten Trimenon entwickeln 30% bzw. 10% eine konnatale Toxoplasmose, die in 75% bzw. 90% in eine latente Toxoplasmose übergeht und zu erheblichen Beeinträchtigungen beim Kind führt. Die infizierten Kinder können epileptische Anfälle, kognitive Einschränkungen, Schäden an der Leber, Lunge, Gehirn, Augen, Herzmuskel und Hirnhaut aufweisen. 1/4 der vor der Geburt infizierten Kinder trägt geistige Behinderungen, Spastiken, Epilepsie, Hydrocephalus und Verkalkungen der Hirngefäße davon. Die typische Trias bestehend aus Hydrozephalus, intrazerebraler Verkalkung und Chorioretinitis wird jedoch nur bei 2% der Betroffenen ausgeprägt.
Unter Immunsuppression z.B. bei AIDS kann die Reaktivierung latenter Erreger zur Enzephalitis, Hirnabszessen und Sepsis führen.
Prophylaxe: Schwangeren ist zu empfehlen, sich auf Toxoplasmose-Antikörper untersuchen zu lassen. Fällt der Test negativ aus, das heißt hatte die Schwangere noch keinen Kontakt mit dem Erreger, dann sollte sie folgendes beachten: Kein Fleisch essen, das nicht durchgebraten ist und möglichst nicht mit Katzenkot umgehen und nicht im Garten arbeiten. Notfalls schützen Handschuhe oder Händewaschen vor den Mahlzeiten. Es ist sinnvoll, wenn eine andere Person das Katzenklo täglich reinigt, weil die Oozysten erst frühestens zwei Tage nach Ausscheidung infektiös werden.
Diagnostik: T. gondii gehört zu den Infektionen, auf die man bei Schwangeren routinemäßig testen sollte, ähnlich wie Röteln, Syphilis, Hepatitis B, Clamydien, HIV, evtl. Zytomegalie und Herpes. Die Untersuchung ist in Deutschland jedoch nicht Bestandteil der normalen Schwangerenvorsorge! Wenn schon früher einmal eine Infektion durch T. gondii nachgewiesen wurde, geht davon keine Gefahr mehr aus. Das ungeborene Kind ist dann während der Schwangerschaft durch die mütterlichen Antikörper vor einer Infektion geschützt.
Eine Infektion lässt sich am leichtesten durch serologisch-immunologische Testverfahren (ELISA, Immunofluoreszenztest) nachweisen, d.h. Nachweis von spezifischen Antikörpern im Blut. Dabei sprechen IgM-Antikörper für eine frische Infektion, IgM- und IgG-Antikörper zusammen für eine Infektion innerhalb der letzten eineinhalb Jahre. Liegen sowohl IgG- als auch IgM-Antikörper vor hilft ein sogenannter Aviditätstest beim Ausschluss einer frischen Infektion.
Es stehen auch molekularbiologische Untersuchungen (PCR) zur Verfügung. Sie eignen sich zur Untersuchung von Fruchtwasser zum Nachweis einer bereits erfolgten Übertragung auf das ungeborene Kind. Eine Schädigung des Kindes kann man durch Ultraschall diagnostizieren. Auch bei immungeschwächten Patienten eignet sich am ehesten die PCR oder Sichtbarmachung bereits entstandener größerer Läsionen mittels bildgebender Verfahren (CT, MRT).
Die Diagnose kann sehr schwierig werden, wenn sie im Nachhinein bei einem Neugeborenen gestellt werden muss, das erst spät Krankheitszeichen zeigt (beispielsweise Erblindung durch Chorioretinitis).
Therapie: Eine nachgewiesene Infektion in der Schwangerschaft muss behandelt werden. Je früher die Behandlung begonnen wird, umso geringer ist die Schädigung des Kindes (Senkung der Schäden bis zu 60%).
- Bis zur 16. Schwangerschaftswoche: Gabe von Spiramycin
- Ab der 16. Schwangerschaftswoche wird bis zur Entbindung eine Kombination aus Sulfadiazin, Pyrimethamin und Folinsäure in Zyklen von jeweils 4 Wochen Dauer mit darauf folgendem vierwöchigen freien Intervall empfohlen.
Rechtliches:
- Deutschland: Infektionsschutzgesetz - § 7 Abs. (3) - Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz § 202 - Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen, Biostoffverordnung - Risikogruppe 2 (§10, §11, §13, §15), Mutterschutzgesetz - Allgemein.: Fälle von Konnataler Infektion sind dem Robert Koch Institut zu melden. Weiter sind erkannte Infektionen nach dem Arbeitsschutzgesetzt dem für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen oder dem Unfallversicherungsträger zu melden. Taxoplasma ist entsprechend Biostoffverordnung ein biologischer Arbeitsstoff der Risikogruppe 2. Nach dem Mutterschutzgesetz dürfen werdende oder stillende Mütter nicht mit möglichen Infektionsträgern arbeiten.
- Österreich: Infektionsschutzgesetz, Verordnung Biologische Arbeitsstoffe Risikogruppe 2, Mutterschutzgesetz, Mutter-Kind-Pass
- Schweiz: Infektionsschutzgesetz
Literatur und Weblinks:
- RKI - Toxoplasmose
- Groß, Uwe. “Toxoplasmose in der Schwangerschaft”. Deutsches Ärzteblatt, 98:A 3293–3300 [Heft 49], Dez 7 2001.
- Hu K et al. “Cytoskeletal components of an invasion machine--the apical complex of Toxoplasma gondii”. PLoS Pathog, 2(2):e13, Feb 2006 Epub: Feb 24 2006. DOI:10.1371/journal.ppat.0020013. PMID:16518471
Plasmodium sp.
| Plasmodium sp. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||
|
Plasmodium ist eine Gattung von Parasiten aus der Haemosporiden-Familie Plasmodiidae. Vier bekannte Arten, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae und Plasmodium falciparum sind als Erreger der Malaria berüchtigt. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass es sich bei den Apicomplexa, zu denen die Plasmodien gehören, um Algen handelt, die sekundär die Fähigkeit zur Photosynthese verloren haben und zu einem parasitären Leben übergewechselt haben. Der Stoffwechsel der Leukoplasten gilt als interessantes Angriffsziel für neue Medikamente gegen Malaria und wird intensiv erforscht.
Morphologie und Eigenschaften: Plasmodien sind Einzeller, die im Gegensatz zu Bakterien keine Zellwand, dafür aber als Eukaryoten (Eucaryota) einen Zellkern besitzen. Sie sind kommaförmig und recht schlank, aufgrund ihrer Lebensweise nehmen sie je nach Wirt und Entwicklungsstadium unterschiedliche Gestalt an. Die kleinste Form, der Trophozoit, misst 3μm, die größte Form, der Leberschizont bis zu 70μm. Die verschiedenen Plasmodien-Spezies lassen sich morphologisch voneinander abgrenzen.
Verbreitung: Plasmodien finden sich heute vor allem im tropischen und subtropischen Raum; da die Entwicklung stark temperaturabhängig ist, kommen Plasmodien selbst dort nur bis in eine Höhe von unter 1500 Metern vor. Bis zum 19. Jahrhundert waren sie auch in Süddeuropa verbreitet, wurden jedoch durch Flussbegradigungen und Sumpftrockenlegungen ausgerottet. Es finden sich noch Restbestände im Zentralasiatischen Raum (Armenien, Algerien, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Türkei, Turkmenistan und Usbekistan).
Lebenszyklus: Als Endwirt dienen Mücken, besonders der Gattung Anopheles. In ihnen findet die Vermehrung der Plasmodien statt, der Mensch dient als Zwischenwirt. Es gibt vier Arten der Plasmodien, die beim Menschen die Malaria auslösen; sie gehören zur Gattung Plasmodium.
Asexuelle Phase (Schizogonie) im Menschen
a) Exoerythrozytärer Zyklus:
Nachdem der Mensch von einer infizierten Anopheles-Mücke gestochen wurde, sondert sie mit ihrem gerinnungsaktiven Speichel Sporozoiten ab. Diese werden mit dem Blutstrom zur Leber getragen, wo sie in die Zellen des Lebergewebes eindringen und darin zum Leberschizont heranreifen. Dort findet eine asexuelle Vermehrung durch Teilung statt, die exoerythrozytäre Schizogonie genannt wird; dadurch entstehen bis zu 30.000 Merozoiten.




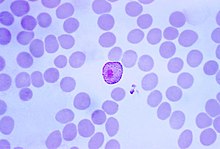

(Bei P. vivax und P. ovale verbleiben Hypnozoiten ungeteilt im Lebergewebe. In diesem Ruhezustand können sie über Monate bis Jahre verbleiben. Durch einen unbekannten Stimulus reifen sie zu Schizonten heran, was zu charakteristischen Rückfällen der Malaria tertiana führt.) Der Schizont platzt und die Merozoiten gelangen in die Blutbahn. Nach der einige Tage bis Wochen dauernden Produktion von Merozoiten beginnen einige zu geschlechtsreifen Zellen (Gametozyten) zu reifen. Diese finden sich nun gemeinsam mit den Merozoiten im Blut (Generationswechsel).
b) Erythrozytärer Zyklus: Die aus den Leberschizonten freigesetzten Merozoiten gehen in den Blutkreislauf über und befallen sodann die Erythrozyten. Sie dringen in diese ein (Trophozoiten), reifen heran und beginnen sich zu teilen (Schizonten). Aus dieser Teilung gehen acht bis sechzehn neue Merozoiten hervor, die durch Platzen des Erythrozyten freigesetzt werden und weitere Erythrozyten infizieren können. Bei den vier den Menschen befallenden Plasmodien, sieht die Teilungsdauer folgendermaßen aus:
| Plasmodium | Malariaform | Teilungsdauer / Fieberanfälle |
|---|---|---|
| P. ovale | Malaria tertiana | 48 Stunden |
| P. vivax | Malaria tertiana | 48 Stunden |
| P. malariae | Malaria quartana | 72 Stunden |
| P. falciparum | Tropica | unregelmäßig |
Sexuelle Phase (Sporogonie) in der Anopheles-Mücke
Durch die Fieberanfälle und das dadurch stärkere Schwitzen wird die Mücke eher zu einem bereits infizierten Träger geleitet, da die Mücke über einen guten Geruchssinn, sowie einen Temperatursinn verfügt. Beim erneuten Stich einer Mücke werden die Gametozyten in die Mücke aufgenommen. Sie entwickeln sich in ihrem Magen zu Gameten. Der Mikrogamet penetriert den Makrogameten und es entsteht eine Zygote, die sich verändert, eine längliche Form annimmt, motil wird und nun Ookinet heißt. Er lagert sich zwischen den Gewebeschichten des Mückenmagens an und verwandelt sich dort zur Oozyste. In ihr entstehen bis zu 1.000 neue Sporozoiten. Nach ihrer Freisetzung wandern sie in die Speicheldrüsen der Mücke und stehen nun zur Neuinfektion bereit. Der Zyklus in der Anopheles dauert abhängig von der Außentemperatur zwischen 8-16 Tagen. Dabei ist eine Mindesttemperatur von 15 °C erforderlich. Unterhalb dieser Temperatur kommt kein Zyklus mehr zu Stande.
Krankheitsbilder: Malaria (von ital. "mal'aria": "schlechte Luft") –auch Sumpffieber oder Wechselfieber genannt– ist eine Tropenkrankheit, die von einzelligen Parasiten der Gattung Plasmodium hervorgerufen wird. Die Krankheit wird in den Tropen und Subtropen durch den Stich einer weiblichen Stechmücke (Moskito) der Gattung Anopheles übertragen. Außerhalb dieser Gebiete lösen gelegentlich durch Flugreisende eingeschleppte Moskitos die so genannte "Flughafen-Malaria" aus. Hierbei sind alle Personen im direkten Umfeld von Flughäfen betroffen, z.B. Flughafenbedienstete oder Anwohner. Bis auf eine Übertragung durch Bluttransfusionen und Laborunfälle ist eine Mensch-zu-Mensch-Ansteckung nur gelegentlich von der Mutter auf das ungeborene Kind möglich, wenn die Plazenta (besonders während der Geburt) verletzt wird. Der Mensch und die Anopheles-Mücken stellen das einzige nennenswerte Erregerreservoir humanpathogener Plasmodien dar.
In der Gattung der Plasmodien sind nur die vier Erreger Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale und Plasmodium malariae für den Menschen gefährlich (humanpathogen). Hinsichtlich ihres Krankheitsverlaufes und ihrer geographischen Verbreitung unterscheiden sie sich erheblich. Plasmodium falciparum ist der klinisch bedeutsamste und bedrohlichste Erreger.

Die Symptome der Malaria sind hohes, wiederkehrendes bis periodisches Fieber, Schüttelfrost, Beschwerden des Magen-Darm-Trakts und Krämpfe. Besonders bei Kindern kann die Krankheit rasch zum Koma und Tod führen.
Geographische Verbeitung: Die geographische Verteilung gleicht der Verteilung der als Vektor geeigneten Anophelesarten, wobei zu beachten ist, dass das Vorkommen der Anopheles-Mücke auf niedrige Meereshöhen begrenzt ist, das heißt unter 2500m am Äquator und unter 1500m in den restlichen Gebieten der Erde. Durch die zunehmende Klimaerwärmung deutet sich mit der polwärtsgerichteten Ausbreitung der Überträgermücken eine weitere geographische Ausbreitung der Malaria an. Das Risiko in den einzelnen Endemiegebieten ist sehr unterschiedlich, was unter anderem saisonale und geographische Gründe hat. Im subsaharischen Afrika überwiegt P. falciparum deutlich vor allen anderen Plasmodienarten.

Auffallend ist, dass in Malariagebieten die Sichelzellenanämie relativ häufig vorkommt. Diese hämolytische Anämie ist durch eine Punktmutation der Hb-Kette bedingt und führt zur Hämoglobinpolymerisation besonders bei niedrigen Sauerstoffpartialdrücken und zum Aussicheln der Erythrozyten. Heterozygote Träger besitzen eine angeborene Resistenz gegen Malaria und somit einen Evolutionsvorteil gegenüber Personen ohne dieses Gen, die eher an Malaria sterben. In Afrika gibt es Regionen, in denen fast ein Drittel der Bevölkerung heterozygot für dieses Merkmal ist. In den anderen Weltgegenden kommt das Sichelzellengen praktisch nicht vor, da hier dieser Selektionsvorteil ohne Malaria nicht existiert.
Epidemiologie: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin sterben weltweit jährlich 1,5 bis 2,7 Millionen Menschen an Malaria, etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder unter fünf Jahren. 90% der Erkrankten leben auf dem afrikanischen Kontinent. Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen wird auf 300 bis 500 Millionen Fälle geschätzt.
In Deutschland werden jährlich ca. 900 Erkrankte (2004: 707 Fälle, 2003: 820; 2002: 859; 2001: 1.045) gemeldet, von denen 3-8 sterben (0,3-0,8 %). Der Großteil der Patienten war in afrikanischen Endemiegebieten unterwegs gewesen (ca. 87%).
Erreger:
| ||||||||||||||||||||
| (* bei unzureichender Malariaprophylaxe) |
Für den Menschen gefährlich sind die Erreger P. falciparum, P. vivax, P. ovale und P. malariae, die verschiedene Formen der Malaria auslösen können.
Darüber hinaus können auch P. semiovale und P. knowlesi in Einzelfällen eine Malaria hervorrufen. Bei Mehrfachinfektionen mit gleichen oder verschiedenen Plasmodien können die Fieberanfälle auch unregelmäßig sein. Das sonst typische Wechselfieber bleibt aus, es herrscht konstantes Fieber.
Pathogenese: Die mit Plasmodien infizierten, reifenden und platzenden Erythrozyten setzen mit den Merozoiten Toxine (z.B. Phospholipide) frei, welche zur Freisetzung von Zytokinen führen. Die Zytokine sind hauptsächlich für den Fieberanstieg und einer beobachteten Absenkung des Blutzuckerspiegels (Hypoglykämie) verantwortlich. Die mit einer Laktatazidose verbundene Hypoglykämie wird nicht nur durch die Wirkung der Zytokine hervorgerufen, sondern ist auch eine Folge des Stoffwechsels der Parasiten. Ebenso kommt es bei hoher Parasitenanzahl durch die Hämolyse, den verstärkten Abbau im RES und die Zytokin-bedingte Dämpfung der Erythropoese (bes. durch TNF-α) zu einer Anämie.
Darüber hinaus bestehen zwischen P. falciparum und den anderen Malariaerregern wichtige pathogenetische Unterschiede.
In den Erythrozyten produziert der Trophozoit Proteine, wie z.B. PfEMP1 (Plasmodium falciparum infected erythrocyte membrane protein 1), welches eine Bindung der infizierten Blutkörperchen an das Endothel der Blutgefäße bewirkt. Die damit verbundenen Mikrozirkulationsstörungen erklären zumindest teilweise den deutlich schwereren Verlauf der durch P. falciparum hervorgerufenen Malaria tropica. Dies hat im zentralen Nervensystem besonders dramatische Auswirkungen und die häufigen zentralen Komplikationen (Infarkte) der Malaria tropica zur Folge. Besonders kleine Kinder können in ein lebensbedrohliches Koma verfallen (cerebrale Malaria).
Die übrigen Plasmodienarten besitzen diese Eigenschaft nicht und sind daher weniger gefährlich. P. malariae unterscheidet sich von den anderen humanpathogenen Plasmodien dadurch, dass es vereinzelt auch andere höhere Primaten befällt.
Klinik: Auf Grund des unterschiedlichen Verlaufs der Erkrankung kann zwischen der Malaria tropica, der Malaria tertiana und der Malaria quartana unterschieden werden. Die durch Plasmodium falciparum ausgelöste Malaria tropica ist dabei die schwerste Verlaufsform der Malaria.
Malaria tropica
Die Malaria tropica wird durch den Erreger P. falciparum verursacht und ist die schwerste Verlaufsform der Malaria. Charakteristisch für die Malaria tropica sind die hohe Parasitämie, die teils ausgeprägte Anämie und die häufigen neurologischen Komplikationen. Es kann ein rhythmischer Fieberverlauf vorliegen. Ein Fehlen der Fieberrhythmik ist jedoch kein Ausschlusskriterium einer Malaria tropica.
Inkubationszeit: Zwischen dem Stich der Anopheles-Mücke und dem Krankheitsausbruch liegen im Mittel zwölf Tage. Erheblich kürzere Zeitintervalle treten bei einer Infektion mit erregerhaltigem Blut auf. Längere Inkubationszeiten sind unter Einnahme einer unzureichenden Chemoprophylaxe möglich.
Fieber: Das typische wechselnde Fieber mit Schüttelfrost beim Fieberanstieg und Schweißausbrüchen bei Entfieberung, wie es bei anderen Malariaformen auftritt, wird bei der Malaria tropica in der Regel nicht beobachtet. Daher kann man eine Malaria, insbesondere eine Malaria tropica nicht allein aufgrund der Tatsache ausschließen, dass keine typische Fieberrhythmik vorliegt. Ein hohes Fieber über 39,5°C tritt häufig bei Kindern auf und ist als prognostisch ungünstig zu beurteilen. Häufig kommt es zu zentralen Komplikationen und Koma.
Neurologische Komplikationen: Bewusstseinsstörungen, die bis zum Koma reichen können, stellen eine typische Komplikation der Malaria tropica dar. Dabei sind plötzliche Wechsel der Bewusstseinslage ohne Vorzeichen durchaus möglich. Es kann auch zu einer langsamen Eintrübung des Patienten kommen. Im Rahmen einer zerebralen Malaria können auch neurologische Herdsymptome wie Lähmungen und Krampfanfälle auftreten. Die normale neurologische Diagnostik führt hier kaum zu einer adäquaten Diagnose. Eine hohe Parasitenzahl im Blut dient als entscheidender Hinweis.
Bei Schwangeren und Kindern können Hypoglykämien auftreten, die allein oder mit der zentralen Problematik zum Koma führen.
Anämie: Anämien treten häufig bei schweren Infektionen auf. Eine besondere Risikogruppe für schwere Anämien stellen Säuglinge und Kleinkinder dar. Meist handelt es sich um eine hämolytische Anämie durch Zerstörung roter Blutkörperchen. Wie oben erwähnt besitzt auch die Hemmung der Erythropoese eine gewisse Bedeutung. Die Schwere der Anämie korreliert stark mit dem Ausmaß des Parasitenbefalls.
Hämoglobinurie: Der durch die massive Hämolyse angestiegene Hämoglobin-Spiegel im Blut führt zu einer Hämoglobinurie, die zu einem akuten Nierenversagen führen kann.
Veränderungen an anderen Organsystemen: Im Laufe der Erkrankung kann es zu einer Splenomegalie kommen. In seltenen Fällen führt das Gewebswachstum zu einer Spannung der Kapsel, so dass diese leicht einreißen kann (Milzruptur). Den Magen-Darm-Trakt betreffende Symptome wie Durchfälle sind häufig und differentialdiagnostisch von Bedeutung, da sie bei fehlendem oder schwach ausgeprägtem Fieber zur falschen Diagnose bakterielle Enteritis führen können.
In bis zu zehn Prozent der Fälle kann eine Lungenbeteiligung auftreten, die von leichten Symptomen bis zu einem Lungenödem reichen kann.
Nicht selten kommt es durch eine Durchblutungsstörung der Niere zu einem akuten Nierenversagen. Nach ausgeheilter Infektion erholt sich die Niere meist.
Malaria tertiana
Die Malaria tertiana wird durch die Erreger P. vivax oder P. ovale verursacht. Sie ist eine der gutartigen Verlaufsformen der Malariaerkrankung. Es treten im Vergleich zur Malaria tropica kaum Komplikationen auf. Das Hauptproblem besteht darin, die unspezifischen Vorsymptome von der bösartigen Malaria tropica abzugrenzen. Dies gelingt meist nur in der mikroskopischen Diagnostik.
Inkubationszeit: Die Inkubationszeit beträgt zwischen 12 und 18 Tagen, kann aber auch mehrere Monate dauern, wenn der Verlauf der Infektion durch die Chemoprophylaxe verlangsamt wird.
Fieber: Nach einer unspezifischen Prodromalphase von wenigen Tagen stellt sich normalerweise die typische Dreitagesrhythmik ein, die der Malaria tertiana ihren Namen gab. Zwischen zwei Fiebertagen liegt in der Regel ein fieberfreier Tag.
Die Fieberattacken gehorchen meist folgendem Schema:
- Froststadium (1 Stunde): Der Patient leidet unter Schüttelfrost und dem subjektivem Gefühl starker Kälte. In dieser Phase steigt die Temperatur steil an.
- Hitzestadium (4 Stunden): Die Haut brennt häufig quälend. Es treten schwere Übelkeit und Erbrechen auf. Die Temperatur kann über 40 °C betragen.
- Schweißstadium (3 Stunden): Unter starkem Schwitzen sinkt die Temperatur bis zum Normalwert von 37 °C.
Wie bei allen anderen Malariaformen gilt auch hier, dass das Fehlen der Fieberrhythmik keineswegs ausreicht, um die Krankheit auszuschließen.
Rezidive: Wie schon oben erwähnt, bilden sich im Lebenszyklus von P. vivax und P. ovale Ruheformen, die so genannten Hypnozoiten, aus. Sie können der Anlass dafür sein, dass es nach einer Ruhephase von Monaten bis Jahren zum erneuten Ausbruch der Krankheit kommt. Diesem muss nicht unbedingt eine anamnestisch bekannte Malariaerkrankung vorausgehen. Die Rezidive sind besonders tückisch, da oft weder vom Patient noch vom Arzt ein Zusammenhang zur Malaria hergestellt wird. Sie können jedoch in der Regel durch medikamentöse Maßnahmen (in erster Linie unter Einsatz von Primaquin) langfristig unterbunden werden.
Malaria quartana
Die Malaria quartana wird durch den Erreger P. malariae verursacht. Auch hier handelt es sich um eine benigne Form der Malaria. Eine charakteristische Komplikation ist das nephrotische Syndrom. Besonders an dieser Form ist, dass es selbst nach einer sehr langen Zeit (>50 Jahre) noch zu Rezidiven kommen kann. Auch die Inkubationszeit ist erheblich länger als bei den beiden anderen Formen.
Inkubationszeit: Die Inkubationszeit beträgt zwischen 16 und 50 Tagen. Somit ist sie erheblich länger als bei den übrigen Krankheitsformen.
Fieber: Die Prodromalphase ist genauso unspezifisch wie die der Malaria tertiana. Schon nach wenigen Tagen stellt sich die Vier-Tages-Rhythmik ein. Zwischen zwei Fiebertagen liegen zwei fieberfreie Tage. Die Stadienabfolge (Frost-Hitze-Schweiß) am Fiebertag entspricht der Malaria tertiana. Auch hier gilt: fehlende Fieberrhythmik schließt die Diagnose Malaria nicht aus.
Nierenbeteiligung:

Im Verlauf der Malaria quartana kann es zu einer schweren Nierenbeteiligung kommen. Diese wird unter anderem als Malarianephrose bezeichnet. Es handelt sich hierbei um ein nephrotisches Syndrom mit erniedrigtem S-Albumin mit Ödemen und Aszites und erhöhtem Serumcholesterin. Epidemiologische Studien haben gezeigt, dass diese Komplikation gehäuft bei Kindern zwischen zwei und zehn Jahren im tropischen Afrika auftritt.
Rezidive: Das besondere an diesem Plasmodium sind die Rezidive nach besonders langem krankheitsfreiem Intervall (mehrere Jahre). Rezidive nach Krankheitsfreiheit von mehr als 50 Jahren wurden beschrieben. Die Rezidive kommen aber hier nicht durch Hypnozoiten in der Leber zustande (es gibt keine Hypnozoitformen des P. malariae), sondern durch eine fortdauernde subklinische Parasitämie. Diese ist so gering, dass er mikroskopisch meist nicht nachgewiesen werden kann. Dies ist besonders in der Transfusionsmedizin in Endemiegebieten von großer klinischer Bedeutung, da es auch bei negativ getestetem Spender zu einer Malariaübertragung kommen kann. Rezidive können jedoch in der Regel durch medikamentöse Maßnahmen langfristig unterbunden werden.
Malaria-Diagnostik: Die Diagnose Malaria sollte mit Hilfe labordiagnostischer Methoden abgesichert werden. Die in der Praxis wichtigste und kostengünstigste Methode bei Malariaverdacht ist die mikroskopische Untersuchung von normalen (Dünner Tropfen, Blutausstrich) bis zu 10-fach angereicherten Blutausstrichen (Dicker Tropfen) unter Verwendung der Giemsa-Färbung auf Plasmodien. Der Blutausstrcih hat den Vorteil, dass man sofort eine Diagnose stellen kann, der dicke Tropfen hat hingegen eine 10fach höhere Sensitivität, braucht aber etwas Zeit.
Eine Differenzierung der vier Plasmodien-Arten ist anhand morphologischer Kriterien möglich. Die ermittelte Parasiten- und Leukozytenzahl ist ein Maß der Schwere der Erkrankung. Ein negatives Ergebnis der mikroskopischen Untersuchung kann auf Grund der geringen Sensitivität dieser Methode eine Malaria jedoch nicht ausschließen.
Alternativ können die Erreger der Malaria immunologisch und molekularbiologisch nachgewiesen werden. Die zur Verfügung stehenden Malaria-Schnelltests (z.B. ICT Malaria P.F.®-Test, OptiMal®-Test) beruhen auf dem Nachweis parasitenspezifischer Antigene. Ein negatives Ergebnis kann jedoch auch bei diesen Tests eine Malaria nicht ausschließen. Das mit Abstand sensitivste Verfahren für die Malaria-Diagnostik ist die Polymerasekettenreaktion (PCR). Sie ist jedoch auf Grund des hohen Material- und Zeitaufwands für den Akutfall wenig geeignet.
Therapie: Seit dem 17. Jahrhundert wird die Chinarinde und das daraus gewonnene Chinin zur Therapie der Malaria verwendet - die Legende besagt, dass britische Kolonialisten daher regelmäßig stark chininhaltiges Tonic Water tranken und um den damals sehr bitteren Geschmack zu verbessern oft dieses mit Gin mischten und so den Gin Tonic erfanden. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich die Anzahl der Therapiemöglichkeiten vervielfacht und es besteht die Möglichkeit einer medikamentösen Vorbeugung (Chemoprophylaxe). (s.u.)
Individualprophylaxe:
- Imfung: Es gibt zur Zeit noch keine Imfung gegen Malaria. Der beste Schutz ist der Verzicht auf Reisen in Gebiete, in denen Malaria übertragen wird (Endemiegebiete).
- Expositionsprophylaxe: Die Vermeidung von Insektenstichen ist das wichtigste Element der Malariavorbeugung in Endemiegebieten. Dazu zählt das Tragen hautbedeckender, langer Kleidung, der Aufenthalt in mückensicheren Räumen (insbesondere nachts; Klimaanlage, Fliegengitter, Moskitonetz) sowie die Behandlung von Haut und Kleidung mit moskitoabweisenden Mitteln, sog. Repellents (z.B. Autan®, DEET). Die zusätzliche Verwendung von Insektiziden in Sprays (allen voran Pyrethroide), Verdampfern, Räucherspiralen („mosquito coils“) und ähnlichem kann zusätzlichen Schutz bieten.
- Chemoprophylaxe und Stand-By-Therapie: Zusätzlich sollte durch vorbeugende Einnahme (Chemoprophylaxe) oder Mitführen (Stand-By-Therapie) von Malaria-Medikamenten das Risiko an einer schweren Malaria zu erkranken verringert werden. Siehe auch Empfehlungen der Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit e.V.. Allerdings ist die Chemoprophylaxe ein zweischneidiges Schwert, da dadurch auch zunehmend resistente Plasmodien in den Endemiegebieten herangezüchtet werden und im Krankheitsfalle u.U. keine adäquate Therapie mehr möglich ist.
Das größte Problem bei der medikamentösen Vorbeugung und Behandlung ist eine zunehmende Resistenz des Erregers. Die Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit e.V. empfiehlt derzeit (Stand 2005):
- in Gebieten mit hohem Malariarisiko und bekannter Chloroquin- und Mefloquin-Resistenz (z.B. Goldenes Dreieck): Aufenthalt >7 Tage: Prophylaxe mit Atovaquon-Proguanil oder Doxycyclin. Aufenthalt ≤7 Tage: Keine Prophylaxe, bei Erkrankung Notfalltherapie mit Artemether-Lumefantrin oder Atovaquon-Proguanil.
- in Gebieten mit hohem Malariarisiko und bekannter Chloroquinresistenz (z.B. Hochrisikogebiete Afrikas, Papua-Neuguinea, Salomonen, Brasilien (Bundesstaaten Rondônia, Roraima und Amapá)): Prophylaxe mit Atovaquon-Proguanil, Doxycyclin oder Mefloquin. Die im Jahr 2003 erschienene Allmalpro-Studie konnte bei der Chemoprophylaxe eine bessere Verträglichkeit von Atovaquon-Proguanil und Doxycyclin im Vergleich zu Mefloquin belegen.
- in Gebieten mit geringem Malariarisiko und bekannter Chloroquin- und Mefloquinresistenz (z.B. Südost-Asien ohne Hochrisikogebiete): Keine Prophylaxe, bei Erkrankung Notfalltherapie mit Artemether-Lumefantrin oder Atovaquon-Proguanil.
- in Gebieten mit geringem Malariarisiko und bekannter Chloroquinresistenz (z.B. Brasilien ohne Hochrisikogebiete, China, Taiwan, Vanuatu, Arabische Halbinsel, Indien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesien, Philippinen): Keine Prophylaxe, bei Erkrankung Notfalltherapie mit Artemether-Lumefantrin, Atovaquon-Proguanil oder Mefloquin
- in Gebieten mit geringem Malariarisiko ohne bekannte Resistenzen (z.B. Mittelamerika, Haiti, Dominikanische Republik): Keine Prophylaxe, bei Erkrankung Notfalltherapie mit Chloroquin
Wirkstoffe: Neben den bereits genannten Substanzen stehen Chinin (zur Therapie, insbesondere bei der komplizierten Malaria tropica), Primaquin (Therapie der Malaria tertiana oder Malaria quartana; beugt Rezidiven vor; Verwendung zur Prophylaxe nur in Ausnahmefällen) und Proguanil (Prophylaxe; meist in Kombination mit Chloroquin; Verwendung nur noch in Ausnahmefällen) zur Verfügung. Vor allem in China, Südostasien und Afrika werden Artemisinin-haltige Präparate (einschließliche deren Abkömmlinge Artemether, Artesunat, Arteflene, Artemotil, Dihydroartemisinin und Arteether) eingesetzt. Diese im Rahmen einer Kombinationstherapie (Artemisinin-based combination therapy) eingesetzten Präparate werden von der WHO als Mittel der ersten Wahl für die Akutbehandlung der Malaria empfohlen. Artesunat wird seit neuestem auch von der AG Malaria der Paul-Ehrlich-Gesellschaft als Mittel der ersten Wahl zur Therapie der komplizierten Malaria tropica empfohlen. Die Stand-By-Therapeutika Halofantrin und Amodiaquin wurden in Europa wegen schwerer Nebenwirkungen mittlerweile vom Markt genommen, sind jedoch noch vereinzelt in Malariagebieten als Notfallmedikamente verfügbar. Halofantrin wurde mit Herzrhythmusstörungen in Verbindung gebracht, während unter der Therapie mit Amodiaquin vermehrt Leberschäden und Blutbildschäden (Agranulozytose, aplastische Anämie) auftraten. Insbesondere in Endemiegebieten ist die Kombination von Sulfadoxin-Pyrimethamin, die sowohl zur Therapie als auch zur Prophylaxe für einheimische schwangere Frauen in Endemiegebieten als „intermittent Preventive Treatment“ (IPT) angewendet wird, verfügbar. Diese Arzneistoffkombination wurde jedoch in Deutschland auf Grund schwerer Hautreaktionen (Stevens-Johnson-Syndrom) vom Markt genommen. Für weitere Details konsultiere man die Empfehlungen von Tropenmedizinern.
Vektorkontrolle: Als Vektorkontrolle (Bekämpfung des Überträgers) bezeichnet man den Versuch, Neuinfektionen durch gezielte Bekämpfung der Anopheles-Mücke zu verhindern. Zu diesem Zweck werden Insektizide in den Wohnstätten der Menschen versprüht oder es wird die Verwendung von insektizidimprägnierten Bettnetzen (IIB) propagiert.
In den 1950er und 1960er Jahren wurde unter Federführung der WHO versucht, die Malaria auszurotten. Ein wichtiger Bestandteil der Kampagne war das Besprühen der Innenwände aller Wohnungen und Häuser mit DDT. Nach anfänglichen Erfolgen wurde das Projekt Anfang der 1970er Jahre eingestellt, unter anderem weil durch die Selektion nur noch DDT-resistente Anopheles-Mücken überlebten und rasch vermehrten.
Der Einsatz von DDT in Wohnhäusern wird auch heute noch für vertretbar erachtet, da es dem Menschen sicher weniger schadet als dies eine Malaria-Infektion täte. Negative Auswirkungen auf die Umwelt sind wegen der im Vergleich zur Landwirtschaft geringen Aufwandmengen nicht zu befürchten. Vor einem Einsatz von DDT oder anderen Insektiziden sollte immer die Resistenzsituation der Anopheles-Mücken im betreffenden Gebiet geprüft werden. Heute ist die Herstellung und Verwendung von DDT weltweit nur noch zum Zwecke der Bekämpfung von Krankheitsüberträgern zugelassen.
Forschung und Ausblicke:Die Basensequenzen in den Genomen von P. falciparum und Anopheles gambiae wurden im Herbst 2002 vollständig entschlüsselt. Etwa zeitgleich wurden neue Malariatherapeutika, wie z.B. Atovaquon, Lumefantrin und die vom Naturstoff Artemisinin abgeleiten Artesunat und Artemether, auf den Markt gebracht. Erste Erfolg versprechende Ergebnisse der Behandlung Malariakranker mit Tafenoquin und dem Antibiotikum Fosmidomycin wurden ebenso vorgestellt.
Versuche, einen weltweit wirkenden Impfstoff gegen die Malaria zu entwickeln, schlugen trotz einiger anfänglicher Erfolge bisher fehl. Das größte Problem bei der Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes ist die hohe Variabilität der Malaria-Antigene. Eine neue Hoffnung versprechen entschärfte lebende Erreger, denen das Gen UIS3 eliminiert wurde. Diese Sporozoiten wurden Mäusen gespritzt, wobei keinerlei Plasmodienformen entstanden, die von dem symptomlosen Leberstadium in die roten Blutkörperchen wechseln konnten. Das Ergebnis der Immunreaktion war eindrucksvoll. Keine einzige geimpfte Maus steckte sich nach einer Infektion mit normalen Plasmodien an, während in der Kontrollgruppe alle erkrankten.[5] Ein weiterer aussichtsreicher Kandidat ist RTS,S, der eine immunstimulierende Komponente eines Proteins des Hepatitis-B-Virus (RTS) mit einem Oberflächenprotein aus Sporozoiten (S) des P. falciparum trägt. Dadurch wird die - noch nicht vollständige - Immunantwort in einem frühen Stadium, das noch keine Krankheitssymptome hervorbringt, ausgelöst. Für einen kompletten Immunschutz ist geplant, den Impfstoff mit weiteren Antigenen des Malaria-Erregers zu kombinieren.[6] Ein interessanter alternativer Therapieansatz dürfte die Verwendung eines Antikörpers gegen Plasmodien sein.
Eine weitere Möglichkeit der Bekämpfung der Malaria ist die Ausrottung der Anopheles-Mücke. Der Versuch der Ausrottung der Anopheles-Mücken mit Hilfe von DDT wurde in den 1970er Jahren abgebrochen. Mit Hilfe anderer Insektizide, wie z.B. das pflanzliche Pyrethrum aus Chrysanthemenblüten, konnten nur örtlich und zeitlich begrenzte Teilerfolge erreicht werden. Ein hoffnungsvoller neuer Ansatz ist der Einsatz des biogenen Insektizids Bti bestehend aus dem Bacillus thuringiensis israeliensis. Dieses biologische Präparat, das über Züchtung millionenfach im Labor hergestellt werden kann, ist gegenüber Stechmücken ein erprobtes, hochwirksames Präparat, das bei richtiger Anwendung "Nicht-Ziel-Organismen" weitgehend schont. Bti wird in kristalliner Form in die aquatilen Lebensräume von Stechmücken ausgebracht. Die Anopheles-Larven nehmen die Bakterien bei der Nahrungsaufnahme in ihren Körper auf. Im Darm der Mücken schlüpfen die Bakterien aus ihrer schützenden Eiweißhülle und zerstören in kurzer Zeit durch die Bildung von Delta-Endotoxinen das Darmlumen und die Darmwände ihrer Wirtstiere. Die Stechmückenlarven stellen daraufhin ihre Nahrungsaufnahme ein und gehen noch im Larvalstadium zugrunde. Bti wird kommerziell angeboten. Das Insektizid ist in flüssiger, Tabletten-, Pulver- und in Granulatform erhältlich. Für den großflächigen Einsatz im Freiland hat sich die Verwendung von Granulat bewährt. Bei starker Durchseuchung der Gewässer wird die Ausbringung des Granulats durch Hubschrauber praktiziert.
Außerdem forscht die gemeinsame Abteilung der IAEA und FAO an einer neuartigen Methode zur Ausrottung der Anopheles-Mücke. In diesem Zusammenhang wird die Aussetzung steriler oder genetisch modifizierter Anopheles-Mücken diskutiert (Sterile Insect Technology).
Sozialmedizinische und epidemiologische Aspekte: Die Malaria wird auch als armutsbedingte Krankheit bezeichnet. Hinter dieser Bezeichnung steht das Kalkül, dass von der Krankheit hauptsächlich arme Menschen betroffen sind, die über wenig Kaufkraft verfügen und folglich keinen attraktiven Markt bilden. Für Pharmaunternehmen ist es daher ökonomisch sinnvoller, Mittel gegen medizinisch weniger "dringende" Krankheiten zu erforschen, deren Betroffene kaufkräftiger sind.
Norbert Blüm schreibt dazu in der Süddeutschen Zeitung vom 7. Oktober 2003: "Die Pharmaindustrie gibt weltweit doppelt so viel Forschungsmittel im Kampf gegen Haarausfall und Erektionsschwächen aus wie gegen Malaria, Gelbfieber und Bilharziose. Das ist marktwirtschaftlich konsequent, denn die Kunden mit Erektionsschwächen und Haarausfall haben in der Regel mehr Kaufkraft als die Malaria- und Gelbfieberkranken."[7]
Die Europäische Union will als Reaktion auf diesen Mechanismus die Entwicklung von Mitteln gegen armutsbedingte Krankheiten mit 600 Millionen Euro fördern.[8]
Andererseits ist es fraglich, ob gerade für Regionen, in denen die Malaria wie die Armut verbreitet sind, die Bekämpfung der Malaria durch Entwicklung eines Impfstoffes im Vordergrund stehen sollte. Der Parasitologe Paul Prociv weist darauf hin, dass Erwachsene in Malariagebieten durch ständige Reinfektion praktisch immun gegen die Krankheit sind. Vorrang hätte die Hebung der allgemeinen Gesundheitsfürsorge und Lebensumstände. Von einem Malariaimpfstoff würden hauptsächlich westliche Besucher der Tropen profitieren, die die Nebenwirkungen der herkömmlichen Malariavorsorge scheuen.[9]
Aufgrund der mangelnden finanziellen Unterstützung gab der reichste Mann der Welt, Bill Gates, Ende Oktober 2005 bekannt, dass er zur Förderung der Malariaforschung eine Summe von 258,3 Millionen Dollar zur Verfügung stellen werde. Seiner Meinung nach stelle "es für die Welt eine Schande dar, dass sich in den letzten 20 Jahren jene durch Malaria hervorgerufenen Todesfälle verdoppelten, zumal gegen jene Krankheit sehr stark vorgegangen werden könnte."[10]
Volkswirtschaftliche Auswirkung Nach dem Weltökonomen Prof. Dr. Jeffrey Sachs sind tropische Krankheiten, insbesondere aber Malaria, eine Hauptursache für die somit häufig unverschuldete wirtschaftliche Misere der ärmsten Länder der Erde: wo diese Krankheit wütet, also vor allem in den Tropen und Subtropen, herrscht auch Armut. So hatten Mitte der 1990er Jahre von Malaria heimgesuchte Länder ein durchschnittlichen Volkseinkommen von rund 1.500 Dollar pro Kopf, während nicht betroffene Länder mit durchschnittlich 8.200 Dollar über mehr als das Fünffache verfügten. Volkswirtschaften mit Malaria sind zwischen 1965 und 1990 durchschnittlich nur um 0,4 Prozent im Jahr gewachsen, die anderen dagegen um 2,3%. Der durch die Krankheit verursachte volkswirtschaftliche Schaden für Afrika allein wird umgerechnet auf rund 9,54 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.
Nach Studien von Sachs liegt die durch Malaria verursachte Lähmung der Volkswirtschaften der betroffenen Länder nicht nur an den direkten Kosten für Medikamente und medizinische Behandlung. In Ländern mit Malaria sterben die Menschen im Durchschnitt früher als andernorts, deshalb wird dort weniger in Bildung investiert. Die hohe Kindersterblichkeit führt wiederum zu steigenden Geburtenraten. Zudem meiden ausländische Investoren solche Länder ebenso wie Touristen und Handelsunternehmen.
Mittlerweile hat AIDS die ungünstige Situation für diese Länder noch dramatisch verschärft.
Historie: Die frühesten Berichte von Malariaepidemien sind uns von den Alten Ägyptern (u.a. aus dem Papyrus Ebers) erhalten. Aber auch in rund 3000 Jahre alten indischen Schriften taucht das Wechselfieber auf. Die Chinesen hatten vor über 2000 Jahren sogar schon ein Gegenmittel. Sie nutzten die Pflanze Qinghao, ein Beifuß-Gewächs. In der Neuzeit konnten Forscher tatsächlich einen wirksamen Stoff aus dieser Pflanze isolieren: das Artemisinin.
In der Antike verbreitete sich die Malaria rund um das Mittelmeer. Hippokrates erkannte, dass Menschen aus Sumpfgebieten besonders häufig betroffen waren, jedoch vermutete er, dass das Trinken von abgestandenem Sumpfwasser die Körpersäfte (vgl. Humoralpathologie) in ein Ungleichgewicht bringt. Von unsichtbaren Krankheitserregern wusste man damals noch nichts.
Auch das Römische Reich wurde regelmäßig von schweren Malariaepidemien heimgesucht. Einige Historiker gehen sogar davon aus, dass sie einen der entscheidenden Faktoren für den Untergang des Römischen Reiches darstellen. Erst unlängst wurde bei Rom ein Kindermassengrab mit über 50 Leichen entdeckt, das auf das Jahr 50 datiert wurde. Aus den Knochenresten dieser Kinderskelette konnte die DNA von P. falciparum isoliert werden.
Im Mittelalter bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war die Malaria nicht nur in Süd-, sonder auch in Mitteleuropa verbreitet. Zum Beispiel war es in Norddeutschland als Marschenfieber bekannt. Berühmte europäische Malariapatienten waren Friedrich Schiller und Oliver Cromwell. Erst durch die Trockenlegung von Sumpfgebieten und durch den systematischen Einsatz von Insektiziden konnte die Malaria in den 1960er Jahren in Europa ausgerottet werden.
Aus Nord- und Südamerika sind die ersten Malariafälle erst im 16. Jahrhundert dokumentiert. Man geht heute davon aus, dass sie durch die Europäer bzw. durch den von ihnen organisierten Sklavenhandel dort eingeschleppt worden ist. Doch ausgerechnet von dort kam ein Heilmittel, das heute noch Verwendung findet. Peruanische Arbeiter bekämpften Fieber erfolgreich mit der Rinde eines Baumes aus der Familie der Rötegewächse, zu denen auch die Kaffeepflanze gehört. Mitglieder des Jesuitenordens beobachteten diese Wirkung und brachten das Mittel in Pulverform erstmals 1640 nach Europa, wo es auch "Jesuitenpulver" genannt wurde. Der Baum wurde später als "Chinarinde" (Cinchonia) bekannt, das Medikament als "Chinin".
Chinin hat einen äußerst bitteren Geschmack und ist hellbraun bis beige. Es wird als Aromastoff für Tonicwater und Bitter Lemon verwendet. Bis heute hält sich die Legende, regelmäßiges Trinken von Gin Tonic schütze vor Malaria. Jedoch ist heutzutage die Chininkonzentration in einem Gin-Tonic-Drink viel zu gering.
Der Malariaerreger wurde am 6. November 1880 vom Franzosen Alphonse Laveran entdeckt, der in Constantine (Algerien) am Militärkrankenhaus arbeitete. Er erhielt dafür 1907 den Nobelpreis für Medizin.
Ronald Ross, Chirurg und General aus England, fand 17 Jahre später bei seiner Arbeit während des Baus des Sueskanals den Zusammenhang zwischen dem Malariaerreger und dem Stich der Anophelesmücke heraus und erhielt dafür nicht ganz unumstritten den Nobelpreis für Medizin 1902. Den Zusammenhang zwischen Mücken und Malaria hatten im übrigen schon die alten Ägypter 3000 v. Ch. erkannt. Sie wurde als Fluch der Götter bzw. des Nils angesehen.
In den 1950er Jahren begann die WHO das Global Eradication of Malaria Program. Neuansteckungen durch Mückenstiche sollten durch Besprühen der Innenwände der Häuser mit DDT-Lösung verhindert werden. Parallel dazu sollten die bereits Erkrankten mit Chloroquin behandelt werden, um auch die eigentlichen Erreger, die Plasmodien, zu bekämpfen.
Die Kampagne war zunächst äußerst erfolgreich. In Holland, Italien, Polen, Ungarn, Portugal, Spanien, Bulgarien, Rumänien und Jugoslawien wurde Malaria bis Ende der 1960er Jahre dauerhaft ausgerottet. In Europa waren allerdings nicht allein DDT, sondern auch die Trockenlegung von Feuchtgebieten, ein funktionierendes Abwassersystem und vor allem eine effiziente Gesundheitsfürsorge ausschlaggebend.
Auch in vielen Ländern Asiens sowie Süd- und Mittelamerikas konnte die Zahl der Neuansteckungen mit Malaria dramatisch gesenkt werden. Hier wurden häufig nach ersten Erfolgen Geld und medizinisches Personal aus den Anti-Malaria-Kampagnen abgezogen und anderweitig eingesetzt. Dadurch blieben neue Malariafälle unentdeckt oder konnten nicht ausreichend behandelt werden. Im Lauf der Jahre traten DDT-Resistenzen bei verschiedenen Arten der Anophelesmücke auf. Der notwendige Ersatz von DDT durch andere Insektizide wurde meist unterlassen, da diese um den Faktor 4 bis 10 teurer gewesen wären. Zudem waren auch die Plasmodien teilweise gegen Chloroquin resistent geworden.
In Indien konnte durch das Bekämpfungsprogramm die Zahl der jährlichen Malaria-Neuinfektionen von 100 Millionen (1952) auf 50.000 (1961) gesenkt werden. Zwischen 1961 und 1968 verdreifachten sich die Infektionsfälle in Indien wieder. Im Jahre 1970 wurden eine halbe Million Neuerkrankungen gezählt, 1977 erkrankten infolge einer Epidemie 30 Millionen Inder an Malaria.
Ein weiteres Beispiel ist Ceylon (Sri Lanka): 1948 waren dort 2,8 Millionen Menschen an Malaria erkrankt, weshalb sich die Regierung entschloss, ein DDT-Sprüh-Programm zu beginnen. Bis 1963 sank die Zahl der Malariaerkrankungen in Ceylon auf 17 Fälle. Man schloß daraus, dass die Krankheit besiegt sei und beendete das Versprühen von DDT. Ein Jahr danach zählte man schon 150 Fälle von Malaria und bis 1969 erhöhte sich die Zahl auf 2,5 Millionen Fälle jährlich. Durch die Wiederaufnahme des Sprühprogramms konnte die Zahl der Krankheitsfälle bis 1972 noch einmal auf 150.000 gesenkt werden. Trotz andauernden massiven DDT-Einsatzes erkrankten in Ceylon 1975 wieder etwa 400.000 Menschen an Malaria.
Die WHO stellte ihr Programm zur Ausrottung der Malaria 1972 offiziell als gescheitert ein.
Literatur und Weblinks:
Deutsche Werke:
- J. Knobloch, Malaria, Uni-Med, Bremen (2002); ISBN 3895996238
- Waldemar Malinowski, Impfungen für Auslandsreisende und Malariaprophylaxe, Wuv (2001); ISBN 3850765385
Englische Werke:
- D. Sullivan, S. Krishna, Malaria, Springer, Berlin (2005); ISBN 3540253637
- Peter Perlmann, Marita Troye-Blomberg, Malaria Immunology, Karger (2002); ISBN 3805573766
- D. Warrell, H. Gilles, Essential Malariology, Arnold, London (2002); ISBN 0340740647
Wissenschaftliche Publikationen:
- B.M. Greenwood, K. Bojang, C.J.M. Whitty, G.A.T. Targett: Malaria. The Lancet 365, S. 1487-1498 (2005)
- August Stich, Katja Fischer, Michael Lanzer: Eine Seuche auf dem Vormarsch: Die Überlebensstrategie des Malariaerregers, Biologie in unserer Zeit 30(4), S. 194 - 201 (2000); ISSN 0045-205X
- Jochen Wiesner, Regina Ortmann, Hassan Jomaa, Martin Schlitzer: Neue Antimalaria-Wirkstoffe, Angewandte Chemie 115(43), S. 5432 - 5451 (2003); ISSN 0044-8249
- I. Stock, Therapie der Malaria, Medizinische Monatsschrift für Pharmazeuten 27(8), S. 260 - 272 (2004); ISSN 0342-9601
- H. Idel, Malaria: Prophylaxe und reisemedizinische Bedeutung, Bundesgesundheitsblatt 42(5), S. 402 - 407 (1999); ISSN 1436-990
- Helge Kampen, Vektor-übertragene Infektionskrankheiten auf dem Vormarsch? Wie Umweltveränderungen Krankheitsüberträgern und -erregern den Weg bereiten, Naturwissenschaftliche Rundschau 58(4), S. 181 - 189 (2005); ISSN 0028-1050
- Margot Kathrin Dalitz, Autochthone Malaria im mitteldeutschen Raum, Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2005) Web
Weblinks:
- RKI - Malaria
- AWMF - Diagnostik und Therapie der Malaria (Nov 2005)
- http://www.dtg.org/1.0.html - Empfehlungen zur Malariaprophylaxe
- http://www.who.int/malaria/docs/TreatmentGuidelines2006.pdf
- http://www.meb.uni-bonn.de/hygiene/malaria - Malariaverbreitung mit spezifischen Länderinformationen
- http://plasmodb.org/ - Genomdatenbank der Plasmodien
- http://sites.huji.ac.il/malaria/ - Biochemie der Plasmodien
- http://www.sueddeutsche.de/wissen/artikel/92/45047 - SZ über Artemisia annua
- http://www.gigers.com/matthias/malaria/history.htm - Geschichte der Malaria und historische Behandlungsmethoden
- http://e-learning.studmed.unibe.ch/Malaria
Helminthen
Annelida (Ringelwürmer)
Hirudo medicinalis (Blutegel)
| Hirudo medicinalis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Der medizinische Blutegel (Hirudo medicinalis) ist ein blutsaugender Ektoparasit, der seit Jahrhunderten in der Medizin zur Aderlass- und Gerinnungstherapie Verwendung findet.
Verbreitung: Blutegel sind weltweit verbreitet in Feuchtgebieten. Sie sind gute Schwimmer und benötigen sauberes Wasser als Lebensraum. Außerhalb des Wassers bewegt sich der Blutegel mit Hilfe von zwei Saugnäpfen an den Körperenden schreitend fort. Durch den übertriebenen Einsatz medizinischer Blutegel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Blutegelbestände vielerorts radikal dezimiert. Allein Frankreich importierte zwischen 1827 und 1838 etwa 350 Millionen Blutegel. In England und Deutschland sahen die Zahlen ähnlich aus. Mittlerweile sind medizinische Blutegel in Europa nur noch in wenigen Gebieten in ihrer natürlichen Umgebung zu finden und stehen beispielsweise in Deutschland unter Naturschutz. Der Bedarf an medizinischen Blutegeln wird seither durch Zuchtstationen gedeckt.
Morphologie und Eigenschaften: Blutegel leiten sich von den Ringelwürmern (Annelida) ab, die inneren Segmentgrenzen sind jedoch aufgelöst und äußerlich wegen einer Sekundärringelung auch nicht erkennbar. Egel haben eine feste Anzahl von Segmenten, nämlich 32. Die sehr muskulösen und drüsenreichen Saugnäpfe sind Zusammenschlüsse von mehreren Segmenten. Die Coelomsäcke, die bei Ringelwürmern in jedem Segment vorkommen, sind fast ganz reduziert. Übrig bleibt nur ein Kanalsystem. Der Darm bildet große Blindsäcke aus, in denen Blut gespeichert und verdaut wird. Das deutliche Zeichen der Gürtelwürmer, das Clitellum, ist nur während der Fortpflanzung zu sehen. Der Kopf besitzt drei Kieferplatten mit randständig kleinen, scharfen Zähnen
Erwachsene Tiere sind ausgestreckt etwa 5-10cm lang und bei hellem Licht ist eine Rückenzeichnung zu erkennen. Hirudo medicinalis hat eine bräunliche bis olivgrüne Farbe, rötliche Streifen auf dem Rücken und schwarze Flecken auf dem Bauch. Der Ungarische Blutegel (Hirudo verbana) besitzt einen grünen Bauch.
Blutegel sind langlebig: Sie werden erst mit drei Jahren geschlechtsreif und werden über 30 Jahre alt.
Ernährung: Wie der Name schon andeutet ernährt sich der medizinische Blutegel von Tierblut. Während einer Mahlzeit dickt der eingesaugte Blut ein, das Wasser wird über die Haut ausgeschieden. Das aufgenommene Blut wird im Körper des Egels mit Hilfe von Bakterien konserviert und reicht für ein bis zwei Jahre, in denen der Blutegel keine Nahrung mehr aufnehmen muss.
Blutegel saugen sich an der Haut von Tieren fest, um dann meist schmerzfrei die Haut zu durchbeißen. Mit ihren Beißwerkzeugen durchdringen sie selbst dickes Rinderfell in wenigen Sekunden. Anschließend kann ein Egel in etwa 30 Minuten Blut bis zum Fünffachen seines Körpergewichts saugen. Dabei sondert er über den Speichel etwa 20 verschiedene Substanzen in die Wunde ab, darunter die medizinisch relevanten Blutgerinnungshemmer Heparin und Hirudin und weitere Stoffe wie Hyaluronidase und antiphlogistische Substanzen. Nach Erreichen der Sättigung fällt der Blutegel von selbst ab.
Lebenszyklus: Blutegel sind Zwitter, benötigen jedoch einen Partner und andererseits Säugetierblut, um sich fortzupflanzen. Nach der Paarung werden bis zu 20 Eier außerhalb vom Wasser abgelegt und in Kokons eingesponnen. Nach dem Schlüpfen ernähren sich die jungen Egel von kleinen Wirbellosen, die sie fressen oder aussaugen, sie saugen jedoch auch an Fröschen.
Medizinische Anwendung: Blutegel werden vor allem in der Naturheilkunde angewendet, z.B. bei Arthrose, Varizen, Kopfschmerzen und Dysmenorrhoe. In der Chirurgie verwendet man sie z.B. zur Therapie von Lymphödemen und nach Lappentransplantationen.
Die Egel werden mit einem Spatel auf die entsprechende Hautstelle aufgesetzt. Der Biss ist kaum schmerzhaft. Die Bluegel fallen nach ein bis drei Stunden ab und die Bißstellen bluten noch 8 bis 24 Stunden nach.
Unerwünschte Reaktionen wie Hautrötungen oder Wundinfektionen treten etwa in 1% der Behandlungen auf.
Literatur und Weblinks:
- http://www.aerztezeitung.de/docs/2006/01/19/009a1101.asp?cat=
- http://www.aerztezeitung.de/docs/2001/09/24/170a0104.asp?cat=
Trematoda (Saugwürmer)
Die humanpathogenen Saugwürmer zeichen sich dadurch aus, dass sie meist eine Schnecke als Zwischenwirt haben (manche haben auch noch einen zweiten Zwischenwirt) und im Endwirt meist die Bauchorgane (Leber, Gallenwege, Darm), z.T. auch die Beckenorgane (Harnblasenbilharziose) befallen.
Schistosoma spp. (Pärchenegel)
| Schistosoma spp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Pärchenegel Schistosoma sind eine Gattung parasitisch lebender Saugwürmer, die vor allem in den Tropen und Subtropen vorkommen. Weltweit sind bis jetzt 83 Arten bekannt. Benannt wurden sie 1852 ursprünglich als Bilharzia nach Theodor Bilharz, heute ist nur noch der Name Schistosoma üblich.
Morphologie und Eigenschaften: Die Pärchenegel zeichnen sich durch einige morphologische und physiologische Besonderheiten aus, die sie von allen übrigen Saugwürmern unterscheiden. So handelt es sich etwa um die einzigen getrenntgeschlechtlichen Vertreter unter den Saugwürmern und der sonst übliche zweite Zwischenwirt fehlt. Darüberhinaus sind die Pärchenegel im Endwirt im Venensystem lokalisiert - anders als die übrigen Saugwurmfamilien, deren Vertreter meist in Darm oder Leber zu finden sind. Männchen und Weibchen der Pärchenegel unterscheiden sich in Größe und Gestalt (Geschlechtsdimorphismus): Das längere Weibchen lebt nach der Kopulation in der Bauchfalte des Männchens (Dauerkopula), wobei das Vorder- und Hinterende aus dieser hervorragen. Die Bauchfalte des Männchens wird auch als Canalis gynaecophorus bezeichnet.
Epidemiologie: Die humanpathogenen Vertreter der Pärchenegel sind hauptsächlich in den tropischen Regionen der Welt zu finden. Schistosoma mansoni, der wichtigste Erreger der Bilharziose ist überall dort auf dem afrikanischen Kontinent vertreten, wo der wichtigste Zwischenwirt Biomphalaria pfeifferi vertreten ist. Diese Posthornschnecke ist vor allem in stehenden und langsam fließenden Gewässern zu finden. Schistosoma mansoni gelangte im 19. Jhd. durch den Sklavenhandel nach Südamerika. Auf dem afrikanischen Kontinent kommt weiterhin die wichtige humanpathogene Art Schistosoma haematobium vor. In China, Japan und einigen anderen Ländern Ostasiens findet sich Schistosoma japonicum als humanpathogener Vertreter. In Europa und Nordamerika sind lediglich einige Gattungen vertreten, die bei Entenvögeln parasitieren. Diese Vertreter haben zwar keine medizinische Relevanz für den Menschen - das zweite freischwimmende Larvenstadium, die Cercarie, kann allerdings in betroffenen Badeseen in die Haut des Menschen eindringen, wo sie abstirbt und unangenehmen Juckreiz auslöst (Badedermatitis bzw. Cercariendermatitis).
Es wird geschätzt, dass ca. 250–300 Millionen Menschen von dem Parasiten befallen und 600 Millionen gefährdet sind.
Lebenszyklus: Schistosomen parasitieren bei Säugetieren, Vögeln und Krokodilen (Griphobilharzia) im Gefäßsystem. Die mit dem Harn oder Stuhl des Endwirtes ins Wasser gelangten Eier enthalten eine Wimpernlarve (Miracidium), welche schlüpft und aktiv in den ersten Zwischenwirt (in der Regel eine Posthornschnecke) eindringt. Dort entwickelt sie sich zur sogenannten Muttersporozyste, die wiederum Tochtersporozysten bildet, welche in die Mitteldarmdrüse der Schnecke einwandern. Dort produzieren die Tochtersporozysten die charakteristischen Gabelschwanzcercarien. Letztere verlassen die Schnecke mit deren Ausscheidungen und befinden sich nun wieder frei im Wasser. Im Wasser müssen die Cercarien einen geeigneten Endwirt finden.


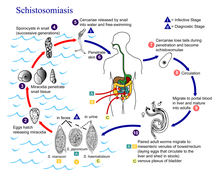

Bei Kontakt mit dem Endwirt dringt die Cercarie durch die Haut in das Gefäßsystem ein und wirft dabei den Gabelschwanz ab. Unter starkem Längenwachstum und Umstrukturierung des Tegumentes wandelt sich die Larve zu einem jungen, aber noch nicht geschlechtsreifen Wurm, den man als Schistosomulum bezeichnet. Die Schistosomulae halten sich zunächst in der Lunge auf und wandern zur Paarung in die Pfortader, wo durch Aufnahme eines Weibchens (7-25mm Länge) in die Bauchfalte des relativ dicken Männchens (6-20mm Länge) die Verpaarung erfolgt. Diese Kopula hält ein Leben lang an, was den Pärchenegeln ihren Namen eingebracht hat.
Die geschlechtsreifen Tiere siedeln sich im Venensystem ihrer Endwirte an, wobei der Ansiedlungsort artspezifisch ist (in der Regel Mesenterialvenen oder Harnblasenvenen). Die adulten Pärchenegel ernähren sich im Endwirt von Bestandteilen des Blutes, darunter Erythrozyten sowie Blutserum.
Das Weibchen gibt täglich je nach Art hunderte bis tausende befruchteten Eier ab. Durch Entzündungsreaktionen in den Venen, in denen die adulten Pärchenegel leben, werden die Gefäße und das umliegende Gewebe arrodiert und die Eier gelangen in den Darm oder die Harnblase. Etwa die Hälfte der Eier wird mit dem Blutstrom verdriftet und gelangt in unterschiedliche Organe des Körpers, wo sie zu lokalen Entzündungen führen.
Die adulten Tiere leben etwa 2 bis 5 Jahre, in Einzelfällen über Jahrzehnte im Endwirt.
Arten und Zwischenwirte: Im folgenden sind einige Arten mit der dazugehörigen Wirts-Schneckengattung darunter aufgeführt.
- Schistosoma mansoni: Biomphalaria glabrata, Biomphalaria alexandrina, Biomphalaria sudanica, Biomphalaria pfeifferi, Biomphalaria straminea, Planorbis boissyi, Australorbis glabratus
- Schistosoma haematobium: Bulinus truncatus, Bulinus globosus (= Physopsis globosa), Physopsis africana, Planorbarius sp.
- Schistosoma intercalatum: Indoplanorbis sp., Bulinus forskali
- Schistosoma japonicum: Oncomelania hupensis, Schistosomophora sp., Katayama sp.
- Schistosoma mekongi: Tricula aperta
 |
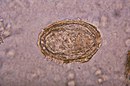 |
 |
Krankheitsbilder: Schistosoma spp. verursachen die Schistosomiasis, auch Bilharziose genannt. Nach der Penetrationsphase mit Juckreiz an der Stelle des Hautinvasion beginnt die akute Phase mit Exanthem, Fieber, Schüttelfrost, Husten, Kopfschmerzen, Hepatosplenomagalie und Lymphadenopathie. Die Erkrankung kann bei Überleben des Erregers chronifizieren und verläuft je nach den befallenen Organen. Schistosoma haematobium ist der Erreger der Blasenbilharziose, bei der vornehmlich die ableitenden Harnwege und die Harnblase befallen sind und Blasenkarzinome entstehen können. Im Gegensatz dazu befallen S. mansoni, S. intercalatum, S. japonicum und S. mekongi eher den Darm.
Diagnostik: Nachweis der Eiern im Stuhl oder Urin, Biopsie, Serologie, Sonographie
Therapie: Zur Therapie werden recht nebenwirkungsarme Medikamente verwandt, sehr gebräuchlich ist eine Ein-Tages-Behandlung mit dem Wirkstoff Praziquantel (z.B. Biltricide®).
Fasciola hepatica (Großer Leberegel) und Fasciola gigantea (Riesenleberegel)
| Fasciola hepatica | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Große Leberegel (Fasciola hepatica) ist ein weltweit vorkommender Parasit (Saugwurm) von bis zu 3cm Länge und lorbeerblattähnlicher Form, der als Endwirt Pflanzenfresser wie Rinder oder Schafe befällt, aber auch Schweine, andere pflanzenfressende Tiere und Menschen. Die Infektion bei Schafen erfolgt hauptsächlich im Sommer und Herbst auf der Weide. Fasciola gigantica führt in Asien und Afrika zur Erkrankung. Die WHO (1995) schätzt die Zahl der mit Fasciola spp. Infizierten auf 2,4 Millionen.
Lebenszyklus: Ein erwachsener Leberegel legt im Gallengangsystem des Endwirtes Eier ab, die mit dem Kot in die Umwelt gelangen. Diese Eier überleben dort 2 bis 6 Monate. In Tümpeln und anderen Wasseransammlungen findet die Entwicklung zur Wimpernlarve (Miracidium) statt, die schwimmend ihren Zwischenwirt findet, die amphibische Zwergschlammschnecke (Lymnaea truncatula, auch Leberegelschnecke genannt, unter 1cm Länge). In Australien ist der Zwischenwirt Lymnaea tomentosa, in Nordamerika Fossaria modicella und Fossaria bulimoides. Als weitere Gattungen werden von G. Piekarski Galba und Radix genannt (Siehe vorerst: Lungenschnecken).

In der Schnecke entwickelt sich die Larve zur Sporozyste weiter, in der sich mehrere Redien bilden, die wiederum Tochterredien bilden, bis sich aus diesen Cerkarien (Schwanzlarven) entwickelt haben. Dieser Vorgang dauert ca. 2 Monate und bringt bis zu 2.000 Zerkarien hervor.
Diese verlassen aktiv die Schnecke und heften sich dicht unter der Wasseroberfläche an Pflanzen o.ä. an. Danach verlieren sie ihren Antriebsschwanz und werden zur infektiösen Metacercarie. In diesem Stadium ist der Leberegel äußerst robust und kann selbst tiefste Temperaturen unter -15 °C wochen- bis monatelang überleben.
Von diesen Pflanzen gelangen sie wiederum in den Endwirt und können dort heranwachsen. Seltene Infektionen beim Menschen in Europa sind durch Genuss roher Brunnenkresse, seltener auch Löwenzahn sowie Fallobst, besonders aus verseuchtem Weideland bekannt.
Die Parasiten durchdringen die Darmwand und wandern im Verlauf von ein bis zwei Monaten über die Peritonelhöhle in die Leber ein. Nach weiteren ein bis zwei Monaten haben sie ihr Ziel, die Gallenwege erreicht.
Krankheitsbilder: Die Infektion mit den Gallengangsparasiten kann inapparent verlaufen oder die sogenannte Fasciolose hervorrufen. Die Erkrankung macht sich ein bis zwei Monate nach Infektion durch Leberschwellung und Bauchschmerzen bemerkbar gepaart mit Fieber und einer eosinophilen Entzündung (Wanderphase). In der chronischen Phase kann es zu verschiedenen hepatocholangitischen Beschwerden kommen. Durch Irrläufer können auch andere Organe befallen werden und Symptome hervorrufen.
Im Nahen Osten verursacht eine Gewohnheit, rohe Schafs- und Ziegenleber zu genießen ein spezielles Krankheitsbild, genannt "Halzoun".
Diagnostik: Nachweis der Eier im Stuhl oder Duodenalsekret, frühestens ein viertel Jahr nach Infektion. Serologischer Antikörpernachweis.
Therapie: Triclabendazol
Fasciolopsis buski (Riesendarmegel)
| Fasciolopsis buski | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Epidemiologie: Fasciolopsis buski ist vor allem in asiatischen Ländern zu finden wie z.B. dem zentralen und südlichen China, Taiwan, Vietnam, Thailand, Indien, Borneo u.a. Regionen Südostasiens. Millionen Menschen sind in diesen Ländern infiziert, vor allem in ländlichen Gebieten.
Lebenszyklus: Fasciolopsis buski kann bis zu 80mm groß werden. Er ist ein gefährlicher Parasit von Tier und Mensch und gilt als Erreger der Fasciolopsiasis. Das Schwein gilt in manchen Gegenden der Welt als natürliches Reservoir für diesen Parasiten. Auch Hunde und Kaninchen können von ihm infiziert werden.

Zwischenwirte
Als Zwischenwirte für den Riesendarmegel treten Lungenschnecken besonders der Arten Segmentina nitidella, Segmentina hemisphaerula und Hippeutis schmackerie sowie der Gattungen Gyraulus, Lymnaea, Planorbis und Indoplanorbis auf . Auch die Gattung Pila (Apfelschnecken) wird von einer Quelle genannt.
Infektion des Menschen
Der Mensch nimmt den Darmegel oral meist als Metacercarien auf, die sich in stehenden Gewässern auf zur menschlichen Ernährung bestimmten Wasserpflanzen oder Sumpfpflanzen befinden. Dazu zählen besonders die Wassernuss, die Wasserkastanie, die Lotuswurzel, der Wasserspinat sowie der Mandschurische Wildreis (Zizania latifolia), dessen verpilzte Stengel auch roh als Gemüse gegessen werden
Krankheitsbild: Nach einer Inkubationszeit von bis zu 3 Monaten kommt es bei einer Fasziolopsiasis zu gastrointestinalen Symptomen wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Obstipation (evtl. mechanischer Ileus) oder Diarrhoe, sowie zu allergischen Reaktionen. Gelegentlich führt diese Erkrankung auch zu Todesfällen.

Diagnostik: Nachweis der Wurmeier im Stuhl.
Therapie: Eine Behandlung ist mit Praziquantel möglich. Alternativ geht Niclosamid.
Prophylaxe:
- Erhitzen von Wasserpflanzen vor dem Verzehr
- Erhitzen von Trinkwasser aus Oberflächengewässern
- Kontrolle der Abwässer von Mensch und Tier
- Kontrolle der Zwischenwirte (Schnecken)
Dicrocoelium dendriticum (Kleiner Leberegel)
| Dicrocoelium dendriticum | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||
|
Der Kleine Leberegel (Dicrocoelium dendriticum) ist ein Parasit, der einen Entwicklungszyklus über zwei Zwischenwirte (Landschnecke und Ameise) zum Endwirt vollzieht.
Epidemiologie: Der Parasit kommt weltweit vor.
Lebenszyklus: Die Wimpernlarven (Miracidien) des kleinen Leberegels schlüpfen aus den Eiern, welche von Landschnecken wie der Zebraschnecke (Zebrina dendrita), der Heid- oder Vielfraßschnecke, die die Eier mit der Nahrung aufgenommen haben, gefressen wurden.
Innerhalb der Schnecke durchbohrt die Larve den Darm, baut ihre Neodermis auf und wird zur Sporocyste. Diese vermehrt sich auf vegetativem Weg zu Tochtersporocysten, welche ihrerseits vegetativ Cerkarien hervorbringen. Diese begeben sich nun in das Atemsystem der Schnecke, wodurch dieses gereizt wird und die Schnecke kleine Schleimbällchen ausscheidet, in denen nun die Cerkarien sitzen.
Diese Schleimbällchen werden von Ameisen (Formica spp. und Lasius spp.) gefressen, welche einen weiteren Zwischenwirt darstellen. Hier entwickelt sich die Zerkarie zur Metacercarie.
Manche der Metacercarien gelangen ins Ganglion und encystieren diese werden als "Gehirnwurm" bezeichnet. Dies bewirkt eine Verhaltensanomalie der Ameise, die nun bei Einbruch der Dämmerung nicht anders kann, als auf einen Grashalm zu klettern und sich dort festzubeissen.
Wenn die Ameise von einem Pflanzenfresser mit dem Grashalm gefressen wird ist der Parasit wieder in seinem Endwirt gelandet.
Krankheitsbild: Menschen können sich selten durch die zufällige Aufnahme von mit Metazerkarien tragenden Ameisen infizieren. Krankheitszeichen der Dicrocoeliose sind Bauch- und Leber- und cholestatische Beschwerden.
Diagnostik: Eier-Nachweis im Stuhl
Therapie: Die Parasiten können mit Praziquantel behandelt werden.
Clonorchis sinensis (Chinesischer Leberegel)
| Clonorchis sinensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Chinesische Leberegel (Clonorchis sinensis) ist ein zur Gruppe der Saugwürmer gehörender Parasit. Endwirte sind fischfressende Säugetiere (Katzen) und der Mensch.
Epidemiologie: Der Parasit ist Ostasien zuhause (China, Taiwan, Hongkong, Vietnam, Japan, Korea). Der Lebenszyklus ist an Süßwasser gebunden. Weltweit sind nach Schätzungen 20 bis 30 Millionen Personen infiziert. Trotz ihrer geringen Bekanntheit gilt die Clonorchiose als weltweit dritthäufigste Wurmerkrankung.
Morphologie und Eigenschaften: Der erwachsene Egel ist abgeflacht, 10 bis 25mm lang und 3 bis 5mm breit. Er besitzt zwei Saugnäpfe (oral und ventral). Clonorchis bedeutet "zweigförmiger Hoden" und beschreibt die durch das transparente Parenchym sichtbare Struktur der inneren Organe. Die Würmer sind Zwitter.

Lebenszyklus: Der Lebenszyklus beginnt mit der Absetzung der Eier im Fäzes des Wirtes. Der erste Zwischenwirt ist eine Wasserschneckenart (Bithynia siamensis), in der das Miracidium (Flimmerlave) nach Aufnahme schlüpft. Innerhalb der Schnecke wandelt sich das Miracidium in eine Sporocyste (Brutschlauch) um, die intern durch Knospung Redien (Stablarven) produziert. Die Redien ihrerseits entwickeln sich -immer noch innerhalb der Schnecke- weiter und setzen durch weitere ungeschlechtliche Fortplanzung Cercarien (Schwanzlarven) frei. Diese entweichen ins Wasser und durchbohren die Haut eines Fisches. In dessen Muskulatur bilden sie Metacercarialcysten. Durch den Verzehr von ungekochtem Fisch kann sich der Mensch infizieren. Die Metacercarien penetrieren den Dünndarm und wandern in die Leber. Dort halten sie sich in den Gallenwegen auf und reifen zum erwachsenen Egel. Nach 3-4 Wochen beginnt der Wurm Eier zu legen, die über die Galle in den Stuhl gelangen.
Erkrankung: Der Mensch infiziert sich mit der Clonorchiose über rohe oder unzureichend gegarte Fische, die von Clonorchis sinensis befallen sind. Symptome sind Fieber, Leber- und Gallenwegsentzündungen mit Hepatomegalie, Oberbauchschmerzen, Diarrhoe und Leukozytose. Die Infektion begünstigt weiterhin die Entstehung von Gallengangskarzinomen.
Diagnostik: Nachweis der Eier im Stuhl oder Duodenalsaft, Serologie.
Therapie: mit Praziquantel, alternativ Albendazol
Literatur und Weblinks:
Opisthorchis felineus (Katzenleberegel)
| Opisthorchis felineus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Katzenleberegel (Opisthorchis felineus) ist ein Parasit, der fischfressende Säugetiere befällt, darunter Katze, Fischotter, Fuchs und auch den Menschen.
Verbreitung: Der Katzenleberegel ist in Russland und Osteuropa (über 2 Millionen Infizierte) vor allem an stehenden und langsam fließenden Gewässern anzutreffen. In manchen Gebieten kommt er endemisch vor mit einer Durchseuchungsrate der Bevölkerung bis zu 80%.
Morphologie: Wie alle Saugwürmer, ist Opisthorchis felineus oval und recht breit und erreicht ein Länge von bis zu 13 Millimeter.

Lebenszyklus: Die Eier müssen nach dem Ausscheiden ins Wasser gelangen und sind dort bereits embryoniert. Sie sinken zu Boden und werden von einer Vorderkiemenschnecke (Bithynia leacti) aufgenommen. In der Schnecke machen sie eine Redien-Entwicklung durch. Danach werden noch unreife Cercarien gebildet, die einige Zeit in der Schnecke verbleiben ehe sie diese verlassen. Im Wasser nehmen sie eine Schwebestellung ein. Der Körper hängt dabei wie ein Pendel am ruhenden Schwanz. In dieser Position schnellen sie auf und ab und locken so Fische (meist Karpfenartige) an. Diese Fische werden nun zum zweiten Zwischenwirt. Dort kapseln sie sich im Bindegewebe der Haut und im Muskelgewebe ein. Wird der Fisch nun vom Endwirt aufgenommen, kann die Metacercarie im Darm frei werden und über den Zwölffingerdarm durch den Ductus cholchedochus in Leber, Gallen- und Pankreasgänge wandern.
Krankheitsbild: Symptome der Opisthorchiose treten oft erst bei Infektion mit mehr als hundert Egeln auf. Die Gallengänge werden verdickt, es kommt zum fibrotischen Umbau im Bereich der Vena portae. Hepatomegalie, Cholangitiden, Gallensteine und Verschlussikterus können auftreten. Die Entstehung von Gallengangskarzinomen wird begünstigt.
Diagnostik: Nachweis der Eier im Stuhl oder Duodenalsaft, serologische Antikörperbestimmung.
Therapie: Praziquantel
Prophylaxe: Die encystierten Metacercarien sind recht widerstandsfähig gegenüber Pökeln, Marinieren oder Trocknen und überleben sogar bei Kühlschranktemperaturen. Daher ist Durchkochen des Fisches unabdingbar in Risikogebieten.
Cestoda (Bandwürmer)
Taenia saginata (Rinderbandwurm)
| Taenia saginata | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||
|
Der Rinderbandwurm Taenia saginata, besser als Rinderfinnenbandwurm bezeichnet, ist ein im Darm des Menschen parasitierender Wurm, der Rinder als Zwischenwirt nutzt.
Verbreitung: Der Rinderbandwurm wurde weltweit mit der Rinderzucht verbreitet, kommt heute allerdings meist in den Ländern südlich der Sahara und jenen des Nahen Ostens vor. Der Mensch stellt den einzigen Endwirt dar. In Europa sind bis zu 1,5% der Rinder befallen. Ungeklärte Abwässer, die in Flüsse gelangen, "wilde Toiletten" in der Nähe von Weideplätzen und die direkte Übertragung der Eier von Mensch zu Rind in Betrieben sind Quellen von Infektionen.
Morphologie und Eigenschaften: Der Körper des Rinderbandwurms trägt alle typischen Merkmale der Bandwürmer, er erreicht eine Länge von bis zu 10 Metern und einer Breite von bis zu 7 Millimetern. Eine Besonderheit des Rinderbandwurmes ist das Fehlen von Hakenkränzen als Haftorgan am Scolex (Kopf), der ansonsten mit vier Saugnäpfen ausgestattet ist.

Lebenszyklus: Der Lebenszyklus des Rinderbandwurmes umfasst wie bei allen Bandwürmern ein Finnenstadium, das hier im Rind zu finden ist. Der menschliche Endwirt scheidet pro Tag bis zu neun vom Bandwurm abgestossene Körpersegmente, sog. Proglottiden aus. Diese verstreuen durch aktive Kriechbewegungen die Eier über weite Strecken. Die Eier werden von Rindern aufgenommen, aus denen im Dünndarm Onkosphären schlüpfen, die die Darmwand penetrieren und über den Blutweg die quergestreifte und Herzmuskulatur erreichen, in der sie sich innerhalb von 3-4 Monaten zu infektionstüchtige Finnen (Cysticercus bovis) entwickeln. Die Finnen verbleiben nun im Rind und werden, falls sie bei einer in den meisten Ländern gesetzlich vorgeschriebenen Fleischbeschau durch den Veterinärmediziner nicht entdeckt werden, vom Menschen aufgenommen. Eine Wurminfektion tritt allerdings nur dann auf, wenn das Fleisch ungenügend gekocht oder roh gegessen wird.
Krankheitsbild:
 |
 |
Die Infektion (Taeniasis) verläuft oft subklinisch, selten treten Kopfschmerzen, leichte Bauchschmerzen, Malabsorptionssyndrom, Gewichtsverlust, Passagestörungen, Hungergefühl oder wechselnder Appetit und Unwohlsein auf. Im Rind selbst rufen die Finnen ebenfalls keine Symptome hervor.
Diagnostik: Stuhluntersuchung auf Proglottiden, ELISA, PCR
Therapie: Niclosamid, alternativ Praziquantel
Prophylaxe: Fleisch sollte ausreichend durchgekocht werden. Lebensmittelkontrolle und Fleischbeschau.
Taenia solium (Schweinebandwurm)
| Taenia solium | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||
|
Der Schweinebandwurm (Taenia solium, syn.: Schweinefinnenbandwurm) ist ein parasitisch im Darm des Menschen lebender Wurm. Als Zwischenwirt dienen Schweine. Experimentell lassen sich auch andere Säugetiere infizieren. Auch der Mensch kann als Fehlzwischenwirt dienen.
Verbreitung: Der Schweinebandwurm wurde wie der Rinderbandwurm weltweit mit dem Menschen als seinem Hauptwirt verbreitet. Der Mensch infiziert sich, indem er Fleisch isst, welches mit den Larven (Finnen) des Bandwurmes belastet ist.
Morphologie und Eigenschaften: Der Körper des Schweinebandwurmes trägt alle typischen Merkmale der Bandwürmer, er erreicht eine Länge von bis zu 4 m und eine Breite von bis zu 7 mm.

Lebenszyklus:
Der Lebenszyklus des Schweinebandwurmes umfasst wie bei allen Bandwürmern ein Finnenstadium, das in diesem Fall im Schwein zu finden ist. Der Hauptwirt scheidet pro Tag bis zu neun Proglottiden aus. Die Eier werden vom Schwein in großen Mengen aufgenommen und siedeln sich vor allem in der Muskulatur (Zwerchfell, Zunge, Herz) an. Die Finnen verbleiben im Schwein und werden durch ungenügendes Kochen des Fleisches auf den Menschen übertragen. Anders als beim Rinderbandwurm kann der Mensch auch als Zwischenwirt dienen, wenn er die Eier aufnimmt.

Krankheitsbild: Die Infektion mit dem adulten Bandwurm verläuft meist symptomlos. Falls der Mensch als Fehlzwischenwirt infiziert wird, siedeln sich die Finnen in verschiedenen Organen an, z.B. in der Unterhaut, im Gehirn und im Auge und verursachen die Zystizerkose.
Diagnostik: Stuhluntersuchung auf Proglottiden, ELISA, PCR
Therapie: Praziquantel, alternativ Niclosamid
Prophylaxe: In Europa sind Schweinebandwürmer vor allem durch die Fleischbeschau eliminiert worden, da die Finnen recht auffällig sind und gehäuft auftreten. Problematische Gebiete sind vor allem Mexiko, wo das Finnenstadium häufig im Menschen angetroffen wird (bis zu 3,6 % der Bevölkerung sind in Mexiko Stadt betroffen). Fleisch sollte durchgekocht werden.
Echinococcus multilocularis (Fuchsbandwurm)
| Echinococcus multilocularis | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) parasitiert vor allem im Rotfuchs, Polarfuchs und Marderhund, seltener im Haushund oder in der Hauskatze. Als Zwischenwirt dienen kleine Säugetiere, wie Rötelmaus oder Feldmaus. Der Fuchsbandwurm ist der Auslöser der alveolären Echinokokkose, einer lebensgefährlichen Wurmerkrankung.
Morphologie und Eigenschaften: Als kleinerer Vertreter der Bandwürmer erreicht der Fuchsbandwurm eine Länge von nur rund drei Millimetern bei einem Durchmesser von rund einem Millimeter. Der Kopf (Scolex) besitzt Saugnäpfe und Haken, um sich an der Darmwand des Wirtes festzusetzen. Diese sind in zwei Reihen zu je 13 bis 18 Häkchen angeordnet, wobei die vorderen größer als die dahinterliegenden sind.
Der Körper von Echinococcus multilocularis ist in drei bis vier segmentähnliche Körperabschnitte (Proglottiden) unterteilt, wobei das letzte stark vergrößert ist und fast die Hälfte der gesamten Länge des Wurmes ausmacht. In den Proglottien liegt jeweils ein Satz von Geschlechtsorganen vor, in denen Spermien und später Eier produziert werden. Etwa in der Mitte der Proglottiden liegt der deutlich erkennbare Genitalporus.
Verbreitung: Die Verbreitungsgebiete erstrecken sich vor allem auf die gemäßigten bis kalt-gemäßigten Klimazonen Mitteleuropas und Nordamerikas. Die Echinokokkose kommt in den meisten Gebieten endemisch vor, breitet sich jedoch zusehends auf ganz Mitteleuropa aus, da immer mehr Rotfüchse in die Städte abwandern und sich der Fuchsbandwurm dort vor allem unter der Nagetierpopulation ausbreiten kann. Die Befallsdichte schwankt erheblich, in manchen Regionen sind bis zu 70% der Füchse befallen (Südwestdeutschland), in anderen nur bis zu 5 %.
Vor allem in Sibirien und Alaska mit den Inseln des Beringmeers sowie in der Schweiz (Schwerpunkt Kanton Thurgau) und in Deutschland im Bereich der Schwäbischen Alb häufen sich die Vorkommen. Zumindest in Europa kommt es aufgrund dieser inselhaften Verbreitung so gut wie gar nicht zu einer Überlappung mit dem Verbreitungsgebiet für den Hundebandwurm (Echinococcus granulosus). Ein Grund für diese Verteilung ist noch nicht bekannt.
Epidemiologie: Die Anzahl der Übertragungen auf den Menschen ist offensichtlich sehr gering. In ganz Europa sind im Zeitraum von 1982 bis 2000 lediglich 559 Fälle der alveolären Echinokokkose bekannt, wobei allerdings berücksichtigt werden muss, dass die tatsächliche Zahl der Fälle aufgrund der erst im Jahre 2000 begonnenen zentralen Erfassung nicht genau angegeben werden kann. Obwohl die Zahl der mit dem Bandwurm infizierten Füchse in Endemiegebieten relativ hoch ist, wurde kein eindeutiger Zusammenhang zwischen einer hohen Population von befallenen Füchsen und erhöhten Infektionsraten beim Menschen festgestellt. Daher wurde selbst in Gebieten, in denen bis zu 60% der Füchse befallen waren, kein größerer Anstieg der an Echinokokkose erkrankten Menschen festgestellt.

Lebenszyklus: Der erwachsene Wurm, der sich im Darm des Endwirtes niedergelassen hat scheidet bis zu 200 Eier (Oncosphären) pro Tag aus. Die Eier sind sehr kältebeständig und können monatelang infektiös bleiben. Das Ei wird zunächst von einem Zwischenwirt (Nager) aufgenommen. Im Magen löst sich die Eikapsel auf und die so genannte Hexacanthenlarve durchdringt die Darmwand und gelangt so in die Blutbahn oder in die Lymphe.
Die Larve setzt sich vor allem im Lebergewebe fest, kann aber auch Lunge, Herz und Milz befallen und bildet eine Hydatide genannte, knospende Larvenstruktur. Sie bildet Ausläufer, die malignomartig in das umliegende Gewebe vorwachsen (multilocularis). Es bildet sich ein großes schwammiges Gewebe (Metacestode), in dessen Wand sich die knospenden Protoscolices bilden, Bandwurmfinnen mit eingestülptem Kopf. Sie wird aus diesem Grunde als Hydatide des alveolären Typs von der Hydatide des cystischen Typs des Hundebandwurms abgegrenzt, bei dem durch eine Knospung in den Innenraum große Hydatidenblasen gebildet werden.
Der Zwischenwirt wird vom Endwirt (Hund, Fuchs, Katze) erbeutet oder als Aas gefressen. Das um die Hydatide liegende Gewebe wird verdaut und die freigewordenen Bandwürmer setzen sich mit ihren Haken im Dünndarm fest und ernähren sich über ihre Außenhaut, die syncytiale Neodermis. Sie besteht aus dem „Nahrungsbrei“, der im Dünndarm vorhanden ist und aus dem der Wurm die Nährstoffe resorbiert. Der Stoffwechsel verläuft über anaerobe Glykolyse. Es können tausende Würmer im Endwirt vorkommen, ohne diesen ernsthaft zu beeinträchtigen. Bei starkem Befall verteilen sich die Tiere gleichmäßig über den gesamten Dünndarm, bei wenigen Tieren bleibt in der Regel das erste Dünndarmdrittel frei.

Krankheitsbild beim Menschen: Fuchsbandwürmer sind selbst bei hohem Aufkommen im Endwirt für diesen kaum schädlich, für den Menschen als (Fehl-)Zwischenwirt hat eine Infektion jedoch meist verheerende Folgen. In den Organen eines infizierten Menschen, vornehmlich in der Leber, aber auch Lunge und Gehirn findet eine Finnenentwicklung statt, die das Krankheitsbild der alveolären Echinokokkose hervorruft. Dabei entsteht ein Netzwerk von Röhren in den befallenen Organen. Sie enthalten die Finnen von Echinococcus multilocularis in Form von Anhäufungen mikroskopisch kleiner, von Bindegewebe umschlossenen Bläschen (Alveolen). Man spricht daher von einer alveolären Echinokokkose im Gegensatz zur zystischen Echinokokkose bei Infektion durch den Hundebandwurm. Das Finnengewebe breitet sich malignomartig aus, wodurch die betroffenen Organe weitgehend zerstört werden. Die Erkrankung wird meist erst zehn bis zwanzig Jahre nach der Infektion bemerkt.
Diagnostik: Eine Abgrenzung gegen Malignome ist mittels Antikörpernachweis im Blut möglich.
Therapie: Durch die unscharfe Abgrenzung zu gesunden Organbereichen ist eine Operation bei fortgeschrittener Erkrankung kaum durchführbar. Ohne komplette Resektion oder die jahrelange Einnahme von Antiheminthika sterben die meisten Patienten an Leberversagen.
Prophylaxe: Die Hauptzahl der Fälle wurde bei Personen beobachtet, die entweder beruflich oder privat mit Landwirtschaft und Waldbau zu tun hatten. In 70% der gemeldeten Fälle sind Hunde- oder Katzenbesitzer betroffen. Es wird daher davon ausgegangen, dass bei den meisten Fällen erst eine Dauerexposition zur Infektion führen kann und keine einmalige Aufnahme der Bandwurmeier.
Früchten und Beeren aus Bodennähe (weniger als 60 bis 80cm über dem Boden) oder Pilzen können möglicherweise Bandwurmeier anhaften. Bei Risikostudien wurde jedoch kein Zusammenhang zwischen dem erhöhten Verzehr von Beeren oder Pilzen und erhöhten Infektionsraten festgestellt. Bisweilen wird immer noch empfohlen, bodennah gesammelte Früchte und Beeren nicht ungewaschen zu essen. Tiefgefrieren der Früchte reicht nicht aus, da die Eier erst bei -80 °C absterben. Die Früchte sollten, wenn die Möglichkeit besteht, gekocht werden. Beim Umgang mit mäusefangenden Haustieren, wie Hunden oder Katzen, ist Hygiene der beste Infektionsschutz für den Menschen. Hiervon geht vermutlich das größte Infektionsrisiko aus, da in 70% der 559 zwischen 1982 und 2000 untersuchten Fälle Katzen oder Hundehalter betroffen waren. Nach der Berührung des Fells mit den Händen, zum Beispiel durch Streicheln, sollten diese nicht ungewaschen zum Mund geführt werden, insbesondere wenn das Fell in der Afterregion berührt wurde. Hunde und Katzen, die in der Nähe von Fuchs-Populationen gehalten werden, sollten regelmäßig entwurmt werden.
Auch vom Kot eines vom Fuchsbandwurm befallenen Tieres geht eine Gefahr aus, da darin befindliche Bandwurmeier einerseits per Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion zunächst vielleicht z.B. auf Haustiere und dann auf den Menschen übertragen werden können. Der trockene Tierkot könnte andererseits unbemerkt eingeatmet werden und damit auch die in ihm befindlichen Bandwurmeier. Diese sind sehr umweltresistent und bleiben in der Natur auch bei extremen Temperaturen bis zu 190 Tage lebensfähig. Lediglich große, trockene Hitze kann den Bandwurmeiern schaden.
Rechtliches: In Deutschland besteht seit 2001 eine Meldepflicht für Echinokokkose. Nicht aber in der Schweiz und Österreich.
Literatur und Weblinks:
- Eckert J. (1996): "Der gefährliche Fuchsbandwurm, (Echinococcus multilocularis) und die alveoläre Echinokkose des Menschen in Mitteleuropa"; Berliner & Münchner Tierärztliche Wochenschrift 109, 202-210
- Eckert, J., Ewald, D., Siegenthaler, M., Brossard, M., Zanoni, R.G. & Kappeler, A., 1995: "Der "Kleine Fuchsbandwurm, (Echinococcus multilocularis) in der Schweiz - Epidemiologische Situation bei Füchsen und Bedeutung für den Menschen." Bulletin des Bundesamtes für Gesundheitswesen 25: 468-476.
- RKI - Echinokokkose
- http://www.eurechinoreg.org/ - Zentrale Meldestelle in Europa
- http://www.echinococcus.de/ - Konsiliarlabor in Deutschland
- http://www.lwf.bayern.de/imperia/md/content/lwf-internet/veroeffentlichungen/lwf-akuell/39/lwf-aktuell_39-14.pdf - Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
- http://www.uni-ulm.de/reisemedizin/
- http://de.groups.yahoo.com/group/Fuchsbandwurm-Selbsthilfeforum/ - Forum
- http://www.lfas.bayern.de/arbeitsmedizin/hinweise_betriebsaerzte/biolog_arbeitsstoffe/echinococcus/Echinokokkose.pdf - Bayerisches Landesamtes für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik (LfAS)
- http://www.uni-ulm.de/echinokokkose/EchiDaten.html - Fallmeldungen in Deutschland
Echinococcus granulosus (Hundebandwurm)
| Echinococcus granulosus | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||
|
Die durch den dreigliedrigen Hundebandwurm (Echinococcus granulosus) verursachte Erkrankung wird als zystische Echinokokkose bezeichnet. Für den Hundebandwurm sind Hund, Wolf und Dingo die definitiven Endwirte. Als Zwischenwirte fungieren besonders Schafe, aber auch Ziegen, Rinder, Schweine und Pferde oder gelegentlich der Mensch. Die Erkrankung ist nach dem Infektionsschutzgesetz in Deutschland meldepflichtig.
Verbreitung: Der weltweit mit verschiedenen regionalen Häufungen verbreitete Hundebandwurm kommt in Europa vor allem in Mittelmeerländern vor, in Deutschland ist er dagegen relativ selten. Die beobachteten importierten Erkrankungsfälle (Ausländer, deutsche Touristen) stammen überwiegend aus den südlichen Ländern des Mittelmeerraumes.
Übertragung: Die Übertragung des Hundebandwurms erfolgt meist per Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion vom Hundekot, dem Fell oder der Schnauze über die danach kontaminierten Hände mit dem Mund. Auch indirekte Ansteckungen sind zu Beispiel durch Nahrungsmittel oder Trinkwasser möglich, die mit Echinococcus-Eiern verunreinigt sind.
Krankheitsbild: Die Dauer der Inkubationszeit ist sehr unterschiedlich. Der Zeitraum kann sich über Monate bis Jahre erstrecken. Grundsätzlich kann jeder – Erwachsene wie Kinder - von der zystischen Echinokokkose betroffen sein, am häufigsten tritt sie aber zwischen dem dritten und dem fünften Lebensjahrzehnt auf.
Beim Hundebandwurm entwickeln sich die Finnen in einer flüssigkeitsgefüllten, ein- oder mehrkammerigen Blase. Der Organismus reagiert auf diesen Fremdkörper, indem eine Schicht aus Bindegewebe um ihn herum bildet, so dass er vor allem im Lebergewebe eine recht feste Bindegewebskapsel (Brutkapseln) entsteht.
Von der innen gelegenen Keimschicht ausgehend bilden sich nach etwa einem halben Jahr viele kleine Bläschen, welche die Vorstufen der fertigen Bandwürmer enthalten, die sich nach dem Schlüpfen frei in der Flüssigkeit bewegen. Diese Hydatiden haben einen Durchmesser von wenigen Millimetern bis zu 30 cm.
Die Erkrankung befällt vor allem Leber (50-70%), Lunge (15-30%) selten auch Milz, Nieren, Gehirn und andere Organe, wobei in aller Regel immer nur ein Organ betroffen ist.
Die Mortalitätsrate dieser Erkrankung liegt in Deutschland bei 2- % und in der Schweiz bei etwa 3 Prozent.
Symptome: Die Infektion mit dem Hundebandwurm verläuft meist lange Zeit asymptomatisch. Die Leberechinokokkose verursacht häufig erst bei einer sehr großer Zyste klinische Symptome durch Kompression von Blutgefäßen oder Gallenwegen. Bei Spannung der Leberkapsel können mehr oder minder starke Bauchschmerzen auftreten. Manchmal kommt es bei ausgedehntem Befall auch zu einem Ikterus.
Bei der Lungenechinokokkose ist ein Platzen (Ruptur) der in der dünnerwandigen Lungenzysten von Schmerzen, Husten und Atembeschwerden begleitet. Bei einem Befall des zentralen Nervensystems verursachen die Echinokokkosezysten in Abhängigkeit ihrer Lage im Hirn oder Rückenmark neurologische Herdsymptome.
Beim Platzen einer Zyste kann es zum allergischen Schock und metastatischen Streuung der Finnen kommen. In seltenen Fällen kann ein solches Ereignis aber auch eine Spontanheilung zur Folge haben.
Komplikationen: Gelegentlich können in der Leber Gewebezerstörungen und unstillbare Blutungen auftreten. Die Kompression der Portalvenen kann zum Aszites führen. Beim Absterben von Parasiten hinterlassen diese in der Regel Zerfallshöhlen, in die anschließend auch Einblutungen stattfinden können.
Diagnostik: Die Erkrankung kann mit bildgebenden Verfahren wie Sonographie, Röntgen und Computertomographie (CT) nachgewiesen und mit serologischen Methoden (IFT, PHA) gesichert werden. Eine serologische Unterscheidung von E. granulosus und E. multilocularis (Fuchsbandwurm) ist mittels ELISA möglich.
Differentialdiagnose: Zur eindeutigen Diagnose sollten andere raumfordernde Rundherde, wie z.B. bei Befall der Leber ein Amöbenabszeß, dysontogenetische Zysten, Tumore oder bakterielle Abszesse ausgeschlossen werden.
Therapie: Für eine sachgerechte und auf den individuellen Patienten zugeschnittene Behandlung der zystischen Echinokokkose bedarf es der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Chirurgen, Radiologen, Gastroenterologen und Mikrobiologen.
Meist wird eine radikale operative Behandlung angestrebt, bei der peinlich darauf geachtet werden muß, die Finne unverletzt und in toto zu entfernen, damit es nicht während und nach der Operation zu einer Streuung bzw. zum anaphylaktischen Schock kommt. Für den Fall, dass der Parasit nicht vollständig entfernt werden kann oder der Patient inoperabel ist, bleibt nur noch die Langzeittherapie mit z.B. Mebendazol und Albendazol. Beim Hundebandwurm ist eine vollständige medikamentöse Abtötung des Erregers möglich.
Gut zugängliche Zysten des Hundebandwurms sollten unter prä- und postoperativer Chemotherapie vorsichtig entfernt werden. Die Leber wird dabei in mit 20%iger Kochsalzlösung getränkte Tücher eingewickelt. Gegebenenfalls kann die Zyste vor der chirurgischen Entfernung zur Sicherheit nach dem PAIR-Verfahren (puncture - aspiration - injection - reaspiration ) entleert und gespült werden.
Prognose: Die Prognose ist besser als bei der alveolären Echinokokkose.
Prophylaxe: Hunde und Katzen sollten regelmäßig entwurmt werden. Besonders angezeigt sind solche Vorbeugungsmaßnahmen, wenn besagte Haustiere auf Reisen in Mittelmeerländer mitgenommen oder solche von dort mitgebracht wurden.
Nematoden (Fadenwürmer)
Enterobius vermicularis (Madenwurm)
| Enterobius vermicularis | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||
|
Der Madenwurm (Enterobius vermicularis syn. Oxyuris vermicularis) ist ein parasitischer Fadenwurm, der weltweit, vor allem aber in den gemäßigten Klimazonen verbreitet ist. Die Art Vermicularis befällt Menschen, seltener Affen (in Tiergärten). 500 Millionen Infektionen sind weltweit pro Jahr zu verzeichnen, und zwar in sämtlichen Ländern und in allen sozialen Gruppen.
Etwa 50% aller Menschen wird mindestens einmal im Leben befallen. Der Wurmbefall selbst wird als Enterobiasis oder Oxyuriasis bezeichnet.
Morphologie und Eigenschaften: Die Würmer sind länglich und weiß. Die Weibchen werden bis zu 13mm lang, während die Männchen nur bis zu 3mm messen. Die Dicke ist unter 1mm. Das Weibchen ist aufgrund seiner Größe und seines spitzen Hinterendes vom Männchen unterscheidbar. Es kommen bis zu 3 Larvenstadien vor.

Lebenszyklus: Die Eier werden peroral aufgenommen. Schon nach 6 Stunden entwickeln sich die ersten Larven. Diese wandern vom Dünndarm (wo sie sich bis zu 3 mal häuten) zum bevorzugten Aufenthaltsort rund um das Zäkum. Die Weibchen wandern nachts Richtung After und legen ihre Eier an den Anusfalten ab (5.000 - 17.000). Über den fäkal-oralen Weg oder Schmierinfektion wird die Infektion weitergegeben. Anders als viele andere Darmparasiten dringt der Madenwurm nicht in den Blutkreislauf oder in extraintestinale Organe ein. Er hat auch keine Zwischenwirte.
Krankheitsbild: Meist kommt es zu einem symptomarmen Wurmbefall. Wenn die Weibchen die Eier ablegen, kann es zu starkem Juckreiz im Analbereich und damit zu Schlafstörungenen kommen. Kratzen aufgrund des Juckreizes kann zu Hautabschürfungen (Exkoreationen) führen; diese können sich (als Superinfektion) sekundär bakteriell infizieren. Ein massiver Befall kann zu Bauchschmerzen und Gewichtsabnahme, Übelkeit oder Symptomen einer chronischen Blinddarmreizung führen. Selten wird bei Mädchen/Frauen der Genitaltrakt befallen (Vulvovaginitis).

Diagnostik: Zur Diagnostik wird mithilfe eines durchsichtigen Klebestreifens ein Abdruck der Analregion gemacht. Die Klebeseite nimmt die abgelegten Eier auf. Unter dem Mikroskop können bei schwacher Vergrößerung die Eier aufgrund ihrer charakteristischen Form erkannt werden: einseitig abgeflacht, oval, mit einer Größe von 25 x 55 µm. Da Madenwurmeier auf der Haut der Perianalregion abgesetzt werden, ist die Untersuchung einer Stuhlprobe nicht sinnvoll!
Therapie: Dem noch mangelhaft ausgebildeten Hygieneverhalten von Kindern entsprechend kann sich ein Madenwurmbefall auf ganze Schulklassen oder Familien ausdehnen. Deshalb ist es auch von entscheidender Bedeutung, zumindest alle Familienmitglieder einer betroffenen Person auch bei Beschwerdefreiheit und fehlendem Wurm(eier)nachweis (am besten mit Mebendazol oder Pyrantelpamoat als gewichtsabhängige Einmalgabe) zu behandeln.
Literatur und Weblinks:
- http://www.aok.de/bund/tools/medicity/diagnose.php?icd=823
- http://www.kiel.de/Aemter_30_bis_52/50/Infektionsschutz_Umwelthygiene/download/Infoblatt_Oxyuriose.pdf - Gesundheitsamt Kiel
Trichuris trichiura (Peitschenwurm)
| Trichuris trichiura | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Verbreitung: Der Peitschenwurm (Trichuris trichiura) ist weltweit verbreitet, jedoch am häufigsten in den Tropen und Subtropen anzutreffen. Es sind rund 750 Millionen Menschen weltweit infiziert.

Morphologie und Eigenschaften: Der Wurm wird bis zu 50mm lang, wobei das fadenförmige Vorderende fast zwei Drittel der Gesamtlänge des Wurmes einnimmt. Daran anschließend ist das Hinterende mit Darm und Geschlechtsorganen, welches ein stark verdicktes Aussehen hat. Dadurch sieht der Wurm peitschenähnlich aus.
Lebenszyklus: Der adulte Wurm setzt sich im Übergangsbereich zwischen Dünn- und Dickdarm fest, wo er vom Inhalt der Darmschleimhautzellen lebt, dessen Wände er auflöst. Die Eier gelangen mit den Fäces ins Freie. Es dauert 3 bis 4 Monate bis sie reif und infektiös sind. Infiziert man sich, so schlüpft im Körper eine Larve die sich im selben Areal wie der adulte Wurm festsetzt und sich mehrmals häutet.

Krankheitsbild: Bei starkem Befall mit über 100 Würmern führt die Trichuriasis zu Diarrhoe, Blutungen und selten zu einem Darmvorfall.
Therapie: mit Mebendazol oder Albendazol.
Prophylaxe: Hygiene. Vermeidung der Kopfdüngung von Gemüsen, wie Salat.
Forschung: Bei bestimmten Autoimmun-Krankheiten werden positive Wirkungen der Eier des Peitschenwurms vermutet. Gegenwärtig laufen Studien mit Einnahme der Eier des Peitschenwurms (Trichuris suis ova) u.a. an der Charité. Bei Entwurmungskuren in Südamerika war nach erfolgreicher Behandlung ein starker Anstieg von allergischen Reaktionen beobachtet worden, woraus eine das Immunsystem dämpfende Eigenschaft der Peitschenwurm-Eier geschlussfolgert wurde, waraus ein Ansatz für klinische Phase II-Studien entwickelt wurde.
Ascaris lumbricoides (Spulwurm)
| Ascaris lumbricoides | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Verbreitung: Die erste Erwähnung des Spulwurms (Ascaris lumbricoides) findet sich im Papyrus Ebers, das um 1540 v.Chr. verfasst wurde. Damit ist er einer der am längsten bekannten Fadenwürmer, die als Parasiten bei Mensch und Tier auftreten. Er ist weltweit verbreitet und an genügend Bodenfeuchtigkeit gebunden. Durch seine sehr widerstandsfähigen Eier, die bis zu vier Jahre infektiös bleiben und auch von den meisten Chemikalien nicht abgetötet werden, kann er sich lange in bestimmten Gebieten halten. Es sind etwa 22% der Weltbevölkerung infiziert.
Morphologie und Eigenschaften: Die bis zu 35cm (Männchen messen bis zu 30cm) großen Würmer haben ein rosafarbenes, regenwurmartiges Aussehen, daher auch der lateinische Name lumbricoides von Lumbricidae (Familie der Regenwürmer). Ihre Mundöffnung ist dreilippig und mit bloßem Auge kann man die Ausscheidungskanäle als weiße Linien wahrnehmen. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen durch ihr meist eingerolltes Schwanzende und durch die herausragenden Spicula.

Lebenszyklus: Die von erwachsenen Weibchen im Darm abgelegten Eier gelangen mit dem Kot in die Umwelt. Dort findet noch im Ei bei ausreichender Feuchtigkeit und Temperaturen von 8 bis 35°C innerhalb von 12 Tagen (unter Laborbedingungen, im Freien wesentlich länger) die Entwicklung über ein Larvenstadium hin zur zweiten Larve statt. Diese wird vom Menschen oder Tier aufgenommen und schlüpft im Dünndarm. Von hier aus bohrt sie sich durch die Darmwand und wandert über den Blutstrom zur Leber, wo sie sich wieder häutet und eine dritte Larve heranwächst. Diese gelangt nun zum Herzen und über den Lungenkreislauf in die Alveolen, dort häutet sie sich abermals und wird zur vierten Larve, welche nun über die Bronchien und Luftröhre zum Kehlkopf wandert. Von dort aus wird sie entweder abgehustet oder geschluckt. Die Dauer dieser Phase beträgt 30 bis 35 Tage. Nun kehrt die Larve wieder zum Dünndarm zurück, wo sie zum erwachsenen Tier auswächst. Die Weibchen legen am Tag bis zu 200.000 Eier. Im Eierstock selbst sind bis zu 27 Millionen Eier angelegt. Die Lebensdauer des Parasiten beträgt bis zu eineinhalb Jahren.
Bei Haustieren besteht daneben die Möglichkeit einer somatischen Wanderung. Die Larven des 2. Stadiums können hierbei aus dem Bereich der Bronchien in den Blutkreislauf übertreten oder direkt die Pleurahöhle besiedeln. Die hämatogen verschleppten Larven können sämtliche Organe des befallenen Tieres befallen, werden dort eingekapselt und bleiben über mehrere Jahre infektiös. Bei einer eventuell auftretenden Trächtigkeit des Tieres bilden diese Larvenstadien die Hauptquelle für die noch im Uterus erfolgende Infektion des Fötus.
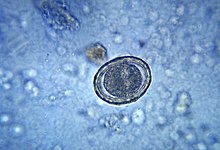
Krankheitsbild: Die Larven erzeugen gelegentlich allergische Reaktionen. Bei der Lungendurchwanderung kommt es zur Ascaris-Pneumonie mit Husten, Fieber, starker Verschleimung und asthmaähnlichen Anfällen. Im Gastrointestinaltrakt rufen sie Koliken und Erbrechen hervor, wobei die adulten Würmer die Bauchspeicheldrüsengänge, den Darm oder die Gallengänge obliterieren können. Teilweise kommt es zur Maldigestion, speziell der Laktose. Bei Sensibilisierung kommt es zu heftigen allergischen Reaktionen.
Diagnostik: Die Diagnose des Spulwurmbefalls erfolgt am effektivsten durch eine Stuhluntersuchung mittels des Flotationsverfahrens. Hierbei werden die dickschaligen, 70 bis 80µm großen Eier nachgewiesen. Weiterhin ist der serologische Nachweis einer larvalen Spulwurminfektion mittels ELISA möglich.
Therapie: Entwurmung mit Mebendazol. Alterrnativen sind Pyrantel oder Albendazol.
Prophylaxe: Eine sehr effektive Maßnahme besteht im konsequenten Händewaschen vor jeder Nahrungsaufnahme. Der Verzehr kopfgedüngter Gemüse sollte vermieden, Fäkalien unter hygienischen Gesichtspunkten beseitigt werden. In der Familie gehaltene Kleintiere bedürfen einer regelmäßigen (vierteljährliche) Entwurmung.
Trichinella spp.
| Trichinella spp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trichinen (Trichinella) sind eine Gattung der Fadenwürmer (Stamm Nematoda) mit parasitischer Lebensweise. Säugetiere, Vögel und Menschen dienen als Zwischen- und Endwirt. Hauptüberträger für den Menschen sind Hausschweine bzw. deren rohes Fleisch (Mett). Bei Befall spricht man von Trichinose, wobei der Mensch ein Fehlwirt darstellt. Durch Trichinen verursachte Erkrankungen beim Menschen sind meldepflichtig.
Verbreitung: Die Trichine ist durch mehrere Arten weltweit verbreitet. Vor Einführung des "Reichsfleischbeschaugesetzes" unter der Federführung von Rudolf Virchow um 1900 gab es in Deutschland nach Schätzungen etwa 15.000 Erkrankungen jährlich. Durch die Fleischbeschau sank diese Zahl in 50 Jahren auf nahezu Null. Zuletzt im Dezember 1998 wurden rund 50 Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen beschrieben, die sich auf den Verzehr von rohen Schweinefleischwaren zurückführen ließen.
In den westlichen Ländern tritt die Trichine vorwiegend im "silvatischen Zyklus" auf, bei dem Füchse und Nager die Würmer verbreiten. In nördlicheren Gebieten kann dies durch Bären, Schlittenhunde und Robben geschehen. Ein "urbaner Zyklus" ist ebenfalls vorhanden, dieser geschieht vor allem über Ratten und Schweine. Zu menschlichen Infektionen kommt es vor allem in Ländern ohne Fleischbeschau. Vereinzelte Infektionen in Deutschland werden durch individuell gezogene Schweine verursacht, die keiner Fleischbeschau unterzogen werden. Allerdings ist es im Frühjahr 2006 auch nach dem Verzehr von Schweinen aus nicht individueller Haltung im Kreis Uecker-Randow zu einer Erkrankung von 2 Personen trotz der von der EU vorgeschriebenen, modernen Fleischbeschaumethode (Verdauungsmethode) gekommen. Zur Infektion kann es außerdem durch den Genuss von nicht ausreichend erhitztem Perlfleisch kommen.
Morphologie und Eigenschaften: Die adulten Tiere erreichen eine Länge von 1,5mm, deutlich kann man das verdickte Hinterende erkennen, das den Darm beherbergt. Die Larven kapseln sich im Muskelgewebe ein und bilden dort einen "Ammenzellnährkomplex", eine Kapsel, die reichlich mit Blutgefäßen versorgt wird und dadurch die Larve am Leben erhält. Sie erreicht eine Größe von rund 1mm und ist dann infektiös.
Lebenszyklus von Trichinella spiralis: Bei Trichinen dient zunächst jeder Wirt als Zwischenwirt, da die Larven zuerst im Darm zu Würmern heranreifen. Mit dem infizierten Fleisch werden die eingekapselten Larven aufgenommen, die Kapseln im Dünndarm aufgelöst und die Larven somit freigesetzt. Die Würmer bohren sich in das Dünndarmepithel ein und entwickeln sich innerhalb von 30 Stunden zum adulten Tier, danach findet eine Paarung statt. Dort angesiedelt bringen die Weibchen lebendgebärend bis zu 1.500 Larven zur Welt. Die Larven bohren sich nun durch den Dünndarm und erreichen so die Lymphe oder den Blutstrom. Sie treiben durch den Kreislauf und lassen sich vor allem im quergestreiften Muskelgewebe nieder. Bevorzugt werden hierbei Zwerchfell, Augen, Zunge und Extremitäten besiedelt. Nun beginnt die Bildung des erwähnten Ammenzellnährkomplexes. Diese Kapsel bleibt infektiös, solange der Parasit lebt. Ab dem fünften Monat findet im menschlichen Gewebe jedoch eine Verkalkung statt, die zum Absterben der Ammenzelle und der Larve führt.



Krankheitsbild: Die von Trichinen beim Menschen hervorgerufene, meldepflichtige Erkrankung wird als Trichinellose bezeichnet. Bei einer Inkubationszeit von 8 bis 15 Tagen entwickeln sich aus den zunächst im Dünndarm befindlichen Larven adulte Würmer, die sich später im Muskelgewebe einnisten und sich dort verkapseln. Dabei treten neben oft asymptomatischen Krankheitsverläufen auch allgemeine Schwäche, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auf, nach 1 bis 3 Wochen dann Fieber, Muskelschmerzen und Ödeme im Augenbereich. Diese Symptome halten meist bis zu einem Jahr an und verschwinden danach ohne bleibende Folgen. Wenn als Komplikation der Herzmuskel befallen wird, kann diese Wurminfektion sogar tödlich enden.
Prophylaxe: Wichtigste vorbeugende Maßnahme ist die gesetzlich vorgeschriebene Trichinenschau, bei der die Kapseln der Larven gezielt erkannt werden. Man kann eine Abtötung der Larven mit Kochen erreichen, dabei muss das Fleisch mindestens 65°C erreichen, des Weiteren gilt das Gefrieren als Abtötungsmaßnahme. Jedoch kann die im hohen Norden verbreitete Art T. nativa selbst tiefen Temperaturen lange widerstehen. Räuchern, Pökeln, Salzen und Trocknen sind laut Angaben des Robert-Koch-Instituts keine ausreichend wirksamen Maßnahmen zur Larvenabtötung. Vorsicht ist bei Import von Fleisch aus dem Nicht-EU-Ausland geboten, da in manchen Ländern bei Wild, Haus- und Einzelschlachtungen keine obligatorische Fleischbeschau stattfindet. Gegebenenfalls ist eine Beschau durch das Veterinäramt bei der jeweiligen Verwaltungsbehörde nachzuholen und auch zu empfehlen.
In letzter Zeit sind bei Wildschweinen jedoch eine weitere Form von Trichinen (Trichinella pseudospiralis) aufgetaucht. Diese ist durch herkömmliche Vorbeugemaßnahmen nicht zu erkennen. Sie sind im Gegensatz zu den gewöhnlichen Trichinen im Larvenstadium nicht eingekapselt und deshalb bei der Fleischbeschau, die sich auf das Aufspüren eben dieser Kapseln stützt, nicht zu erkennen.[11]
Historie: Der Verursacher der Trichinose ist seit 1835 bekannt, doch blieb der Übertragungsweg unklar. Erst 1846 wies der bedeutende amerikanische Wissenschaftler Joseph Leidy, der sowohl als der Begründer der amerikanischen Parasitologie wie auch der amerikanischen Wirbeltierpaläontolgie gilt, zweifelsfrei nach, dass der Parasit über den Verzehr von nicht ausreichend gegartem Fleisch aufgenommen wird. Doch erst zwei Jahrzehnte später wurde seine Erkenntnisse von der Forschung allgemein akzeptiert.
Literatur und Weblinks:
Filarien
| Filarioidea | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||
|
In der Überfamilie Filarioidea, zu deutsch Filarien (lat. filum, "Faden") sind Fadenwürmer der Familien Filariidae und Onchocercidae zusammengenommen. Diese kommen in tropischen Regionen vor. Einige Spezies sind als Erreger von Parasitosen beim Menschen oder bei Haustieren bedeutsam.
Morphologie und Eigenschaften: Filarien sind fadenförmige Würmer, deren Körperlänge je nach Art zwischen 2 und 50cm schwankt. Die Larvenstadien, die als Mikrofilarien bezeichnet werden, sind kleiner als ein Millimeter.

Lebenszyklus: Die Entwicklung der Mikrofilarien zur infektiösen Larve geschieht über zwei Häutungen im Zwischenwirt, einer jeweils spezifischen, blutsaugenden Mücken- oder Bremsenart. Nach der Übertragung auf den Endwirt (u.a. Mensch) wandern diese zur endgültigen Lokalisation und werden nach zwei weiteren Häutungen zur sog. Adultfilarie. Die Mikrofilarien werden von den Weibchen lebend geboren oder als embryonierte Eier abgesetzt. Sie erscheinen in der Haut oder im Blut, von wo sie wiederum bei der nächsten Blutmahlzeit zum Zwischenwirt übertragen werden.
Humanpathogene Filarien:
- Brugia malayi - Überträger: Stechmücken (Culiciden)
- Loa loa - Überträger: Bremsen (Tabanidae)
- Mansonella spp.
- Onchocerca volvulus - Überträger: Gnitzen (Culicoides parensis)
- Wuchereria bancrofti - Überträger: Stechmücken (Culiciden)
Therapie: Die Behandlung erfolgt mit Diethylcarbamazin, alternativ mit Ivermectin oder Albendazol.
Brugia malayi

Brugia malayi ist ein tropischer Fadenwurm aus der Gruppe der Filarien (Familie Filariidae). Er parasitiert beim Menschen und kann das Krankheitsbild der Elephantiasis verursachen. Etwa 6 Millionen Menschen gelten als infiziert.

Verbreitung: Brugia malayi kommt in Ost- und Südasien vor. Reservoir sind neben dem Mensch auch Katzen, Hunde und Affen.
Morphologie und Eigenschaften: Die erwachsenen Würmer sind fadenförmig und werden 2,5cm (m) bzw. 6cm (w) lang.
Lebenzyklus Die Übertragung erfolgt durch Mücken der Arten Aedes, Culex, Anopheles und Mansonia. Die Entwicklung infektiöser Larven in den Mücken erfordert hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Nach Infektion siedeln sich die Filarien in Lymphbahnen an. Die Adultwürmer setzen nach etwa 3 Monaten Mikrofilarien ab. Dies geschieht in den Nachtstunden, zwischen 22 und 2 Uhr sind die Mikrofilarien im Blut nachweisbar. Über Aufnahme der Mikrofilarien durch einen erneuten Mückenstich schließt sich der Kreis. Die erwachsenen Würmer können einige Jahre leben.
Krankheitsbild: Elephantiasis
Loa loa


Loa loa (Familie Onchocercidae), auch als Wanderfilarie oder Augenwurm bekannt, ist ein tropischer Fadenwurm, der beim Menschen im Unterhautfettgewebe, gelegentlich auch im Auge parasitiert und das Krankheitsbild Loiasis hervorruft.
Verbreitung: Das Vorkommen ist auf West- und Zentralafrika beschränkt, vor allem auf die beiden Kongos, Gabun, Tschad, den Sudan, die Zentralafrikanische Republik, Kamerun, Nigeria und Nord-Angola.
Morphologie: Das Weibchen wird etwa 50 bis 70mm, das Männchen 30mm lang.
Lebenszyklus: Zwischenwirte sind Bremsen der Arten Chrysops dimitiata und Chrysops silacea. Beim Stich (nur die weiblichen Bremsen saugen Blut) gelangen die Filarien in die Haut. Die Entwicklung zum ausgewachsenen Wurm dauert mehrere Jahre.
Krankheitsbild: Loa loa ruft die Loiasis (auch Loaose, Kamerunbeule oder Calabar-Schwellung) hervor. Die Übertragung erfolgt durch Bremsen. Lange nach der ursprünglichen Infektion, oft Jahre später, kommt es zu allergisch verursachten Schwellungen der Haut, die einen Durchmesser von 10cm erreichen können und starken Juckreiz entwickeln. Nach einigen Tagen klingt die Schwellung ab und tritt typischerweise an anderer Stelle wieder auf. Das rührt daher, dass der Wurm in der Haut nicht eingekapselt wird, sondern umherwandert (daher auch Wanderfilarie). In eher seltenen Fällen kriecht er auch unter der Bindehaut über den Augapfel und wird dann sichtbar. Die Erkrankung ist in der Regel nicht gefährlich, aber sehr unangenehm und kann wegen der langen Lebensdauer der Würmer von bis über zehn Jahren ein chronisches Problem darstellen. Spätkomplikationen können Herzklappen- und Nierenschäden sowie Meningitiden sein.
Therapie: Die medikamentöse Behandlung erfolgt mit Diethylcarbamazin.
Wuchereria bancrofti


Wuchereria bancrofti ist ein Vertreter der Fadenwürmer, der parasitisch in den Lymphgefäßen des Menschen lebt. Seinen Namen erhielt das Tier von dem portugiesisch-brasilianischen Arzt Otto Wucherer.
Verbreitung: Wuchereria bancrofti ist hauptsächlich in China, Amerika, Asien, Afrika und im Pazifik verbreitet. Die Filarien kommen dort in den tropischen Regionen vor.
Morphologie: Das Weibchen erreicht eine Länge von bis zu 10cm bei einer Dicke von nur bis zu 0,3 Millimeter.
Lebenszyklus: Übertragen werden die Würmer durch Mücken, vor allem die Stechmücken der Gattungen Culex, Anopheles und Aedes. Die Larven werden in die Stichwunde der Tiere eingespritzt oder wandern aktiv in die Wunde und werden dann meist passiv in die Kapillaren der Lymphgefäße gespült. Die ausgewachsenen Würmer können mehrere Jahre im Lymphsystem leben und produzieren in dieser Zeit Unmengen neuer Wurmlarven.
Krankheitsbild: Filariosen, bekannt als Elephantiasis tropica. Dabei handelt es sich um Schwellungen, die durch Lymphgefäßobstruktion in peripheren Lymphgefäßen entstehen, hervorgerufen durch sich entwickelnde Larven in den Gefäßen. Sichtbares Zeichen dieser Krankheit sind extreme Wucherungen des Bindegewebes in den Armen und Beinen, an den Genitalien und den Brüsten. Akute Symptome treten erst bis zu 16 Monate nach der Infektion auf, diese dauern jedoch Tage bis Wochen lang an.
Mansonella spp.
 |
 |
 |
Onchocerca volvulus
 |
Arthropoden
Insekten
Pediculidae (Läuse)
| Pediculidae | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||||||||||
|
Die Menschenläuse (Pediculidae) sind eine Familie innerhalb der Tierläuse (Phthiraptera). Sie enthält sechs Arten, von denen sich zwei speziell an den Menschen angepasst haben, die Filzlaus (Phtirus pubis) und als zwei Unterarten die Kleiderlaus (Pediculus humanus humanus), auch Körperlaus (Pediculus humanus corporis) genannt, und die am häufigsten vorkommende Kopflaus (Pediculus humanus capitis). Andere verwandte Arten parasitieren auf Gorillas und Schimpansen.
Bei den Läusen ist es noch nicht endgültig geklärt, ob es sich bei der Kleiderlaus bzw. Körperlaus und der Kopflaus um zwei Unterarten handelt oder um zwei verschiedene Arten. Für zwei verschiedene Arten spricht, dass z.B. beide Läuse einen anderen Lebensraum bevölkern. Gegen zwei verschiedene Arten spricht, dass sie untereinander kreuzbar sind.
Die Menschenläuse sind wie alle Tierläuse blutsaugende Parasiten. Ihre Stiche erfolgen mit dem langen Stechrüssel und erzeugen juckende Quaddeln. Die Entwicklungszeit vom Ei bis zur Geschlechtsreife dauert bei den Tieren etwa 25 Tage, die Adulten leben etwa 30 Tage.
Literatur und Weblinks:
- http://www.uni-ulm.de/klinik/imi/mikrobio/hygiene/Inhalt4_17.html
- http://parasitology.informatik.uni-wuerzburg.de/login/n/h/0768.html
Phthirus pubis (Filzlaus)
| Pediculidae | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Die am Menschen parasitierende Filz- oder Schamlaus (Phthirus pubis) wird etwa 1-1,5mm lang und ist von kurzer, aber breiter Gestalt mit einem grauen Körper, der sechs bis acht paarige, zapfenartige Auswüchse trägt. An den Enden ihrer sechs Beine befinden sich kräftige Halteklauen, mit denen sie sich an Haaren festhält. Der Stich verursacht einen starken Juckreiz und eine blaue Verfärbung der betroffenen Hautpartie.
Filzläuse kommen vor allem in der Schambehaarung vor, seltener in den Achsel- und Barthaaren und nur extrem selten in den Kopfhaaren, Augenbrauen oder Augenwimpern. Die Filzlaus ist extrem stark auf den Menschen spezialisiert und stirbt nach höchstens 24 Stunden, wenn sie vom Körper entfernt wird.
Therapie: Die Therapie besteht darin, die Scham- und Achselbehaarung, aber auch das Barthaar wegzurasieren. Allerdings können auch die Augenbrauen und die Randzonen des Kopfhaars befallen sein, so dass sich auch ein Haarschnitt und eine penible Untersuchung der gesamten Behaarung empfehlen. Außerdem sollte die Kleidung gewaschen und heiß getrocknet werden.
Lindan - beispielsweise Jacutin - und Pyrethrumpräparate werden in der medikamentösen Behandlung eines Filzlausbefalls eingesetzt. Kontaktpersonen müssen mitbehandelt werden.
Die Filzlaus als Krankheitsüberträger: Anders als Kopf- und Kleiderlaus spielt die Filzlaus aber als Überträger von gefährlichen Krankheitserregern in unseren Breiten keine Rolle.
Pediculus humanus humanus (Kleiderlaus)
Die Kleiderlaus (Pediculus humanus humanus) auch Körperlaus (Pediculus humanus corporis) genannt, ist eine Unterart der Menschenläuse (Pediculus humanus) und gehört entsprechend zu den Läusen oder Tierläusen. Die andere Unterart ist die Kopflaus (Pediculus humanus capitus). Die Kleiderlaus ist etwa 4mm groß und weißlich bis braun gefärbt.
| Pediculus humanus humanus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Die Kleiderlaus wohnt bevorzugt zwischen den Haaren oder in der Bekleidung. Sie ist gut an den Menschen angepasst und fühlt sich bei menschlicher Körpertemperaturam wohlsten. Die Stiche lösen eine meist kleine, juckende Schwellung aus. Das Weibchen kann bis zu 40 Tage alt werden, wobei es pro Tag etwa 10 Eier legt. Die Entwicklung bis zum erwachsenen Tier dauert im günstigsten Fall 2 Wochen. Kleiderläuse sind sehr zäh und können bei 25°C bis zu 4 Tage ohne Blutmahlzeit überleben. Übertragen wird die Laus durch Körperkontakt oder gemeinsam genutztes Bettzeug und Bekleidung.
Die Kleiderlaus als Krankheitsüberträger: Unter schlechten hygienischen Bedingungen kann die Kleiderlaus an jedem Ort, besonders aber in den Tropen das Fleckfieber (Rickettsia prowazekii), Rückfallfieber (u.a. Borrellia recurrentis), Tularämie (Francisella tularensis) und das Wolhynische Fieber (Bartonella quintana) auf den Menschen übertragen. Die Übertragung erfolgt nicht durch den Stich selbst sondern durch Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion mit den Exkrementen der Laus oder durch zerdrückte Tiere, besonders wenn sie in die Bißwunde oder andere Hautwunden gelangen.
In früheren Zeiten kam es zu regelrechten Epidemien dieser Krankheiten, vor allem in Gegenden mit mangelnder Hygiene und starken Läusebefall, heute sind sie vor allem in den kühleren Gebieten Afrikas, Südamerikas und Asiens verbreitet. Kennzeichnend für diese Krankheiten sind vor allem starke Fieberschübe.
Ein Kleiderlausbefall ist in Deutschland nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig.
Pediculus humanus capitis (Kopflaus)
| Pediculus humanus capitis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Die Kopflaus (Pediculus humanus capitis) hat im Gegensatz zu den anderen Tierläusen pigmentierte Augen, einen relativ kurzen Rüssel und fünfgliedrige Antennen. Die Beine sind sehr gut für das Klammern und Fortbewegen an Haaren geeignet. Der sehr druckfeste Körper widersteht einer Belastung von bis zu einem Kilo und ist etwa 2 bis 3,5mm lang. Ihr Erscheinungsbild ist gräulich, wenn sie gerade Blut gesaugt hat eher bräunlich bis rötlich. Die optimalen Lebensbedingungen hat die Laus bei etwa 28°C, ab Temperaturen von 22°C verlangsamt sich ihre Entwicklung und bei 10°C kommt sie fast zum Stillstand.
Vorkommen: Die Kopflaus ist ein Parasit, der im Normalfall nur in der menschlichen Kopfbehaarung lebt, besonders in der Nacken-, Ohren- und Schläfengegend. Vereinzelt kommt die Laus auch in den Augenbrauen und Barthaaren vor. Die Körperhygiene spielt dabei keine Rolle. Läuse und deren Larven bewegen sich recht flink in den Haaren und sind nur schwer zu entdecken. Meist sieht man eher die Nissen. Erst ein Kamm mit sehr eng angeordneten Zinken (ein so genannter Nissenkamm) macht auch die Läuse sichtbar. Da sich die Laus bei Temperaturen von etwa 28°C am wohlsten fühlt, verlässt sie nur ungern die oben genannten Bereiche des Kopfes.
Ernährung: Die Kopflaus ernährt sich ausschließlich vom menschlichen Blut. Kann sie keine Nahrung finden, so trocknet sie in Abhängigkeit von der jeweiligen Temperatur entweder nach einem Tag oder nach maximal 55 Stunden aus. Das Blutsaugen findet in der Regel alle 2 bis 3 Stunden statt, wobei die Kopflaus etwas Speichel in der Haut hinterlässt. Dieser führt zu Juckreiz, so dass es zu sekundären Entzündungen kommen kann. Eitrige Hautausschläge und in schweren Fällen eine Lymphknotenschwellung sind möglich.
Lebenszyklus: Nach der Blutmahlzeit legt die geschlechtsreife weibliche Laus täglich etwa 4 Eier (insgesamt etwa 100 Stück), sogenannte Nissen, die am Haar in der Nähe der Haarwurzel befestigt werden. Sie kann aber auch nach bis zu fünf Tagen ohne Blutmahlzeit noch voll entwicklungsfähige Eier legen. Diese sind etwa 0,8 mm lang, oval und gräulich. Bei einer Temperatur von weniger als 12°C findet keine Eiablage mehr statt. Erst sind einzelne Nissen vorhanden, bei starkem Befall werden diese wie Perlen an einer Schnur an den Haaren aufgereiht. Nach etwa 8 Tagen schlüpft dann die Larve, die sich dreimal häutet und nach weiteren 10 bis 12 Tagen dann geschlechtsreif ist. So kann etwa alle 3 Wochen eine neue Generation entstehen, was zu einer sehr schnellen Vermehrung führt.
Die Weibchen werden etwa 30 bis 35 Tage alt, in dieser Zeit können sie etwa 100 Nissen legen. Die Männchen leben etwa 15 Tage.
Übertragung: Das Auftreten von Läusen ist kein Zeichen mangelnder Hygiene, allerdings werden sie in beengten Lebensverhältnissen rascher übertragen. Die Übertragung geschieht (anders als bei der Kleiderlaus) vorwiegend durch direkten Körperkontakt. Besonders in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten können sich Kopfläuse rasch ausbreiten. In Bürsten, Kämmen, Hüten oder Kissen können sie rund einen Tag überleben und sich auch auf diesem Wege weiterverbreiten.
Bekämpfung: Der Nissenkamm ist das wichtigste Mittel zur mechanischen Läuseentfernung. Die Behandlung sollte mindestens acht Tage lang durchgeführt werden. Nach einer einwöchigen Pause ist eine Wiederholung des Behandlungszyklus grundsätzlich anzuraten. Dies gilt auch für Insektizide (Pyrethrum, Permethrin, Malathion, g-Hexachlorcyclohexan (=Lindan). Kontaktpersonen müssen mitbehandelt werden. Kissen, Bettdecken, Kuscheltiere, Kleidungsstücke sollten für ein paar Tage in die Gefriertruhe gepackt werden, um die Läuse abzutöten.
Rechtliches: Kopflausbefall ist in Deutschland nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) für den behandelnden Arzt keine meldepflichtige Erkrankung. Jedoch sind Eltern nach §34 Abs. 5 dieses Gesetzes verpflichtet, die von ihrem Kind besuchte Gemeinschaftseinrichtung (Kindergarten, Schule, etc.) über einen Befall mit Kopfläusen und über eine erfolgte Behandlung zu unterrichten. Beim erstmaligen Befall ist kein ärztliches Attest erforderlich, allerdings ist ein Besuch des Hausarztes anzuraten, der dann gegebenenfalls spezielle Shampoos zur Bekämpfung verschreiben kann und bei wiederholtem Befall innerhalb von 4 Wochen ein Attest zur Bescheinigung des Behandlungserfolges und damit zur Wiederzulassung zu einer Gemeinschaftseinrichtung auszustellen hat.
Die Kopflaus als Krankheitsüberträger: Unter schlechten hygienischen Bedingungen kann die Kopflaus an jedem Ort, besonders aber in den Tropen, das Fleckfieber (Rickettsia prowazecki) auf den Menschen übertragen. Die Übertragung erfolgt durch Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion mit den Exkrementen der Laus oder durch zerdrückte Tiere, besonders wenn sie in die Bisswunde oder andere Hautwunden gelangen. Weiterhin können regional unterschiedlich noch folgende Krankheiten übertragen werden: Wolhynisches Fieber, auch Fünftagefieber genannt (Bartonella quintana), Läuse-Rückfallfieber (Borrellia recurrentis), "Scrub Typhus" (Rickettsia tsutsagamushi) und Tularämie (Francisella tularensis).
Literatur und Weblinks:
Siphonaptera (Flöhe)
| Siphonaptera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||
|
Flöhe bilden die Ordnung Siphonaptera in der Klasse der Insekten und gehören dort zu den holometabolen Insekten. Von den etwa 2.400 Floh-Arten sind etwa 70 in Mitteleuropa nachgewiesen. Die Tiere erreichen eine Größe von 1,5 bis 4,5mm, die größte Art ist der Maulwurfsfloh (Hystrichopsylla talpae), der auf dem Europäischen Maulwurf (Talpa europaea) parasitiert.
Morphologie und Eigenschaften: Flöhe besitzen keine Flügel, haben dafür aber zur schnellen Fortbewegung kräftige Hinterbeine, die ihnen große Sprünge bis zu 1m erlauben. Die Schnellbewegung der Sprungbeine gilt als eine der schnellsten Bewegungen im gesamten Tierreich. Um dies zu erreichen, wurden die ehemaligen Flugmuskeln zu ergänzenden Sprungmuskeln umgebildet. Charakteristisch für Flöhe ist ihr seitlich abgeplatteter Körper, der es ihnen erleichtert, sich im Fell zwischen den Haaren fortzubewegen. Facettenaugen besitzen Flöhe nicht, stattdessen besitzen sie ein Paar einlinsige Punktaugen. Die Mundwerkzeuge sind zu einem kombinierten Stech- und Saugrüssel umfunktioniert.
Flöhe besitzen einen sehr harten Chitinpanzer, der es sehr schwer macht, sie zu zerdrücken. Ein Zerreiben ist hingegen eher möglich. Am Körper und an den Beinen haben sie nach hinten gerichtete Borsten und Zahnkämme (Ctenidien), die es, zusammen mit den Krallen an den Beinen, schwer machen, Flöhe aus den Haaren zu kämmen.
Lebensweise: Flöhe sind Parasiten, die auf warmblütigen Tieren leben, wobei 94% aller Arten auf Säugetieren parasitieren und etwa 6 Prozent auf Vögeln. Flöhe haben zwar Vorlieben für bestimmte Wirtstiere, sind aber nicht ausschließlich auf diese angewiesen. Daher kann der Mensch auch von anderen Floharten als dem Menschenfloh (Pulex irritans) befallen werden und deshalb sollten Haustierbesitzer auch darauf achten, dass ihre Tiere frei von Flöhen sind. Flöhe werden durch das Kohlendioxid der Atemluft, Wärme und Bewegung von Tieren angelockt. Nach einer üppigen Mahlzeit kommen Flöhe bis zu zwei Monate ohne Nahrung aus.
Ein Floh kann maximal 1½ Jahre alt werden. Die Lebensdauer des ausgewachsenen Rattenflohs beträgt 5 bis 6 Wochen. Das Larvenstadium dauert je nach Temperatur 8 Tage (warme Zimmertemperatur) bis zu einem Jahr.
Nach ihrem Verhalten werden die Flöhe in zwei Gruppen eingeteilt: Nestflöhe und Pelzflöhe. Die Nestflöhe bleiben stationär in der Nähe des Schlafplatzes ihres Wirtes in dunkler und trockener Umgebung. Sie kommen des Nachts aus ihrem Versteck, befallen den Wirt und verschwinden wieder im Versteck, wo sie ihre Eier legen. Sie sind extrem lichtscheu und lieben keine Ortsveränderung. Deshalb sind sie nur ganz ausnahmsweise in der Kleidung während deren Gebrauch zu finden. Kennzeichnend ist, dass der Wirt wahllos über den ganzen Körper von Bissen befallen ist. Bekanntester Vertreter ist der Menschenfloh, der sich tagsüber in den dunklen Stellen des Bettes aufhält. Pelzflöhe (z.B. der Rattenfloh) hingegen bleiben auf ihrem Wirt sitzen und wandern mit ihm mit. Sie vertragen Licht, springen auch Menschen an und setzen sich in deren Kleidung fest. Menschenblut nehmen sie nur ausnahmsweise, wenn keine Ratten mehr zur Verfügung stehen.

Die Flöhe ernähren sich von Getreide- und Mehlstaub. Das Blut wird nur zur Eireifung benötigt.
Fortpflanzung: Die Fortpflanzung setzt einen bestimmten Temperaturbereich voraus. Fällt die Temperatur auf 5°C und darunter, wird die Fortpflanzung eingestellt, bereits unter 10°C nimmt sie signifikant ab. Die Männchen besitzen spezielle Klammerorgane, die sie bei der Kopulation einsetzen. Das Weibchen legt die relativ großen Eier in Eipaketen zu etwa 10 Stück ab und muss zwischendrin neue Nahrung zu sich nehmen. Während ihres Lebens kann sie etwa 400 Eier legen. Die Larven besitzen weder Beine noch Augen und sind mit Borsten bedeckt. Die Entwicklung verläuft im Nest des Wirtes und dauert etwa zwei bis vier Wochen. Dabei ernähren sich die Larven von den Ausscheidungen der adulten Tiere. Da es sich hierbei um eingetrocknetes Blut handelt, lässt sich anhand dieses Flohkotes ein Befall effektiv nachweisen. Hierzu werden die mittels eines Flohkammes ausgekämmten Bestandteile auf eine weiße saugfähige Unterlage (Zellstoff, Kissenbezug oder Ähnliches) gegeben und leicht befeuchtet. Durch seinen Blutgehalt wischt die Ausscheidung des Parasiten rötlich aus.
Krankheitsbilder: Der Menschenfloh (Pulex irritans) kann in seltenen Fällen durch seinen Biss die Pest auf mechanischem Wege übertragen. Speziell der Rattenfloh (Xenopsylla cheopis) ist als Überträger der Pest bekannt. Hunde- und Katzenflöhe bleiben in der Regel auf ihren Wirten, können sich allerdings auch manchmal an Menschen vergreifen und einen sehr intensiven und großflächigen Juckreiz hervorrufen. Das Ergebnis sind offene Stellen in der Haut, die sich auch entzünden können. Von tropischen Floharten können die Erreger von Pest, Tularämie und murinem oder endemischem Fleckfieber übertragen werden.
Systematik der Flöhe:
- Pulicoidea
- Pulicidae
- Menschenfloh – Pulex irritans
- Kaninchenfloh – Spilopsyllus cuniculi
- Katzenfloh – Ctenocephalides felis
- Hundefloh – Ctenocephalides canis
- Pulicidae
- Vermipsylloidea
- Vermipsyllidae
- Dachsfloh – Chaetopsylla trichosa
- Fuchsfloh – Chaetopsylla globiceps
- Vermipsyllidae
- Ceratophylloidea
- Ceratophyllidae
- Rattenfloh – Xenopsylla cheopis
- Eichhörnchenfloh – Monopsyllus sciurorum
- Hühnerfloh – Ceratophyllus gallinae
- Taubenfloh - Ceratophyllus columbae
- Ischnopsyllidae
- Hufeisennasenfloh – Rhinolophopsylla unipectinata (auf Hufeisennasen)
- Ceratophyllidae
- Hystrichopsylloidea
- Hystrichopsyllidae
- Maulwurfsfloh – Hystrichopsylla talpae
- Spitzmausfloh – Palaeopsylla soricis
- Ctenophthalmidae
- Hystrichopsyllidae
Der Menschenfloh (Pulex irritans)
| Pulex irritans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | ||||||||||
|
Der Menschenfloh (Pulex irritans) ist ein parasitierendes Insekt der Ordnung der Flöhe (Siphonaptera).
Morphologie und Eigenschaften: Der Menschenfloh ist ca. 1,6-3,2mm groß und flügellos. Seine stark ausgebildeten Hinterbeine ermöglichen ihm Sprünge bis zu 30cm hoch und 50cm weit. Als Außenhaut besitzt er eine sehr widerstandsfähige Schicht aus Chitin, die dunkelrotbraun gefärbt ist. Der Menschenfloh hat im Vergleich zu anderen Floharten eine hohe Wirtsspezifität.
Vorkommen: Der eigentliche Menschenfloh ist in Mitteleuropa selten geworden. Viel häufiger werden Menschen vom Hundefloh (Ctenocephalides canis) oder Katzenfloh (Ctenocephalides felis) befallen.
Ernährung: Flöhe saugen Blut und können auch bis zu einem Jahr ohne eine Nahrung auskommen. Für den Biss werden feuchtwarme Regionen am Körper bevorzugt. Ein einziger Floh kann nachts in kurzer Zeit den ganzen Körper mit Stichen übersäen, normalerweise nimmt der Floh pro Tag eine Blutmahlzeit zu sich. Dabei nimmt er oft das Zwanzigfache seines Eigengewichtes auf. Ein Teil des angedauten Blutes wird kurz danach wieder ausgeschieden.
Lebenszyklus: Die Entwicklung des Menschenflohs verläuft über die Stadien Ei, Larve, Puppe und Imago. Ein solcher Zyklus dauert meist von einigen Wochen bis hin zu 8 Monaten. Die erste Begattung erfolgt etwa 8 bis 24 Stunden nach einer Nahrungsaufnahme. Etwa einen Tag nach der Begattung beginnen die weiblichen Flöhe mit der Eiablage. Ein Weibchen legt pro Tag jeweils etwa 50 Eier, die wahllos auf dem Wirtsorganismus abgelegt werden. Sie sind weich, oval, hell, nur etwa 1/2 mm groß und besitzen keine klebrige Außenhülle, weshalb sie jederzeit vom Wirtskörper abfallen können. Die Junglarven schlüpfen etwa 2-14 Tage nach der Eiablage und verstecken sich vorzugsweise in Teppichen, auf Fußböden vor allem an den Ecken und den Wandbereichen in der Nähe der Heizung, in Polstermöbeln, Kissen, Matten und Matratzen. Das von einem Floh angedaute und wieder ausgeschiedene Blut dient den 5mm langen, weißen, fadendünnen Larven als Futter, da sie noch nicht saugen können.
Krankheitsbilder: Als typische Reaktion eines Flohstiches entstehen beim Menschen kleine Papeln. Diese haben eine rote Färbung, sind meist hart, leicht erhöht und üben einen mehr oder minder starken Juckreiz aus. Durch Aufkratzen dieser Papeln kann es zu Sekundärinfektionen kommen.
Der Menschenfloh kann beim Blutsaugen gelegentlich auf mechanischem Wege die Erreger des Fleckfiebers und der Beulenpest übertragen. Die Übertragung erfolgt durch den Kontakt der Flohexkremente oder des kontaminierten Flohkörpers (Saugrüssel) mit der Bisswunde. Weiterhin können Menschenflöhe Zwischenwirte für verschiedene Bandwurmarten wie z.B. den Gurkenbandwurm (Dipylidum canium) sein und diese auch übertragen.
Bettwanze (Cimex lectularius)
| Cimex lectularius | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||
|
Die Bettwanze (Cimex lectularius) ist eine Wanze aus der Familie der Plattwanzen (Cimicidae). Sie sind darauf spezialisiert , in den Schlafplätzen von homoiothermen (gleichwarmen) Lebewesen - vor allem Menschen - zu leben und sich von deren Blut zu ernähren. Bettwanzen sind Zivilisationsfolger und gelten als klassische Parasiten. Wegen ihrer Form und ihres Verhaltens werden sie auch Tapetenflunder genannt. Ein weiterer altertümlicher Name lautet Stinktopp.
Merkmale: Das ausgewachsene Tier ist im hungrigen Zustand papierdünn und breit, misst fünf bis acht Millimeter in der Länge und ist rotbraun in der Farbe. Die Flügel sind zu kleinen Schuppen reduziert und hinten gerade abgeschnitten. Der Halsschild ist vorne halbkreisförmig ausgeschnitten.
Vorkommen: Bettwanzen halten sich vorwiegend in warmen, trockenen Häusern und in Ställen auf.
Ernährung: Bettwanzen sind Blutsauger an Menschen, aber auch an Haustieren, Fledermäusen und Vögeln. Nach der Nahrungsaufnahme sind die Insekten verdickt und rotschwarz gefärbt. Erwachsene Tiere sind resistent gegen Kälte und können bis zu 40 Wochen ohne Nahrung auskommen. Bettwanzen hinterlassen bei starkem Befall einen unangenehmen süßen Geruch im Raum, der sie vor Fressfeinden schützen soll.
Fortpflanzung: Jedes Weibchen legt während seiner Lebenszeit etwa 200 Eier, am Tag 1–12. Aus diesen schlüpfen innerhalb von 14 Tagen Larven, die sich in etwa sechs Wochen über mehrere Stadien zum adulten Insekt entwickeln. Die Larve der Bettwanze ist dem erwachsenen Tier in der Form, aber nicht in der Farbe ähnlich.
Geschichte: Man vermutet, dass die Bettwanze ursprünglich in Asien beheimatet war und sich zusammen mit dem Menschen verbreitet hat.
Die Bettwanze ist seit dem Altertum im Mittelmeerraum bekannt. Ins Innere Europas gelangte sie erst, als die Menschen sich Wohnungen zu bauen begannen, in denen Temperatur und Luftfeuchtigkeit wanzengerecht waren. Dies geschah erst im 17. Jahrhundert. Seitdem hat sich die Bettwanze stark verbreitet.
Da sich heute die Hygiene wesentlich verbessert hat, sind Bettwanzen eher selten anzutreffen. Seit kurzer Zeit werden die Tiere vor allem in Hotels wieder vermehrt festgestellt. Ein Grund hierfür könnte sein, dass sie eine Resistenz gegen die Insektizide entwickelt haben. Als weiterer Grund kommen auch die veränderten Behandlungsmethoden in Frage. Bis in die 1990er Jahre hinein wurde z.B. bei einer Schabenbekämpfung der gesamte Raum mit Insektiziden begast. Allfällige sich im selben Raum befindliche Bettwanzen wurden somit gleichzeitig abgetötet. Heute werden Schaben mit Fraßködern bekämpft, wobei sich im selben Raum befindliche Bettwanzen (als reine Blutsauger) dabei nicht tangiert würden.
 |
 |
Schadwirkung: Diese Schädlinge verbergen sich tagsüber in Verstecken, wie etwa Ritzen, in der Matratze usw., meist aber ausschließlich in Schlafräumen oder Schlafstätten. Von diesen Verstecken aus, in denen sie notfalls bis zu einem halben Jahr hungern können, überfallen Scharen von Wanzen vor allem nachts ihre Opfer. Wenn ein Mensch oder ein anderer Warmblüter von einer Wanze gestochen wird, benötigt die Wanze bis zu zehn Minuten, um ihre Nahrung aufzunehmen, deren Menge bis zum Siebenfachen des Ausgangsgewichts des Insekts gehen kann. Ihr Speicheldrüsensekret ist toxisch und ruft bei den meisten Menschen länger als eine Woche Juckreiz hervor. Bei empfindlicheren Menschen kann es zu großflächigen Hautentzündungen, Unbehagen und Sehstörungen kommen.
Bettwanzen als Krankheitsüberträger: Durch den Biss der Wanze kann Hepatitis B übertragen werden: Das Virus kann sich jedoch nicht in der Wanze vermehren und wird dadurch nur auf mechanischem Wege weitergegeben (siehe auch Virusinfektion). Es sind drei mögliche Übertragungswege nachgewiesen worden: Das Töten der Tiere durch Zerquetschen mit der Hand; Kontakt mit den Ausscheidungen; eine Unterbrechung des Saugvorganges, wodurch halbverdautes Material wieder herausgewürgt werden kann.
Insgesamt wurden schon 28 verschiedene Krankheitserreger in den Bettwanzen nachgewiesen, unter anderem auch das Hepatitis C-Virus und das HI-Virus, allerdings ist bislang eine Übertragung nicht belegt.
Bekämpfung : Es gibt geeignete Verfahren mittels Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung. Die Bekämpfung sollte aber in jedem Falle einem Fachmann, sprich Kammerjäger, überlassen werden. Eine andere Methode ist, mit einem speziellen Ofen die Zimmertemperatur während ein-einhalb Tagen auf ca. 55° zu erhöhen (Wärmeentwesung). Bei dieser Temperatur sterben die Tiere und ihre Eier ab. Auch diese Methode sollte nur von Spezialisten durchgeführt werden.
Spinnentiere
Sarcoptes scabiei (Krätzmilbe)
| Sarcoptes scabiei | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||
|
Morphologie und Eigenschaften: Krätzemilben (Sarcoptes scabei) haben eine obligat parasitäre Lebensweise. Als Angehörige der Arthropoden verfügen sie über acht paarig angeordnete Beine. Typisch für die Milben ist dabei, dass die beiden hinteren Beinpaare den Rand des gedrungenen Körpers nicht überragen und genau wie die beiden vorderen Beinpaare stummelförmig ausgebildet sind. Die Größe der weiblichen Exemplare beträgt etwa 350 x 280 µm, männliche Milben erreichen 240 x 150 µm. Charakteristisch ist das Vorhandensein von Haftscheiben, die einem ungegliederten Stiel aufsitzen und an den Beinen befestigt sind. Weibliche Milben tragen diese Organe nur an den beiden vorderen Beinpaaren, bei Männchen besitzt auch das dritte Beinpaar diese Einrichtung. Die restlichen Gliedmaßen laufen in Borsten aus.
Lebensweise; Die Entwicklung der Milben läuft vom Ei über ein Larven- und zwei Nymphenstadien zum adulten Tier und dauert beim Männchen etwa 14 Tage, beim Weibchen eine Woche länger. Nur die Weibchen legen Bohrkanäle im Stratum corneum der Epidermis an, in welche sie ihre Eier und ihren Kot deponieren. Die männlichen Milben wandern auf der Suche nach Weibchen hauptsächlich auf der Hautoberfläche entlang. Eine weibliche Milbe kann ein Alter von bis zu 60 Tagen erreichen. Außerhalb des Wirtes beträgt die Überlebenszeit maximal 3 Tage.
Krankheitsbild: Scabies (Acarodermatitis), umgangssprachlich auch als Krätze bezeichnet, ist eine weitverbreitete parasitäre Hauterkrankung der Säugetiere (u.a. Hund, Katze, Mensch) und Vögel. Sie wird beim Menschen durch die Krätzemilbe (Sarcoptes scabiei) verursacht. Die halbkugelförmigen, 0,3 mm großen Weibchen bohren sich in die Oberhaut und legen dort in den Kanälchen (caniculi, Milbengänge) Kot und ihre Eier ab. Ihre Absonderungen bringen Bläschen, Papeln, Pusteln, Blasen, Quaddeln, Infiltrationen und als Sekundärläsionen Krusten, Kratzwunden und Furunkel hervor. Zwischen Kontakt und Ansteckung liegen etwa 3 bis 6 Wochen.
Symptome: Es werden vor allem die Finger, Handgelenke, Gesäß, Genitalien, Ellbogen, Achseln, Gürtelgegend, Knie, Gelenkbeugen und Füße befallen, am liebsten in den Hautfalten, nicht jedoch Nacken oder Kopf. Am störendsten wird das konstante, hartnäckige Jucken in den verschiedensten Schweregraden empfunden. Juckreiz tritt bei leichtem Milbenbefall meist nur nachts und durch die Bettwärme auf, da die Milbe bei warmer Haut aktiver wird. Durch das oft automatische und intensive Kratzen entstehen die Läsionen.
Übertragung: Krätzmilben breiten sich unabhängig von den hygienischen Verhältnissen – ähnlich wie Läuse – dort aus, wo viele Menschen zusammenkommen. Betroffen sind besonders Alten- und Pflegeheime, aber auch Kindergärten, Schulen und sogar Krankenhäuser. Scabies wird von Mensch zu Mensch durch häufigen und langandauernden Kontakt, selten durch einfachen Kontakt übertragen.
Komplikationen: Striemenartige Kratzeffekte, Pyodermien, Ekzem, regionäre Lymphadenitis.
Therapie: Das wirksamste Medikament ist eine 5-prozentige Permethrin-Salbe (z.B. InfectoScab, Zulassung seit Dezember 2004), die in der Regel nach einmaliger Anwendung die Krätzemilben abtötet. Permethrin ist ein Insektizid, das trotz besserer Wirksamkeit gegen die Milben für den Menschen weniger toxisch wirkt als die früher eingesetzten Lindan-Zubereitungen (z. B. Jacutin). Weiterhin ist eine Behandlung mit Pyrethroiden oder Crotamiton möglich, wobei letzteres jedoch eine deutlich schlechtere Wirksamkeit aufweist.
Während der Behandlung sollten alle Gegenstände, mit denen andere Personen in Kontakt kommen, regelmäßig desinfiziert werden, um eine Übertragung zu verhindern. Ebenfalls ist auf häufige Reinigung von Bett- und Leibwäsche zu achten. Diese sollte nach Möglichkeit bei mindestens 60°C gewaschen werden. Wenn dies nicht möglich ist, kann die Wäsche für einige Tage beispielsweise in Plastiksäcken fest eingelagert werden, um den Milben die Nahrungsgrundlage zu entziehen. Die Milben können bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchte höchstens zwei bis vier Tage außerhalb des menschlichen Körpers überleben, bei 12 °C und feuchter Luft auch bis zu 14 Tagen.
Ixodides ricinus (Gemeiner Holzbock)
| Ixodes ricinus | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||
|
Der gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) ist die bekannteste Art der Schildzecken. Sie bevorzugt als Wirt nicht nur Wild- und Haustiere, sondern auch den Menschen. Die Zecke kann die Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen.
Lebenszyklus: Der Holzbock durchläuft wie alle anderen Schildzecken einen Entwicklungszyklus von 1 bis 3 Jahren. Dabei entwickelt er sich in drei Stadien von der Larve über die Nymphe bis hin zur adulten Zecke. Für jedes Stadium benötigt er eine Blutmahlzeit. Dabei stechen sie nicht den Wirt, sondern sie graben sich mit ihren Beisswerkzeugen in die Haut. Im letzten Stadium als adulte Zecke entnehmen die Weibchen dem Wirt so viel Blut, bis sie ungefähr das 200fache ihres Eigengewichts haben. Danach legen sie ca. 2000 Eier und verenden. Die Männchen begatten die Weibchen auf dem Wirt bei deren letzten Mahlzeit und sterben. Ob die Männchen nur ein einziges Weibchen begatten, ist umstritten.

Morphologie und Eigenschaften: Die Färbung aller Zeckenarten hängt vom Stadium der Zecke ab, denn erst im adulten Stadium haben die Zecken eine völlige Eigenfärbung. Im Nymphen- und erst recht im Larvenstadium sind die Zecken noch so klein und durchsichtig, dass sie in 80% der Fälle nicht bemerkt werden.
Im Gegensatz zu vielen anderen Zecken unterscheiden sich die Männchen und Weibchen der Holzböcke im Aussehen nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihren schwarzen Schild auf dem Rücken. Der Schild des Männchens erstreckt sich über den ganzen Körper; beim Weibchen bedeckt er hingegen nur den vordersten Teil, damit sie mehr Blut aufnehmen kann und da sie später den Platz für die Eier benötigt.
Die Zecke sitzt auf Grasshalmen und wartet auf vorbeistreifende Säugetiere. CO2- und Wärmesensoren helfen ihr dabei, den richtigen Wirt zu finden. Auf dem Körper des Opfers krabbelt das Spinnentier noch einige Zeit umher, um eine feuchte und warme Stelle zu finden (Achseln, Leiste).

Krankheitsbilder: Die Zecke kann in Endemiegebieten die Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen.
Therapie: Die Zecke sollte vorsichtig mit einer Splitterpinzette oder einer speziellen Zeckenzange dicht über der Haut am Kopf gefasst und unter leichtem Zug für 60 Sekunden festgehalten werden, meist lässt sie dann von selbst los. Geschieht dies nicht, zieht man sie unter leichtem Hin- und Herbewegen heraus, ohne sie dabei zu drehen (Gefahr, dass der Kopf abreisst!). Die Bissstelle sollte vom Patienten nachbeobachtet werden. Eine primäre Antibiose ist nicht notwendig. Wenn der Kopf in der Wunde verbleibt ist eine Entfernung in lokaler Betäubung notwendig.
Proph.: FSME-Impfung in Endemiegebieten, zeckendichte Kleidung, Duschen nach Waldspaziergängen, Aufenthalten im Freien etc.
In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht über die Erregerspektren bei verschiedenen infektiösen Erkrankungen. Welche Erreger am wahrscheinlichsten anzutreffen sind hängt von vielen Faktoren ab: Erregerkontakt, Hygiene, Eintrittspforten, Immunstatus, Ernährungs- und Allgemeinzustand, Vorerkrankungen, Medikation, Alter, Geschlecht, geographische Region, individuelle Keimbesiedelung u.a.m..
Das Management infektiöser Erkrankungen ist die Domäne der Infektiologie, der ein eigenes Buch gewidmet wird.
Herz-Kreislauf-System und Mediastinum
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Endocarditis ulcero-polyposa
(Nativklappen) |
|
|
| |
| Endocarditis lenta |
|
|||
| Prothesenendokarditis |
Früh-Infektion:
Spät-Infektion (>6 Monate):
|
|
||
| Endocarditis verrucosa rheumatica |
|
|||
| Myokarditis |
seltener:
|
seltener:
Chlamydia trachomatis |
|
|
| Perikarditis
(ähnl. Myocarditis) |
meist viral:
|
|
seltener:
|
|
| Mediastinitis |
|
|||
| Sepsis |
seltener:
|
|
Respirationstrakt und HNO
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Otitis externa |
|
|
||
| Akute Otitis media | Resp. Viren (40%) |
In 60% bakteriell:
bei Neugeborenen:
|
||
| Mastoiditis |
meist bakteriell, siehe akute Otitis media |
|||
| Akute (Rhino-)Sinusitis |
|
Häufig Superinfektion bei viralem Infekt, dontogen:
|
||
| Akute Rhinitis |
seltener:
|
|||
| Odontogene Infektionen |
|
|||
| Noma |
|
|||
| Akute Pharyngitis/Tonsillitis |
|
selten:
|
||
| Epiglottitis |
seltener:
|
|||
| Akute Laryngitis |
|
|
||
| Akute Tracheobronchitis |
häufig Viren:
|
oft auch als Superinfektion:
seltener:
|
||
| Bronchitis als exazerbierte COPD | meist bakteriell:
|
|||
| Pneumonie |
Respiratorische Viren:
Immunsupprimierte:
|
Ambulant erworbene Pneumonie (community acquired pneumonia, CAP, bis 48h nach Aufnahme):
Nosokomial erworbene Pneumonie (nosocomial acquired pneumonia, NAP, 48h nach Aufnahme bis 4 Wochen nach Entlassung): NAP A ohne Risikosituation:
NAP B mit Risikosituation, zusätzlich:
|
Bei Immunsuppression:
|
|
| Interstitielle Pneumonie |
|
|
|
|
| Spektrum bei Mukoviszidose (Altersabhängig) |
|
|
||
| Pleuritis | ||||
| Pleuraempyem |
|
Magen-Darm-Trakt
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Sialadenitis |
|
|
||
| Stomatitis |
|
|
|
|
| Karies |
|
|||
| Peridontitis |
meist polymikrobiell, aerob-anaerob
|
|||
| Aktinomykose | Actinomyces spp. plus Anaerobier | |||
| Ösophagitis |
|
|
||
| Chronische Gastritis |
|
|||
| Hepatitis |
|
|
||
| Leberabszess |
|
| ||
| Cholezystitis |
|
Leberegel:
| ||
| Pankreatitis |
|
|
||
| Gastroenteritis/Enterokolitis |
|
|
| |
| Pseudomembranöse Colitis |
|
|||
| Peritoneale und intraabdominelle Infektionen |
|
Nervensystem
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Erworbene Meningitis ohne Grunderkrankung | Virale Meningitis (häufig):
|
Bakterielle Meningitis:
|
||
| Neonatale Meningitis |
|
|||
| Meningitis bei Immunsuppression |
|
|
||
| Meningitis bei Schädelbasisfraktur |
|
|||
| Meningitis bei SHT / neurochirurgischen Eingriffen |
|
|||
| Meningitis bei cerebrospinalem Shunt |
|
|||
| Chronische Meningitis |
|
|
|
|
| (Meningo) Enzephalitis |
|
|
| |
| Hirnabszess |
|
|
| |
| Neuritis |
|
|||
| Guillain-Barré-Syndrom |
|
Haut
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Phlegmone |
seltener:
|
|||
| Cellulitis |
|
|||
| Bissverletzungen |
Tiere:
Mensch:
|
Häufig Mischinfektionen mit Anaerobiern (Bacteroides, Clostridien) Generell:
Nager:
Katzen:
Hunde:
Mensch:
|
||
| Wundinfektionen |
|
|||
| Kutane Abszesse |
|
|||
| Impetigo |
|
|||
| Erysipel |
|
|||
| Exantheme |
|
|
||
| Herpes zoster |
|
|||
| Dellwarzen |
|
|||
| Verrucae vulgares |
|
|||
| Condyloma accuminatum |
|
|||
| Milzbrand |
|
|||
| Syphillis |
|
|||
| Lepra |
|
|||
| Akne vulgaris |
|
|||
| Erythema chronicum migrans |
|
|||
| Dermatomycosen |
|
|||
| Mucomycosen |
|
|||
| Scabies (Krätze) |
|
Bewegungsapparat und Weichteile
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Bakterielle Arthritis |
|
|||
| Reaktive Arthritis |
|
|
||
| Hämatogene Osteomyelitis |
|
Spezifische Osteomyelitis:
|
||
| Fortgeleitete Osteomyelitis |
Bei vaskulärer Insuffizienz:
|
|||
| Periprothetische Infektion |
|
|||
| Myositis | ||||
| Nekrotisierende
Weichteilinfektionen |
Sonderform Gasbrand:
|
Blutbildendes und lymphatisches System
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Neugeborenenerythroblastose |
|
|||
| Lymphadenitis |
|
|
Niere und Harnwege
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Urethritis |
|
| ||
| Cystitis und interstitielle Nephritis |
seltener:
bei Kindern auch:
|
| ||
| Hämatogene Glomerulonephritis |
|
|||
| Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) |
|
Weibliche Geschlechtsorgane
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Kolpitis |
|
|
|
|
| Zervizitis |
|
|||
| Endometritis/ Salpingitis/ Adnexitis |
|
|||
| pelvic inflammatory disease (PID) |
|
| ||
| Mastitis | ||||
| Zervixkarzinom | HPV 16, 18 u.a. |
Schwangerschaft
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Gefährdung des Kindes |
|
|
| |
| Puerperalsepsis |
|
Männliche Geschlechtsorgane
| Erkrankung | Viren | Bakterien | Pilze | Parasiten |
|---|---|---|---|---|
| Prostatitis |
|
|||
| Vesiculitis | ||||
| Epididymitis |
|
|||
| Orchitis |
|
|
|
Literatur und Weblinks
Quellen
- ↑ Carlton JM et al. “Draft genome sequence of the sexually transmitted pathogen Trichomonas vaginalis”. Science, 315(5809):207-12, Jan 12 2007. DOI:10.1126/science.1132894. PMID:17218520
- ↑ McClelland RS et al. “Infection with Trichomonas vaginalis Increases the Risk of HIV-1 Acquisition”. J Infect Dis, 195(5):698-702, Mar 1 2007 Epub 2007 Jan 22. DOI:10.1086/427262. PMID:17262712 PDF
- ↑ Cherenet T, Sani RA, Panandam JM, Nadzr S, Speybroeck N, van den Bossche P.: Seasonal prevalence of bovine trypanosomosis in a tsetse-infested zone and a tsetse-free zone of the Amhara Region, north-west Ethiopia. Onderstepoort J Vet Res. 2004 Dec;71(4):307-12.
- ↑ Taylor S et al. “A Secreted Serine-Threonine Kinase Determines Virulence in the Eukaryotic Pathogen Toxoplasma gondii”. Science, 314(5806):1776-80, Dec 15 2006. DOI:10.1126/science.1133643. PMID:17170305 - . “Pathogenität von Toxoplasma gondii geklärt”. Deutsches Ärzteblatt, Dez 15 2006.
- ↑ Spektrum der Wissenschaft 5/2005, S. 20 ff.: Neue Hoffnung auf Malaria-Impfstoff.
- ↑ Spektrum der Wissenschaft 1/2006, S. 10: Endlich ein Malaria-Impfstoff?.
- ↑ http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/188/19169/
- ↑ Pressemitteilung der EU-Kommission vom 31. Juli 2003
- ↑ http://www.indian-skeptic.org/tmp/malaria.html
- ↑ http://www.stock-world.de/news/article.m?news_id=1900758
- ↑ http://www.spiegel.de/wissenschaft/erde/0,1518,402109,00.html
Literatur und Weblinks zum Thema Mikrobiologie. Weiterführende Links zu besonderen Teilgebieten finden Sie auf den entsprechenden Unterseiten.
Literatur
- Hahn, Falke, Kaufmann: Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie, Springer, ISBN 3540678573
- Kayser, Böttger, Zinkernagel: Medizinische Mikrobiologie, Thieme, ISBN 3134448114
- Dörries, Geginat: Medizinische Mikrobiologie (Duale Reihe), Thieme, ISBN 3131253134
Achtung! Die angegebene bzw. verlinkte Auflage muß nicht die aktuellste sein!
Weblinks
- Robert-Koch-Insitut (RKI)
- Medical Microbiology - eBook im Bookshelf von NCBI (engl.)
- Microbiology and Immunology Online - eBook (engl.)
- Infektionsnetz.at - Erreger, Krankheitsbilder und Antiinfektiva
- Pathology of Infectious Diseases - Pathologie infektiöser Erkrankungen
- Public Health Image Library (PHIL) - Die meisten Bilder in diesem Wiki-Buch stammen von dieser Seite
- Dennis Kunkel's Mikrokosmos - Mikrokosmos in Color und S/W
Haftungsausschluss
Bitte beachte die Haftungsausschlüsse. Für Wikibooks gelten die gleichen Bestimmungen wie für Wikipedia. Diese sind online verfügbar unter:
Lizenz
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
Kopieren, Verbreiten und/oder Verändern ist unter den Bedingungen der GNU Free Documentation License, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, erlaubt. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext. Eine Kopie des Lizenztextes ist hier zu entnehmen: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License .
Eine inoffizielle deutsche Übersetzung der GNU Free Documentation License findet sich hier: http://www.giese-online.de/gnufdl-de.html .
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen .







